
Aus den nachstehenden drei Bänden bieten wir Ihnen Texte zum kostenfreien Abdruck an.
jeder Band 192 Seiten,
viele Abbildungen, Ortsregister.
je 4,90 Euro,
Zeitgut Verlag, Berlin,
Retter
in der Not, aus Band 1 (3.938 Zeichen)
Die Annonce, aus Band 1 (5.374 Zeichen), 1 Abbildung
O Tannenbaum, o Tannenbaum, aus Band 2 (4.024 Zeichen),
1 Abbildung
Der Traum vom Puppenhaus, aus Band 2 (2.733 Zeichen),
2 Abbildungen
Die
Puppen im Schrank, aus Band 3 (3.306 Zeichen), 2 Abbildungen
Zuhause, aus Band 3 (5.263 Zeichen)
Das Weihnachtsgeschenk, aus Band 3 (4.061
Zeichen)
Nachricht für den Weihnachtsmann, aus Band 3
(2.215 Zeichen)
Meine Rosa, aus Band 3 (2.805 Zeichen)
Meine erste Friedensweihnacht (2.267 Zeichen)
zusätzlich
ab 24.11.2006
Die
Weihnachtsgans im Rucksack, aus Band 2 (5.415 Zeichen)
Alle Jahre wieder - dieser verflixte Weihnachtsbaumkauf,
aus Band 2 (6.345 Z.)
Unheimlich groß und dünn, aus Band 3 (4.000
Zeichen)
Später Besuch, aus Band 1 (5.189 Zeichen)
Die Schüssel auf dem Schrank, aus Band 1 (2.656
Zeichen)
Warten auf das Christkind, aus Band 1 (7.000 Zeichen)
Willis
Heimkehr, aus Band 1 (8.761 Zeichen)
*)
Bei Interesse am Abdruck, senden Sie bitte den Kupon aus dem Newsletter
an uns zurück. Wir schicken Ihnen umgehend die Zugangsdaten zum
Download der Texte als doc-Datei und der hochaufgelösten Bilder.
Wir erwarten von Ihnen lediglich den Abdruck des Quellen-Hinweises und
eines minimal 30 mm breiten Buchcovers.
Für
Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Lydia Beier, Öffentlichkeitsarbeit
Zeitgut Verlag GmbH, Berlin
E-Mail: lydia.beier@zeitgut.com
Tel. 030 - 70 20 93 14
Fax 030 - 70 20 93 22
aus: "Unvergessene Weihnachten", Band 1
Retter in der Not
(3938 Zeichen)
von Margot Linke
[Berlin-Reinickendorf;
1943]
Auf Weihnachten freuten
wir sechs Geschwister uns immer ganz besonders. Große Gaben hatten
wir nicht zu erwarten, aber es gab immer einen Weihnachtsbaum, einen bunten
Teller, etwas Praktisches und ein unerwartetes kleines Geschenk. Meine
kleineren Schwestern träumten stets von allerlei schönen Dingen,
die, obwohl wir schon im vierten Kriegsjahr waren, noch in den Spielwaren-Geschäften
ausgestellt wurden. Diesmal hatten sie niedliche Püppchen gesehen,
die ihnen der Weihnachtsmann bringen sollte.
Da das Geld immer sehr knapp war, kaufte meine Mutter oft schon im Herbst
einige Kleinigkeiten für den Weihnachtstisch. Sie fing auch früh
an, Nüsse, Marzipan und andere Süßigkeiten für den
bunten Teller zu sammeln.
Eines Tages stellte Schwester Edith fest, daß die mittlere Schublade
der großen Kommode verschlossen war. Nun ging die Raterei los, jede
wüßte zu gerne, was da wohl schon versteckt sei. Ich war damals
elf Jahre alt und nicht weniger neugierig als die Kleinen. Als meine Eltern
einmal nicht zu Hause waren, überlegten wir, ob man nicht die obere
nicht verschlossene Lade herausziehen könnte, um einen Blick in die
untere zu werfen. Es war schwierig, das klobige Ding überhaupt zu
bewegen. Schließlich gelang es uns, den Kasten auf den Fußboden
zu bugsieren. Und nun konnte man sogar in die andere hineinfassen!
Große Freude bei uns allen, denn darin lagen vier Püppchen,
wie sie sich meine Schwestern wünschten. Jede hatte ein andersfarbiges
Kleid an. Trudchen, Erika, Elfriede und Mohrchen entschieden sich gleich
für eine bestimmte Farbe. Sie wurden gedrückt und geknutscht
und keine wollte das Püppchen wieder hergeben. Aber das ging ja nicht,
die Zeit verstrich, und wir mußten ja die alte Ordnung wiederherstellen.
Das war jedoch leichter gedacht als getan. Der schreckliche Kasten war
so schwer, daß er sich kaum bewegen ließ. Und nun klingelte
es auch noch!
Vor der Tür stand unser Nachbar, der bei uns in der Residenzstraße
das wichtige Amt eines Blockwartes bekleidete. So richtig leise war es
bei uns sehr selten, aber diesmal mußten wir wohl übertrieben
haben, daß es den Ordnungshüter auf den Plan brachte. Er kannte
alles und jeden im Haus, außergewöhnliche Dinge blieben ihm
nicht verborgen. Mit den Worten: "Ist was passiert?", schritt
er schnurstracks ins Zimmer - und übersah die schwierige Situation
sofort.
Ohne auf unsere Erklärungsversuche einzugehen, wuchtete er die Schublade
in die Höhe und schob sie wieder in die Kommode! Wir hätten
ihm jetzt vor lauter Dankbarkeit alles versprochen, mußten ihn aber
doch inständig bitten, unseren Eltern nichts zu verraten. Wir haben
nie erfahren, ob er dichtgehalten hat - rausgekommen ist letzten Endes
doch alles.
Endlich war Weihnachten. Das Wohnzimmer, meistens etwas kühl, war
am Heiligen Abend gut geheizt, der Baum wunderschön geschmückt.
Kugeln und Lametta wurden von Jahr zu Jahr aufgehoben, und aus Resten
hatten wir sogar Kerzen gegossen. Nach der Bescherung saß jedes
Kind auf dem ihm zugewiesenen Platz am Tisch, als sich plötzlich
ein fürchterliches Geschrei erhob. Die Kleinen zankten und schrien:
"Ich will rosa!", "Ich will grün!" und gerieten
sich fast in die Haare.
Unsere Eltern guckten erst etwas verstört, behielten zum Glück
aber die Nerven und schlugen dann vor, sie sollten doch die Puppen tauschen.
Nun kehrte Frieden ein, Weihnachtslieder wurden gesungen, Gedichte aufgesagt
und schon von den Köstlichkeiten des bunten Tellers genascht.
Als ich meine Mutter viel später einmal fragte, wieso sie bei dem
Durcheinander Weihnachten nicht ausgerastet sei, meinte sie, längst
hätte sie gemerkt, daß etwas im Busche war. Die Kinder bemühten
sich ein paar Tage unerwartet freundlich miteinander umzugehen und auch
artig zu sein. Der Clou war dann, daß sie beim Einteilen der Süßigkeiten
für die Bunten Teller gemerkt hatte, daß eine einem Marzipan-Schweinchen
den Kopf abgebissen hatte.
Bei Interesse am
Abdruck, senden Sie bitte den Kupon aus dem Newsletter an uns zurück.
[nach oben]
Aus: "Unvergessene
Weihnachten" Band 1
Die Annonce (5374 Zeichen)
von Georg Günther
[Magdeburg/Elbe;
Sachsen-Anhalt;
Advent 1945]
Es war in der Adventszeit
des Jahres 1945. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges war unsere fünfköpfige
Familie endlich wieder beisammen. Kurz vor Kriegsende in unserer Heimatstadt
Magdeburg total ausgebombt, bestand unser Hab und Gut nur noch aus zwei
geretteten Koffern mit Kleidungsstücken. Wir waren sehr beengt in
einer kleinen Wohnung vorübergehend untergebracht. Die eigentliche
Mieterin war mit ihrem Kind während der Kriegszeit evakuiert worden
und wohnte auf dem Lande. Natürlich wollte sie wieder zurückkommen,
aber dies ging erst, nachdem wir etwas anderes gefunden hatten. Das Jahresende
mußten wir noch dort verbringen.
Mein Bruder war, wenn auch verwundet, aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrt;
auch meine Schwester kam von der Seefahrt zurück. So sahen wir dem
bevorstehenden Weihnachtsfest mit Dankbarkeit und Freude entgegen.
Dieses Fest sollte nun in unserer Familie nach all den Erlebnissen und
Entbehrungen etwas Besonderes werden. Es sollte sich auch äußerlich,
durch kleine Geschenke und Überraschungen, abheben von den anderen
Tagen. Das war jedoch 1945 sehr schwer, es gab fast nichts. Da mußten
die Erwachsenen verzichten. Meine Erwartungen - ich war damals 12 Jahre
alt - sollten jedoch nicht gänzlich enttäuscht werden.
Meine Schwester hatte die Idee, eine Annonce aufzugeben. Wo und wie aber?
Eine Zeitung erschien noch nicht wieder. Anstelle dessen wurden Bretterplanken
und Mauern genutzt, um auf selbstverfaßten Zetteln Such- oder Tauschwünsche
zu veröffentlichen. Und so schrieb meine Schwester einen derartigen
Zettel mit folgendem Text:
"Biete Lebensnotwendiges, suche Spielzeug für 12jährigen
Jungen und Kaffee."
Mit letzterem gedachte sie, auch meiner Mutter eine Freude zu bereiten.
Mit dem Zettel, Nägeln und Hammer bewaffnet machte sich meine Schwester
also auf den Weg zu einer Hausruine an einer Straßenecke, wo sie
die Annonce an eine Holzplanke nagelte. Davor stand immer eine Schar Menschen
und las die Tauschangebote.
Ich erfuhr von dieser Sache natürlich nichts. Wie mir meine Schwester
später erzählte, ist sie täglich zu der Annoncen-Planke
gegangen, immer mit der Hoffnung auf ein Angebot. Dann endlich, ein paar
Tage vor Heiligabend, stand eine Adresse unter der Anzeige. Auf die Nachfrage
nach Spielzeug, meldete sich ein junges Ehepaar. Der Mann besaß
noch einiges aus seiner Kinderzeit, das er gern gegen Lebensmittel eintauschen
wollte. Den Leuten konnte mit etwas Fleisch geholfen werden, und meine
Schwester erhielt dafür das gesuchte Spielzeug für ihren kleinen
Bruder.
Auch für den Kaffee bekam sie ein Angebot. Es meldete sich eine alte
Frau. Meine Schwester ging am Tag vor Heiligabend zu ihr und nahm ebenfalls
etwas Fleisch mit, denn wir hatten durch eine Schlachtung, bei der mein
Bruder half, ein größeres Stück als Lohn bekommen. Die
Vorfreude meiner Schwester war so groß, daß sie den weiten
Weg schnell zu Fuß zurücklegte. Dort angekommen, gab es aber
eine Enttäuschung für sie: Die Frau bot nur Malzkaffee!
Dies meinte sie mit dem Wort Kaffee. Also ein Mißverständnis.
Meine Schwester entschloß sich, das Mitgebrachte dort zu lassen,
den Malzkaffee auch. Als Gegenleistung entdeckte sie bei der alten Frau
ein paar Freudentränen, und das war Dank genug. Es war wie ein Licht,
das in schwerer Zeit angezündet war. Ihr Weihnachtsbraten war gesichert.
Zu dem Bohnenkaffee sind die Frauen am Ende doch noch gekommen. Wie weiß
ich nicht.
Was denkt wohl ein Kind, wenn es keinen Weihnachtsbaum zu Weihnachten
geben soll?
Ich drießelte meinen Vater schon lange vor dem Fest nach einem Weihnachtsbaum.
Zu kaufen gab es keinen, das wußte ich auch. Aber was sollte werden?
Ich konnte mir jetzt, wo wir doch alle wieder zusammen waren, Weihnachten
ohne Baum einfach nicht vorstellen.
Mein Vater wußte Rat: "Dann gehe ich in den Wald - schließlich
war er mal Familienbesitz - und hole selber eine Fichte!"
Sprach's und machte sich am anderen Morgen früh auf den Weg. Der
Wald lag 25 Kilometer von uns entfernt, in östlicher Richtung über
der Elbe. Die Brücken waren gesprengt, nur eine Holzbrücke war
gebaut worden. Eisenbahnzüge verkehrten darüber jedoch nicht.
Also mußte Vater zu Fuß, etwa 2 ½ Stunden bis zum nächsten
Bahnhof auf der anderen Elbseite gehen.
Da fuhr auch kaum ein Zug. Kohlen für die Lokomotiven waren sehr
knapp. Schließlich ging es doch los, kalt und voll waren die Wagen.
Endlich erreichte der Zug den Ort, wo der Wald lag. Bäume gab es
dort genug, so daß die Auswahl nicht schwerfiel, und er einen Weihnachtsbaum
selbst schlagen konnte. Der Rückweg war genauso strapaziös wie
der Hinweg. Am anderen Tag erst traf der Vater wieder zu Hause ein und
berichtete uns von seinen Erlebnissen, aber es hatte sich gelohnt.

Endlich wieder beisammen: meine Eltern, meine Geschwister und ich Weihnachten
1945 in unserer Heimatstadt Magdeburg.
Am Heiligen Abend
stand der Baum mit selbstgegossenen Kerzen und selbstgefertigtem Christbaumschmuck
im Wohnzimmer. Darunter lagen für mich drei Kinderbücher und
ein Fußballspiel.
So konnte die sich nach dem Zweiten Weltkrieg wiedergefundene Familie
ein glückliches Weihnachtsfest feiern. Meine Schwester freute sich
über die gelungene Überraschung für den kleinen Bruder
und war überglücklich. In der heutigen Zeit bedarf es dazu weitaus
größerer Geschenke - die Zeit ist eine andere.
Bei Interesse am
Abdruck, senden Sie bitte den Kupon aus dem Newsletter an uns zurück.
[nach oben]
Aus: "Unvergessene Weihnachten" Band 2
O Tannenbaum, o
Tannenbaum ... (4024 Zeichen)
von Joachim Weimar
[Gera,
Thüringen;
1938]
Dieses schlichte Volkslied,
das zur Weihnachtszeit gespielt und gesungen wird, hat einst ein Zimmermann
aus Goldlauter im Thüringer Wald komponiert. Mich erinnert besonders
dieses Lied an meine Kindheit, die ich bei meinen Großeltern in
Gera verbrachte.
Zum Weihnachtsabend versammelte sich die gesamte Familie in der kleinen,
bescheidenen Wohnung. Zu Weihnachten gehörte natürlich auch
ein mit Kerzen, Naschwerk, Glaskugeln und Lametta festlich geschmückter
Tannenbaum.
Da die "gute Stube" der großelterlichen Wohnung nicht
gerade geräumig war, wurde der stattliche Baum an die Decke gehängt.
Das entlastete zwar die räumliche Enge, brachte aber andere Probleme
mit sich. Ich erlebte es nie, daß der Weihnachtsbaum so hing, wie
er sollte. Immer waren zusätzliche Stabilisierungsmaßnahmen
erforderlich. Einmal wurde sogar ein in Silberpapier eingewickeltes Brikett
als Ausgleichsgewicht eingesetzt. Ein anderes Mal wurde der Baum mit dünnen
Fäden in eine senkrechte Lage gezurrt, so daß er im Prinzip
eher einem Fesselballon ähnelte, zumal mein Onkel Rudel über
diese Fäden Lametta hängte, um die Gleichgewichtsbemühungen
deutlicher sichtbar zu machen.
Jedenfalls war unser Tannenbaum nicht nur Gegenstand festlicher Andacht,
sondern auch Objekt mancher Frotzelei, was mein Großvater bis dahin
immer gelassen hinnahm. Als sich aber auch noch meine Großmutter
an den Sticheleien beteiligte, war das Maß voll. Nun legte Großvater
ziemlich kategorisch fest: "Martha, nächstes Jahr kaufst du
den Weihnachtsbaum!"
Als vor Jahresfrist Großmutter immer wieder den Weihnachtsbaumkauf
anmahnte, bekam sie jedesmal zu hören: "Martha, dieses Jahr
kaufst du das Bäumchen selber."
Es war höchste Zeit. Am letzten Tag des Weihnachtsmarktes machte
Großmutter sich auf den Weg. Ich mußte sie begleiten, wohl
eher als Lastesel denn als Gutachter.
In der Tat: Großmutter hatte einen Weihnachtsbaum von seltener Schönheit
ausgewählt. Er war von geometrischer und ästhetischer Symmetrie
- und auch nicht billig. Weil der Großmutter noch weitere Besorgungen
einfielen, wurde der Baum in der Fahrradaufbewahrung nahe der Einkaufsstraße
abgestellt.
Es dämmerte schon, als wir ihn dort wieder abholen wollten. Leider
war unser Weihnachtsbaum inzwischen von einem Auto überrollt, das
forstwirtschaftliche Prachtstück sozusagen zu Kleinholz gemacht worden.
Wir bekamen zwar den Kaufpreis vom Betreiber der Fahrradaufbewahrung ersetzt,
aber einen Weihnachtsbaum hatten wir nun nicht mehr.
So blieb uns nichts weiter übrig, als noch einmal auf den Markt zu
gehen. Die Weihnachtsbaumhändler waren schon am Zusammenräumen,
das Geschäft für dieses Jahr war gelaufen. Doch wir hatten Glück
und erstanden noch einen Baum, sogar für den Spottpreis von 25 Pfennigen.
Danach sah er auch aus. Der Händler entschuldigte sich fast dafür,
daß er uns so einen Krüppel von Baum andrehen mußte.
Aber was sollten wir machen?
Diesen oder keinen, so stand die Frage.
Zuhause angekommen mußte ich den Baum erst einmal im Waschhaus abstellen.
Großvater erwartete uns mit sichtbarer Spannung und der von Neugier
geladenen Frage:
"Wo habt ihr denn den Weihnachtsbaum?"
"Im Waschhaus", war Großmutters einsilbige und verlegene
Antwort.
Mit den Worten: "Den muß ich sehen", zündete Großvater
die Petroleumlampe an und ging unverzüglich ins Waschhaus. Noch in
der zweiten Etage hörte ich sein schallendes Gelächter, von
Großmutter kommentarlos hingenommen.
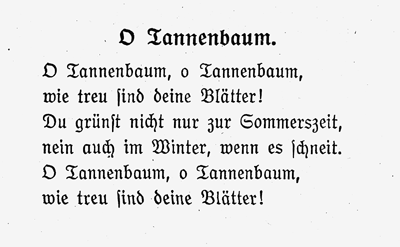
Nie wieder habe ich ein so lustiges Weihnachtsfest, wie das nun anstehende,
erlebt. Den ganzen Abend wurden immer wieder neue und skurrilere Vorschläge
zur Richtungskorrektur des Weihnachtsbaumes unterbreitet und praktiziert.
Aber, was wir auch unternahmen, jedes zusätzliche Gewicht löste
zugleich eine Drallbewegung aus. Diesem Tannenbaum fehlte einfach die
festliche Ruhe.
Möglicherweise hat dieses Erlebnis dazu beigetragen, daß ich
später während meines Ingenieurstudiums sehr schnell die Gesetze
einer Drehbewegung um eine freie Rotationsachse verstanden habe.
Bei Interesse am
Abdruck, senden Sie bitte den Kupon aus dem Newsletter an uns zurück.
[nach oben]
Aus: "Unvergessene
Weihnachten" Band 2
Der Traum vom Puppenhaus (2733)
von Astrid Gassen
[Berlin-Zehlendorf;
1940, 1942]
Jedes Weihnachtsfest
war irgendwie das schönste Weihnachtsfest. Damals jedoch - das waren
Kindheit und Jugend. Damals, das ist lange her. Damals hieß: Familie,
Freunde, Zuhause, Heimat und vieles mehr. Damals war der Duft von Weihnachten,
von Tannen und Kerzen, von Plätzchen, Schokolade, Marzipan und Gänsebraten.
Ich schaue auf das Foto und sehe meine Großmutter, bei der ich aufgewachsen
bin. Meine Eltern ließen sich 1939 scheiden, und ich kam einen Tag
nach meinem fünften Geburtstag, am 8. April 1939, zu meiner Omi,
der Mutter meines Vaters. 17 Jahre blieb ich bei ihr, eine herrliche Zeit.
Ich sehe meinen Papi. Dahinter steht mein Kindermädchen Gretel, die
Größere, genannt Deten, daneben das Hausmädchen Klara,
die ich Pattra nannte, und die uns als erste verließ, um in den
Arbeitsdienst zu gehen. Wir hatten Krieg. Und ich sehe mich, meine Puppenstube,
das Puppenbett, die Spielsachen, unser Zuhause in Berlin-Zehlendorf. Das
zweite Kriegsweihnachten 1940. Jenes Weihnachtsfest wird das schönste
Weihnachtsfest bleiben, weil es Erinnerung ist, weil es meine Kindheit
war.

Weihnachten 1940 war ich fünf Jahre alt. Neben mir kniet mein Vater,
dahinter sitzt meine Oma. Dahinter stehen mein Kindermädchen Gretel
und das Hausmädchen Klara.
Wir waren schon im
dritten Kriegsjahr, als mein Papi mir versprach, zum Weihnachtsfest 1942
ein Puppenhaus für mich zu bauen. Nach der Trennung meiner Eltern
lebte ich bei meiner Großmutter in einem herrlichen alten Haus in
der Zehlendorfer Kleiststraße 15, mein Vater wohnte nebenan in der
Nummer 11 in seinem modernen Haus. Dort befand sich ein für damalige
Verhältnisse bombensicherer Luftschutzkeller, in den wir bei Angriffen
auf Berlin gingen, zusammen mit vielen Nachbarn. Mein Vater fing in diesen
Bombennächten mit dem Bau meines Puppenhauses an. Und nur in diesen,
leider immer häufiger werdenden Bombennächten baute er an meinem
Puppenhaus. Er ging dann in seinen Bastelraum, und mir war natürlich
der Zugang verwehrt.
Weihnachten 1942 stand es dann vor dem großen Weihnachtsbaum im
Haus meiner Großmutter. Meine Freude war riesengroß. Damals
war ich sieben Jahre alt.
Ich konnte nicht ahnen, daß ich nur wenig Freude an diesem Puppenhaus
haben würde. Im August 1943 verließen viele Frauen und Kinder
Berlin, so auch meine Großmutter und ich. Wir haben damals Berlin
für immer verlassen. Mein schönes Puppenhaus wird irgendwo geblieben
sein. Als Erinnerung durch beinahe 60 Jahre blieb ein kleines Foto, dieses
Bild Weihnachten 1942 in Berlin.

Weihnachten 1942 bekam ich dieses wunderschöne Puppenhaus geschenkt.
Mein Vater hatte es in den Bombennächten für mich gebaut.
Bei
Interesse am Abdruck, senden Sie bitte den Kupon aus dem Newsletter an
uns zurück.
[nach oben]
Aus: "Unvergessene Weihnachten" Band 3
Die Puppen im Schrank
(4024 Zeichen)
von Gisela Schoon
[Konikow
bei Köslin*), Hinterpommern;
Dezember 1930]
Meine zwei Jahre ältere
Schwester Annelie und ich gingen noch nicht zur Schule. Wir wohnten in
einem kleinen Dorf in Hinterpommern. Weil unsere Eltern immer viel Arbeit
hatten, waren wir uns häufig selbst überlassen, was unserer
fantasievollen und frohen Kinderzeit nicht schadete, im Gegenteil. Die
Wochen vor Weihnachten waren besonders schön, geheimnisvoll und voller
Vorfreude.
Eines Tages winkte mich Annelie in die gute Stube, die wir sonst nur zu
Festtagen betraten. Der hohe Schrank, in dem unsere Eltern ihre Sonntagskleidung
aufbewahrten, stand offen. "Komm, Gila, guck bloß mal!"
flüsterte sie mit dem Finger auf dem Mund.
Ich sah in den Schrank und entdeckte hinter dunklen Mänteln zwei
wunderschöne Puppengesichter. "Oh! Och!"
Wir standen ganz still vor freudigem Erschrecken und trauten uns nicht,
sie zu berühren, und schon gar nicht, sie hervorzuholen. Wie kamen
die Puppen da hinein? Ob sie wohl für uns waren? War etwa der Weihnachtsmann
schon bei uns gewesen, und Mama hatte die Puppen verstecken sollen?
Etwas schuldbewußt ob unserer Entdeckung schlichen wir zurück
in unsere Spielecke in der Eßstube. Am nächsten Tag zog es
uns wieder zum Schrank. Der Schlüssel steckte, und wir standen wieder
andächtig schauend vor unseren Puppen hinter den Mänteln. "Meine"
Puppe, ich hatte mir die mit dem blonden Bubikopf ausgesucht, lächelte
mich mit ihren strahlend blauen Augen schelmisch an. Ach, war ich glücklich!
Ich taufte sie in Gedanken auf den Namen Susi.
Am dritten Tag standen wir vor einem verschlossenen Schrank ohne Schlüssel.
Eifrig suchten wir nach ihm, jedoch vergeblich. Ob er wohl oben auf dem
Schrank lag?
Das aber konnte Annelie auch mit einem herangezogenen Stuhl nicht nachprüfen,
obwohl sie sich sehr streckte, sie reichte nicht hinauf. Enttäuscht
gaben wir auf. Darüber zu sprechen wagten wir natürlich nicht.

Meine Schwester
Annelie zieht mich auf dem Rodelschlitten. Im Hintergrund ist Opas Bienenhaus
zu sehen.
Endlich war es Heiligabend. Als wir aus der Kirche kamen, liefen wir unseren Eltern voraus. Der Schnee knirschte unter den Stiefeln. Aber alle Eile half nichts, wir mußten warten. Der Weihnachtsmann brauchte in der guten Stube noch einige Zeit. Endlich, endlich öffnete Mama die Tür!
Der brennende Lichterbaum, buntgeschmückt, reichte vom Boden bis zur Decke. Und darunter lagen mit glänzendem Papier verpackte Pakete und Päckchen. Doch dafür hatte ich keinen Blick. Ich suchte die Puppen unter dem Baum und sah sie nicht. Tiefes Erschrecken erfaßte mich. Kaum gelang es mir, mein Gedichtchen aufzusagen. Dann durften wir die Geschenke auspacken. Ganz versteckt unter buntem Papier fand ich, was ich so sehnsüchtig gesucht hatte. Ich schloß meine Susi in die Arme, um sie den ganzen Abend nicht wieder loszulassen.

Die Weihnachtspuppen bekamen ein Jahr später Sportkarren, in denen wir sie hier vorführen. Meine Schwester Annelie, links, und ich vor dem Giebel unseres Elternhauses in Konikow, Hinterpommern.
Unsere Eltern sahen uns lächelnd zu. Heute denke ich, daß sie aufmerksam beobachtet haben, ob wir richtig überrascht waren. Die zufällige Entdeckung der Puppen im Schrank blieb unser Geheimnis.
*) heute Konikowo bei Koszalin in Polen
Bei Interesse am
Abdruck, senden Sie bitte den Kupon aus dem Newsletter an uns zurück.
[nach oben]
Aus: "Unvergessene Weihnachten" Band 3
[Goslar
am Harz, Niedersachsen;
20. Dezember 1949]
Zuhause (5263 Zeichen)
(Diese Geschichte wurde leicht gekürzt)
von Waldemar Siesing
Ein vorweihnachtlicher
Tag, dieser 20. Dezember, wie es unzählige in einem Menschenleben
gibt. Der Schnee fällt tanzend und leise aus den Ewigkeiten herab
auf die Erde, ein rauher Wind weht, wie im Monat Dezember üblich,
durch die Straßen. Der vor dem Bahnhofsgebäude stehende Weihnachtsbaum
verströmt Wärme durch seine vielen Kerzen, die leuchtend anzeigen,
daß die Festtage nicht mehr weit sind. Der Bahnhofsvorplatz, ja
die ganze Kaiserstadt Goslar, will strahlend die Menschen begrüßen,
die aus allen Richtungen mit dem Zug nach hier kommen. Auch mich, den
Spätheimkehrer aus russischer Kriegsgefangenschaft.
Der Zeiger der Bahnhofsuhr deutet auf die sechste Abendstunde, als ich
den Zug, der mich von Friedland hierher gebracht hat, verlasse. Die ersten
Schritte auf dem Bahnsteig in völliger Freiheit übermannen mich.
Nur ganz langsam gehe ich weiter, wie schwebend, schließlich die
Treppe hinauf zur Bahnhofshalle. Menschen hasten an mir vorbei. Manche
schauen mich mitleidig an, andere registrieren mich gar nicht, und wiederum
andere entbieten mir einen liebenswürdigen Gruß.
Ich nicke scheu zurück.
Die farbenfrohen Auslagen in den kleinen Geschäften im Bahnhof -
die Bundesrepublik steckt noch in den Kinderschuhen - erwecken mein stärkstes
Interesse, aber ich strebe dem Ausgang zu. Nervös suchen meine Augen
die Umgebung ab, suchen meine Eltern, die ich von Friedland aus telegrafisch
benachrichtigt habe, daß ich nach Hause komme. Ich spüre den
Schauer, der über meinen Rücken läuft, höre mein Herz
lauter als sonst schlagen, und ich fühle, wie sich Schweißperlen
mit Freudentränen vermengen. Es kommt mir so vor, als liege ein Schleier
auf meinen Augen. Die Vergangenheit, die Schmerzen beim Gehen - ich habe
viele Geschwüre an Beinen und Armen -, meine körperliche Verfassung
sind vergessen. Die Eltern nach vielen Jahren endlich wiederzusehen bläst
alles Negative hinweg.
(…)
Die an mir vorbeilaufenden
Menschen verunsichern mich immer mehr. Meine Eltern kann ich unter den
vielen Passanten nach wie vor nicht entdecken. In diese für mich
trostlose Situation steuert ein Beinamputierter sein Selbstbewegungsfahrzeug
dicht an die Stufen, die zum Eingang der Bahnhofshalle führen, und
spricht mich mit den Worten an, die ich im Leben nie mehr vergessen werde:
"Kamerad, komm, ich bringe dich nach Hause."
Er bringt mich in die Wislicenusstraße 21, in das Haus, in dem meine
Eltern und der Großvater wohnen. Zwei Kriegsramponierte an einem
kalten Winterabend, einem Vorweihnachtstag, der im Grunde nichts Außergewöhnliches
an sich hat. Für mich ist es der Tag, an dem ich zum zweiten Mal
geboren werde.
Müde und abgekämpft schleppe ich mich die zwei Etagen nach oben
zur Wohnung meiner Eltern. Mein Großvater empfängt mich mit
stummem Entsetzen. Er findet keine Worte der Begrüßung, schaut
mich nur fassungslos an, bis er nach einigem Gestotter herausbringt, daß
meine Eltern am Bahnhof auf mich warten würden.
Schweigend sitzen wir uns dann am Tisch gegenüber. Großvater
hat mich das letzte Mal gesehen, als ich zehn war und meine Sommerferien
bei ihm in Stettin verbracht habe. Jetzt bin ich 27 und habe vier Jahre
als Soldat und fünf Jahre Kriegsgefangenschaft hinter mir. Großvater
ist 80 und für sein Alter quicklebendig. Was muß ihm durch
den Kopf gehen, mich, seinen einzigen verbliebenen Enkel, in diesem Zustand
zu sehen?
Endlich, nach langen, langen Minuten des Schweigens steht er auf und nimmt
mich in seine Arme.
Ich bin Zuhause.
Dann Stimmen im Treppenflur. Bewohner aus den unteren Etagen haben meinen
Eltern schon freudig mitgeteilt, daß ich oben in der Wohnung auf
sie warte. Ich laufe ihnen, so gut ich es vermag, auf der Treppe entgegen
und bleibe auf einer Halbetage vor den Eltern stehen. Alle Schmerzen und
Strapazen, alle Schwachstellen des Körpers und des Herzens vergessend,
halte ich meine vor Glück taumelnde Mutter in den Armen. Vor sechs
Jahren habe ich sie zum letzten Mal in Magdeburg gesehen. Ein Sohn, mein
jüngerer Bruder Wolfgang, war an der Westfront gefallen. Sie befürchtete,
mich ebenfalls verloren zu haben, denn mein erstes Lebenszeichen aus der
Kriegsgefangenschaft, eine Rote-Kreuz-Karte, erhielt sie erst Weihnachten
1946, für meine Mutter eine Ewigkeit des Bangens und Hoffens. Meinen
Vater habe ich 1941 zum letzten Mal gesehen. Als Jugendlicher bin ich
damals fortgegangen, als ausgemergelter junger Mann stehe ich jetzt vor
ihnen.
Wir halten uns fest in den Armen, wollen uns nicht mehr loslassen, wollen
in diesem Augenblick alles nachholen, was der furchtbare Krieg uns verwehrt
hat. In den Freudentränen gehen alle Worte der Begrüßung
unter.
Wie sie beim Abendessen erzählen, seien meine Eltern in der Bahnhofshalle
immer auf und ab gegangen, hätten mich unter den vielen Menschen
aber nicht gesehen. Ein späterer Blick in den Spiegel - während
der Kriegsgefangenschaft habe ich nie einen Spiegel in der Hand gehabt
- läßt vermuten, daß sie mich nicht erkannt haben. Mich
dünnes Skelett, mehr vom Tode als vom Leben gezeichnet, das Gesicht
voller Geschwüre und nur die verweinten Augen sprühen das Leben
einer Jugend wieder, die durch alle Höhen und Tiefen dieser Zeit
gegangen ist, sie sind trotz allem wach und hoffnungsfroh gestimmt.
Bei Interesse am
Abdruck, senden Sie bitte den Kupon aus dem Newsletter an uns zurück.
[nach oben]
Aus: "Unvergessene Weihnachten" Band 3
[Görmar
bei Mühlhausen, Thüringen;
1943]
Das Weihnachtsgeschenk
(4061 Zeichen)
von Babette
Reineke
Wir schrieben das
Kriegsjahr 1943. Dieses Jahr hatte uns den Vater genommen, oder waren
es die Russen gewesen? Jedenfalls deckte ihn seit einigen Wochen russische
Erde zu. Mutter ging es wie so vielen in jener Zeit: Sie stand mit uns
drei unmündigen Kindern allein da. Es war für uns alle eine
traurige Zeit und trotzdem wurde es Weihnachten!
"Wir werden nur einen Tannenzweig schmücken", sagte Mamusch,
"und überhaupt wird der Weihnachtsmann kaum etwas zum Bringen
haben!"
Ich konnte das gut verstehen, denn aus der Schule wußte ich, daß
alle Güter an der Front gebraucht wurden. Mit Phantasie und bescheidenster
Zutaten gab es dennoch genug Heimlichkeiten in der Weihnachtszeit.
Es gab aber auch, besonders in den Nächten, Fliegeralarm. Dann mußten
wir unser warmes Bett mit dem kalten Kohlenkeller tauschen. Unser Kinderzimmer
stand längst schon leer, fühlten wir uns doch im elterlichen
Schlafzimmer, so nah bei Mutter, geborgener. Sie hatte Brüderleins
"Gatterbett" herübergeholt, das Baby schlummerte in seiner
Wiege und ich selbst im Ehebett auf Vaters Seite - bis Heiligabend. Eine
unerklärliche Sehnsucht nach meinem Kinderbett erfaßte mich.
Erinnerung an vergangene Weihnachten, als Pa' solch tolle Einschlafgeschichten
erzählte?
Wie dem auch sei, ich begab mich am Heiligen Abend ins Kinderzimmer und
in mein angestammtes Bett. Mit meinen elf Jahren glaubte ich zwar nicht
mehr an den Weihnachtsmann, dennoch an irgendeine kleine Freude, die der
Weihnachtsmorgen bringen würde. Man muß wissen, daß in
Thüringen erst dann Bescherung ist, und daß schon vor Tag.
Punkt 5 Uhr nämlich rufen die Glocken zur Christmette, somit haben
daheim Knecht Ruprecht oder das Christkind freie Bahn.
Nun lag ich endlich wieder in den eigenen Federn, ganz schön klamm
und kalt waren sie. Das Fußende war an einer Ecke hochgeschoben,
und die Tür stand fast immer offen. Kein Wunder, daß die Kälte
reingekrochen war! - Brrrr! - So langsam kroch sie auch in mir hoch und
ich kroch um so tiefer unter das dicke Federbett.
Horch! War da nicht eben ein verhaltenes Weinen?
Sollte es vom Schwesterchen nebenan gekommen sein?
Unmöglich für mich, es zu hören, steckte ich doch bis über
die Ohren und zusammengerollt wie ein Igel in meinem Nestchen! Nun wurde
mir schon wärmer. Wohlig streckte ich meine Füße aus,
doch wie von einer Tarantel gestochen, zog ich sie sogleich wieder zurück.
Was in aller Welt war das?
Da war etwas Warmes, Weiches gewesen und bewegt hatte es sich auch. Mir
sträubten sich die Nackenhaare!
War dies ein böser Traum?
Doch da war es wieder, dieses leise Wimmern, und es kam just vom Fußende
meines Bettes!
Vor Aufregung zitternd schlug ich die Bettdecke zurück und erblickte,
eng aneinandergeschmiegt, fünf fiepende Katzenbabys. So hilflos und
verlassen waren sie und anscheinend sehr hungrig. Mich dauerte dieser
jammervolle Anblick. Minka! schoß es mir durch den Sinn. Nur sie
konnte die Mutter der Kleinen sein! Wo steckte sie, unsere getigerte Hauskatze,
der Schrecken aller Mäuse?
Just in diesem Moment war ein leises Kratzen an der Tür zu hören
und Minkas klägliches "Miaaau". Hurtig ließ ich sie
ein: "Du weckst ja noch das ganze Haus, Minkemau! Und überhaupt,
was hast du dir dabei gedacht? Für uns alle ist das Bett nicht groß
genug!"
Minka schaute mich nur grünäugig an und sprang sofort zu ihren
Jungen aufs Bett. "Miaumaumau", machte sie und betrachtete wohlgefällig
ihre schmatzend an ihr saugenden Winzlinge. Es war schon ein erhebender
Anblick und nur die Kälte, die höchst unangenehm meine nackten
Beine mit einer Gänsehaut überzog, vermochte mich davon loszureißen.
"Na gut, weil Weihnachten ist!"
Leise schlich ich aus dem Zimmer und überließ Minka samt Nachwuchs
das Feld. Danke, Sammetpfötchen, für ein wundervolles Weihnachtsgeschenk,
wie ich es nie wieder bekommen habe!
Aus: "Unvergessene Weihnachten" Band 3
[Leipzig
- Klotzsche bei Dresden, Sachsen;
1928]
Nachricht für
den Weihnachtsmann
((2215 Zeichen)
Rosemarie Bierich
Ich war noch ein kleines Mädchen, als mich meine Eltern im Sommer mit zu einer Mehrtagestour von Leipzig nach Klotzsche bei Dresden nahmen. Dort hatten wir bei einer Freundin meiner Mutter ein gediegenes Obdach.
Eines Tages gingen
wir in der Dresdner Heide spazieren und gelangten an eine Schonung von
Fichtenbäumchen. Eine Schonung?
Für mich war das ein ganzer Trupp wunderschöner Christbäume.
"Aaahh, guckt mal, das sind ja lauter Weihnachtsbäume! Kommt
hier der Weihnachtsmann mal vorbei?"
Als ich erfuhr, daß das ganz bestimmt der Fall sei, und er von dort
die Christbäume für die Kinder abhole, fragte ich, ob ich mir
einen aussuchen dürfe.
"Warum nicht? Tu das doch!" bekam ich zur Antwort.
Kritisch schaute ich
mir die in der Nähe stehenden Bäumchen an. "Den hier! Aber
weiß der Weihnachtsmann auch, daß ich den haben will?"
"Wir heften einen Zettel mit deinem Namen an. Sicher wird er dir
den Baum dann auch bringen."
Mein Vater,
stets mit Stift und Notizpapier versehen, kritzelte irgend etwas auf einen
Zettel und heftete ihn an einen Fichtenzweig. Die Sache war erstmal erledigt.
Im Laufe des Sommers dachte keiner mehr an den Zettel für den Weihnachtsmann.
Dann war der Heiligabend
gekommen. Ich stand in der Küche und hörte den Weihnachtsmann
fortgehen - zu sehen bekam ich ihn nie, nur zu hören. Mein Vater
war bereits in der Weihnachtsstube.
Da fragte ich meine Mutter: "Steckt denn der Zettel für den
Weihnachtsmann noch an dem Baum?"
"Ich weiß nicht ... doch sicher, er wird schon noch dran sein."
Rasch ging meine Mutter in die Weihnachtsstube und erzählte meinem Vater, daß ich nach dem Zettel vom Sommer gefragt hätte. Da schrieb mein Vater in Eile einen Krakel auf ein etwas wettergeschädigtes Blatt Papier - war ja egal, ich konnte noch nicht lesen - heftete es an den bereits leuchtenden Baum und sagte: "So, das Mädel kann kommen!"
Als ich eintrat, galt
mein erster Blick dem leuchtenden Christbaum, der zweite forschte nach
dem Zettel.
"Das ist ja wirklich der richtige Baum!" rief ich erfreut aus.
"Aber ja, der Weihnachtsmann macht doch alles richtig!"
Das war tatsächlich mein Baum, und erst jetzt war es für mich
auch das richtige Weihnachtsfest.
Aus: "Unvergessene Weihnachten" Band 3
[Küllstedt,
Eichsfeld, Thüringen;
1926]
Meine Rosa
(2805 Zeichen)
Editha Feuser
Weihnachten wurde in meiner Kindheit im Eßzimmer gefeiert, das wir sonst nur benutzten, wenn wir Besuch bekamen. Der Eßtisch, der in der Mitte des Zimmers stand, wurde ausgezogen, so daß das Christkind, an das ich mit elf Jahren noch glaubte, Platz für die Geschenke hatte. Der Tisch war festlich gedeckt mit Tellern voller Süßigkeiten, jedoch weitaus bescheidener, als es heutzutage üblich ist. Jedes Teil war akkurat nebeneinander platziert, obenauf lagen die bunten Fondantkringel, die wir Kinder so sehr liebten. Die Geschenke, die das Christkind bescherte, waren vor allem Kleidungsstücke oder später Dinge für die Schule, was man eben so brauchte.
Wenn das Christkind klingelte, mußten wir Kinder erst ellenlange Gedichte vor dem Weihnachtsbaum stehend vortragen und eine unendlich lange Reihe Lieder singen. Dabei versuchten wir, heimlich auf den Gabentisch zu schielen; denn das Christkind brachte für jeden auch ein Spielzeug. Ich wußte, daß jedes Jahr eine liebe Tante, eine Schwester meiner verstorbenen Mutter, eines für mich "bestellt" hatte.
An jenem Weihnachtsfest war meine Freude besonders groß. Bei der Bescherung glaubte ich zu träumen: An meinem Platz saß eine wunderhübsche, große Puppe. Bisher hatte nur meine jüngere Schwester Irmgard Puppen bekommen. Ich durfte zwar auch damit spielen, aber nur zusammen mit meiner Schwester, hieß es, das war nicht dasselbe. Diese Puppe hier gehörte mir ganz allein. Überglücklich schloß ich sie in die Arme. Die Puppe hatte einen wunderschönen Porzellankopf mit großen Schlafaugen und gutriechenden, echten Haaren, und sie trug ein rosarotes Organdykleidchen. Und so nannte ich sie "Rosa".
Am liebsten wollte
ich meine Rosa gar nicht mehr loslassen. Abends nahm ich sie mit in mein
Zimmer und setzte sie neben mein Bett auf den Nachttisch.
Doch eines Nachts - oh Schreck! - fiel Rosa hinunter, und der schöne
Porzellankopf wurde beschädigt. Ich war untröstlich. Aus Angst
vor meinen Eltern versteckte ich die Puppe ganz unten in meinem Kleiderschrank.
Vergessen konnte ich Rosa aber mein ganzes Leben nicht, so sehr hatte
ich um sie getrauert. Sie war die einzige Puppe, die ich je geschenkt
bekam.
Als Puppenfan besitze
ich heute mehrere schöne Exemplare. Vor zehn Jahren, als ich 75 Jahre
alt wurde, erlebte ich ein kleines Wunder: Auf einer Puppenbörse
entdeckte ich sie: genau dasselbe hübsche Bubiköpfchen wie damals
meine geliebte Rosa! Nur trug diese Puppe ein weißes Kleidchen mit
schöner Stickerei.
Auf meine Frage, wie alt die Puppe sei, sagte mir der Verkäufer,
sie stamme wahrscheinlich aus dem Jahre 1921. Später erfuhr ich‚
daß es eine Armand-Marseille-Puppe ist.
Seitdem sitzt diese Puppe auf meiner Couch, und ich liebe sie genauso,
wie ich als Kind meine Rosa geliebt hatte.
Bei Interesse am
Abdruck, senden Sie bitte den Kupon aus dem Newsletter an uns zurück.
Aus: "Unvergessene Weihnachten" Band 3
[Venzka,
zu Hirschberg/Saale, Thüringen;
1945]
Meine erste Friedensweihnacht
(2267 Zeichen)
Elisabeth Schmack
Weihnachten 1945 fand
nicht mehr zu Hause in Oberschlesien statt. Mutter und wir drei Geschwister
waren nach langer Odyssee in dem kleinen Dorf Venzka an der Saale gelandet.
Der Ort war mit Flüchtlingen überfüllt. Wir kamen in der
ausgeräumten Kleiderkammer der Feuerwehr unter. Zwei Betten und ein
kleiner eiserner Ofen waren das gesamte Inventar; mehr hätte da auch
nicht reingepaßt.
Dankbar, daß wir endlich ein Dach über'm Kopf hatten, richteten
wir uns ein so gut es eben ging. Aus dem nahen Wald hatten wir Holz gesammelt
und Fichtenzweige mitgebracht. Mutter legte in die verlöschende Glut
hin und wieder einen grünen Zweig auf. Es knisterte so schön
und duftete ganz weihnachtlich.
Eigentlich wollte ich erzählen, was mir am Vormittag beim Kaufmann
passierte. Da waren drei Frauen, die flüsterten, aber so, daß
ich es hören sollte: Polackengesindel, sollen sich hinscheren, wo
sie herkamen. Doch ich hielt mich zurück. Ich mochte unsere karge
Gemütlichkeit nicht stören.
Wir erzählten von "damals", das eigentlich erst einige
Monate zurücklag. Wir fragten uns, wo jetzt wohl unser Vater sein
mochte, der noch zum Volkssturm eingezogen worden war. Seitdem waren wir
ohne Nachricht von ihm. Die Stimmung wurde zusehends trauriger. Die Mutter
faßte sich zuerst und summte ein Weihnachtslied, bald sangen wir
leise mit.
Plötzlich ein Poltern!
Die Haustür, die nicht mehr zu verschließen war, schlug gegen
die Wand. Hastig sprang die Mutter auf und drehte den großen Schlüssel
im rostigen Kastenschloß. Die Türklinke senkte sich und blieb
unten. Dann hörte man Schritte sich entfernen.
Lange saßen wir ängstlich zusammen, bis der kleine Bruder es
nicht mehr aushielt: "Ich muß mal …"
Und das Klo war hinterm Haus. Im Dunkeln gingen wir nur gemeinsam dorthin.
Vorsichtig schloß Mutter die Tür auf. Da krachte etwas und
die Klinke schnappte hoch. Vor der Tür lag ein Bündel. Zum Vorschein
kam Kleidung, getragen aber sauber, und eine kleine Blechschüssel
mit Weihnachtsgebäck. Ein Zettel lag bei, der mit ungelenker Handschrift
"Frohe Weihnacht" wünschte. Wir fühlten eine Wärme,
die kein Ofen geben kann. Und ich war froh, mein Erlebnis vom Vormittag
für mich behalten zu haben.
Bei Interesse am Abdruck, senden Sie bitte den Kupon aus dem Newsletter an uns zurück.
Aus "Unvergessene Weihnachten" Band 2
Magdeburg/Elbe
-Eilsleben und Wanzleben
in der Magdeburger Börde, Sachsen-Anhalt;
1947]
Die Weihnachtsgans
im Rucksack (5.415 Zeichen)
Annemarie
Sondermann
Hunger! Ja, er tut
weh! - Wir hatten ihn kennengelernt im Winter 1946/47 als Ost-flüchtlinge
im bombenzerstörten Magdeburg. Wir, das waren wir fünf Geschwister
im Alter von 11 bis 18 Jahren und unsere Mutter. Nein, eigentlich wir
fünf alleine, denn unserer Mutter hatte all das Leid des Krieges
das Gemüt krank gemacht. Auch die Kälte dieses Winters war schrecklich
gewesen: eisige Temperaturen noch bis in den März hinein, dabei kaum
etwas zum Heizen, Stromsperren. Die Kälte hat es leicht, in einen
Hungrigen hineinzukriechen. - Also, solch einen Winter wollten wir nicht
noch einmal erleben.
Wir stoppelten, soweit es unsere Schulzeit erlaubte, im Sommer 1947 alles,
was wir auf den Feldern finden konnten. Das große Los aber zog unser
ältester Bruder: Ernteeinsatz bei Bauer Arendt in Eilsleben in der
Börde. Satt und richtig rund kam er nach Hause zurück, und das
Beste für uns alle: Zu Weihnachten sollte er noch ein besonderes
"Deputat" für die ganze Familie bekommen. Dieses Wort hatte
ich noch nie gehört, aber seitdem nicht vergessen.
Es war zwei Tage vor Weihnachten. Ich war dazu auserkoren worden, das
Deputat in Eilsleben abzuholen. Die rührende Bäuerin packte
meinen Rucksack voll: Kartoffeln, selbstausgepreßtes Rapsöl,
eine Blut- und eine Leberwurst, Streuselkuchen - ich weiß es noch
genau - und als Clou eine Gans, eine Weihnachtsgans für unsere Familie.
"Komm, da hast du noch einen Rotkohl, der gehört doch zu einem
Gänsebraten dazu!"
Ich war selig.
"Vielleicht sollte ich dir zur Sicherheit eine Deputatsbescheinigung
mitgeben."
"Wo-zu das?"
"Sicher ist sicher", meinte sie.
Der Zug zurück nach Magdeburg war voll. Die Menschen standen dichtgedrängt,
auch auf den Trittbrettern, fast alle mit Rucksäcken. Viele hatten
versucht, für Weihnachten noch irgendeine Habseligkeit gegen etwas
Eßbares auf dem Land einzutauschen.
Beim Halt in Wanzleben hörten wir plötzlich laute Rufe:
"Alle aussteigen! R a z z i a !"
Blauuniformierte Volkspolizisten trieben uns als Kolonne in den Wartesaal.
Die Tür wurde hinter uns abgeschlossen, die Fenster waren nicht zu
öffnen.
Unheimliche Stille zunächst. Keiner empörte sich. Die Menschen
waren durch Krieg und Nachkriegszeit Unbilden, auch Schikanen gewohnt.
Rechts hinten wurde eine Tür zu einem Nebenraum geöffnet, die
zwei ersten von uns hineinbeordert, nach einer Weile die nächsten
und so fort. Allmählich sickerte durch: "Sie nehmen uns alles!"
Was dann begann? Kein Aufschrei, keine Empörung: Warum? Was machen
sie mit unseren Sachen?
Es begann - das große Fressen. Würste, Speck, auch einfach
trockenes Brot, alles wurde hineingestopft. Wenigstens sich selbst einmal
sattessen, bevor sie uns alles wegnehmen. Eingeprägt hat sich mir
besonders das Bild, wie zwei Männer aus einer großen Blechdose
Salzheringe, immer einen nach dem anderen, am Schwanz ergriffen und kopfunter
in ihrem Mund verschwinden ließen. Salzheringe, wie sie früher
waren, in richtiger Salzlake!
Und ich? Ich hockte einfach todunglücklich in einer Ecke. Zu essen
von meinen Köstlichkeiten, das bekam ich nicht fertig. Die Deputatsbescheinigung,
ach, ich hoffte noch immer. Natürlich habe ich auch gebetet, ich
war ein gläubiges Kind.
Der Saal leerte sich. Ich meine, ich wäre überhaupt die letzte
gewesen, die in den Nebenraum befohlen wurde, zusammen mit einem Mann,
mit Rucksack natürlich wie ich. An drei Vopos erinnere ich mich,
einen für jeden
"Delinquenten" und eine Polizistin, am Tisch sitzend, die die
abgenommenen Gegenstände registrierte. Andere Uniformierte gingen
hin und her, um die beschlagnahmten Weihnachtsmitbring-sel abzutransportieren.
Ich zeigte meine Bescheinigung und versuchte zu erklären. Aber "mein"
Polizist hörte irgendwie nicht richtig zu. Jetzt merkte ich: Er schaut
zu seinem Kollegen und zu meinem "Mitgefangenen". Dort war ein
Handgemenge entstanden. Der Rucksack des Mannes war ganz mit Zucker gefüllt.
Natürlich sollte er ihn hergeben, aber er wehrte sich, überkreuzte
die Arme, der Vopo konnte die Träger nicht abstreifen. Blitzschnell
eilte mein Kontrolleur zu Hilfe. Zu zweit schafften sie es, den sich Wehrenden
auf den Boden zu werfen, seine Arme auseinanderzudrücken, einer kniete
sich auf seine Handgelenke ...
Das alles ging über meine Gemütskräfte. Die Tränen
flossen, ich weinte bitterlich. - Und da?
Die Polizistin gab mir einen Wink, ich sollte den Raum verlassen - nicht
in Richtung Wartesaal, nein, nach draußen! Den Rucksack hatte ich
noch auf dem Rücken. Ich war die einzige, die bei dieser Massenrazzia
all ihr Schätze behalten konnte.
Der Schluß ist schnell erzählt. Unser Zug war natürlich
längst weg, auch kein anderer fuhr mehr an diesem Tag nach Magdeburg.
Aber vom nächsten Ort, Blumen-berg, fünf Kilometer entfernt,
würde noch einer fahren. So schritt ich mit schwerem Rucksack, aber
leichtem Herzen im Stockdunklen den Bahndamm entlang und erreichte am
späten Abend noch meine Geschwister, die sich bereits Sorgen gemacht
hatten.
Natürlich wurde es ein köstliches Weihnachtsessen: Gänsebraten
mit Rotkohl und richtigen Schälkartoffeln!
Ein wenig getrübt wurde der Genuß nur dadurch, daß unsere
Mutter gequält wurde von dem Gedanken, was die anderen hungernden
Flüchtlinge im Haus wohl von uns denken würden, wenn sie den
Bratenduft riechen. Aber wo gibt es auf der Welt vollkommenes Glück?
Bei Interesse am Abdruck, senden Sie bitte den Kupon aus dem Newsletter an uns zurück.
Aus "Unvergessene Weihnachten" Band 2
Rinteln/Weser,
Kreis Schaumburg, Niedersachsen;
kurz vor Heiligabend 1988]
Alle Jahre wieder - dieser verflixte Weihnachtsbaumkauf (6.345
Zeichen) Romano
C. Failutti
So sicher es jedes
Jahr Weihnachten wird, so sicher gibt es zwischen meiner Angetrauten und
mir um diese Zeit "Theater". Die "Aufführung"
findet nicht einmal in unseren vier Wänden statt, sondern sie findet
dort nur ihre Fortsetzung und ihr Ende. Sonst aber bevorzugen wir die
wieder modern gewordene Form der Straßenbühne, und da ziehen
wir beide als Akteure sämtliche Register unseres schauspielerischen
Könnens.
Irgendwann vor dem Heiligen Abend erinnert mich meine Marianne: "Langsam
müssen wir uns mal um einen Weihnachtsbaum kümmern."
Und jedesmal habe ich natürlich auch längst daran gedacht, nur
nicht davon ge-sprochen. Aber es gibt ja sowieso kein Entkommen vor diesem
schönen Brauch! Sie denkt ja daran und sie spricht sowieso aus, was
getan werden muß.
Irgendwann, lampenfiebergeschüttelt, machen wir uns gemeinsam auf
den Weg. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir nehmen uns zwar jedesmal
vor, in der Wahl unserer Ausdrucksmittel sparsam zu sein, auf große
Gestik und starke Worte zu verzichten, denn in der Beschränkung erweist
sich der Meister, aber es kommt doch wieder so, wie es kommen muß
- bei uns.
Vorsichtig und erwartungsvoll taxiert uns der Weihnachtsbaumverkäufer,
als wir uns in seinen Bannkreis begeben. Noch sind wir Interessenten wie
alle anderen. Er ahnt nicht, was auf ihn zukommt. Heimliches Bedauern
für den Mann erfaßt mich. Er muß mitspielen und er weiß
es noch nicht!
In vielen Ehejahren habe ich gelernt, mich zurückzuhalten, meiner
Frau den großen Part zu überlassen, die sich hochgestimmt mit
mir auf den Weg machte, nun diesen und jenen Baum ins Auge faßt
und deren Antlitz jede ihrer Regungen widerspiegelt. Warnzeichen Nummer
eins: Sie schiebt die Unterlippe sehr weit vor! Also: Die Naturgewachsenen
finden vor ihr keine Gnade. Der eine ist ihr zu klein, der andere zu groß,
der hat zwei Spitzen, der ist ja jetzt schon braun statt grün, der
ist zu kahl, der zu voll, der zu ausladend, der ist nicht rundherum gleichmäßig
gewachsen, sondern schlägt nur nach einer Seite aus, also vorne nichts
und hinten zu viel. O-der, wenn man ihn umdreht, hinten nichts und vorne
zuviel!
Mein Argument, wenn man ihn doch sowieso in eine Ecke stellt, dann paßt
er doch mit der Seite, wo die Äste kürzer sind, gut hinein,
wird rigoros als Blödsinn be-zeichnet und zur Seite gewischt. Der
da hinten, der ...
"Der ist doch viel zu teuer!", rufe ich verschreckt beim Blick
auf den Preis.
"Ist ja auch 'ne Edeltanne!"
"Schön soll er schon aussehen, aber nicht für so viel Geld!
Da mache ich nicht mit! Er steht doch nur zwei, drei Wochen", erkläre
ich.
Marianne quält ihre Unterlippe mit den Zähnen. Warnzeichen Nummer
zwei!
"Es ist ja nur einmal im Jahr Weihnachten", zischt sie.
"Aber du mußt doch einsehen, daß das Fantasiepreise sind,
die da verlangt werden. Der da, der ist doch auch sehr schön",
weise ich unbestimmt in die preisgünstigere Richtung.
"Welcher?" - Schnell hebe ich irgendeinen an.
"Diese Krücke!" schallt ihre Stimme über unseren bezaubernden
Marktplatz, dem viele schöne alte Häuser sein romantisches Gepräge
geben - und der Baumverkäufer blickt betreten.
"Nee, der nicht", gebe ich schnell zu und lasse ihn in seine
Reihe zurückgleiten wie eine heiße Kartoffel in den Topf. "Da
hast du wirklich recht."
Es war tatsächlich kein guter Griff.
Der Mann will uns wohl schnell loswerden. Unsere Kritik könnte sein
Geschäft schädigen. Jetzt macht er Vorschläge. Er stapft
vor uns her und stellt uns Bäume hin, die er aus seinem Angebot herausgreift.
"Nein", sagt sie. - "Ach nee", sage ich.
"Der! Aber der ist doch bildschön!" sagt der Mann.
Ihr Hohnlachen gellt über den Platz, verliert sich in den stimmungsvollen
Gassen unseres Weserstädtchens.
"Der sieht ja aus, als hätte er die Räude!"
Der Baumverkäufer zieht den Kopf zwischen die Schultern, zuckt die
Achseln.
"Sei doch nicht so drastisch", bitte ich. "Er kann doch
auch nicht dafür. Natur ist eben mal Natur."
Mir tut der Handelsmann leid, aber in Mariannes Kopf sind nun mal gewisse
Vorstellungen und da steckt auch noch der Spruch ihrer Oma, einer Ur-Berlinerin,
drin: ‚Für mein Jeld, da kann ick den Deibel tanzen lassen!'
Jetzt fische ich ein Gewächs heraus: "Wie wär's mit dem?
Der geht doch! Und langsam müssen wir uns auch mal entscheiden."
Sie guckt und nagt und nagt an ihrer Unterlippe und guckt. Gleich wird
die Unterlippe zu bluten anfangen. Warnzeichen Nummer drei - und was kommt
danach?
Ein Herr umschleicht uns, wirft begehrliche Blicke auf den "Besen",
wie sie verspottet, was ich ihr da vorhalte.
"Was soll der kosten?", fragt der Herr den Verkäufer.
"Zweiundzwanzig Mark", ist die Antwort.
"Nehme ich", sagt der Herr kurz und knapp.
"Den nehmen wir! Den hat mein Mann doch schon in der Hand!"
Besitzergreifend und unmißverständlich legt meine Frau auch
die ihre an den Stamm.
Enttäuscht wendet sich der Herr anderen Objekten zu. Er scheint wirklich
ein Herr zu sein, der sich niemals mit einer Dame um etwas zanken oder
gar mit ihr um einen "Besen" kämpfen würde. "Würde"
fällt mir in diesem Augenblick ganz plötzlich dazu ein.
Sichtlich erleichtert packt der Verkäufer uns den Baum ins Netz,
entfernt wunschgemäß einige Äste vom unteren Stamm, damit
wir ihn zu Hause mühelos in die "Hutsche" praktizieren
können.
In den folgenden Tagen fragen wir uns, wie unser Bäumchen wohl in
unserem Weihnachtszimmer wirken wird. Ganz zufrieden ist Marianne doch
nicht. "Das ist doch wieder nur so ein Festgestrüpp", sagt
sie.
Aber am Heiligen Abend steht der Weihnachtsbaum geschmückt in unserer
Mitte, und er strahlt, verbreitet festliche Stimmung und ist wunderschön.
"Was haben wir doch für einen herrlichen Baum", flüstert
sie ergriffen und ich nicke still: "Ja. Wie jedes Jahr."
Und die Tochter pflichtet bei: "Ich weiß gar nicht, was ihr
immer für einen Hermann mit dem Baum macht. Der ist doch echt geil,
wie immer."
Für diese Wortwahl möchte ich ihr zwar am liebsten ... na ja
... Aber der Lichter-glanz stimmt mich milde.
Als Marianne am ersten Feiertag in der Küche herumklappert und ich
mich unbeobachtet und nicht abgehört fühle, rufe ich Siggi an.
Siggi ist ein Arbeitskollege von mir.
"Frohe Weihnachten", wünsche ich ihm. "Und vielen
Dank, Siggi, daß du den Herrn gespielt hast, der unseren Baum haben
wollte, neulich auf dem Marktplatz. Sonst stünden wir möglicherweise
heute noch dort."
Bei Interesse am Abdruck, senden Sie bitte den Kupon aus dem Newsletter an uns zurück.
Aus "Unvergessene Weihnachten" Band 3
Berlin-Zehlendorf;
5. Dezember 1945]
Unheimlich groß
und dünn - mein Vati! (4.000 Zeichen)
Renate Dziemba
Es wurde schon dunkel
an diesem Nachmittag des 5. Dezember 1945. Ich war allein zu Hause. Zu
Hause?
Unsere Wohnung war gleich nach Kriegsende von den Amerikanern beschlagnahmt
worden, Mutti und ich mußten sie innerhalb weniger Stunden verlassen.
Wir besaßen fast nichts mehr. In ein winziges Zimmer wurden wir
einquartiert. Hier wohnten wir jetzt schon fast ein halbes Jahr. Im Vergleich
zu anderen Familien hatten wir großes Glück: Unsere Wirtin,
die uns das Zimmer hatte abgeben müssen, war freundlich, sauber und
hilfsbereit. So half sie uns zum Beispiel, zwei Luftschutzbetten, die
sich noch im Keller befanden, übereinander aufzustellen. Wir hätten
sonst auf der Erde schlafen müssen.
In dem viel zu engen Zimmer konnte man kaum treten. Gleich rechts neben
der Tür war der Ofen. Daneben stand ein Klavier, das nur Platz wegnahm
und von niemandem benutzt wurde. Die ganze linke Wandseite nahmen die
Luftschutzbetten ein. Vor dem Fenster war gerade noch Platz für einen
riesigen Schreibtisch und einen Ledersessel.
Ich saß in dem viel zu großen Sessel an dem viel zu großen
Schreibtisch und machte meine Hausaufgaben. Joachim, der zwei Jahre ältere
Sohn der Wirtin, war schon damit fertig und spielte mit anderen Kindern
draußen im Gang vor den Häusern. Sie spielten wohl Verstecken.
Das machte in der Dunkelheit besonders viel Spaß. Ab und an sah
ich einzelne Gestalten den Gang entlanghuschen. Wo Mutti wohl so lange
bleibt? Sie wollte doch nur zum Einkaufen in die Berliner Straße.
Ob sie noch bis zum Teltower Damm gegangen ist? Oder hat sie vielleicht
Bekannte getroffen?
In diesem Augenblick klingelte es. Ich hatte ein bißchen Angst.
Wer konnte das sein? Mutti nimmt doch immer ihre Schlüssel mit. Da
hörte ich Joachims Stimme: "Renate, mach mal auf, dein Vati
ist da!"
Das wollte ich nun gar nicht glauben. Ich wußte von Mutti, daß
er in einem Kriegsgefangenenlager war.
Ganz leise schlich ich zur Wohnungstür. Vorsichtig hob ich die Briefklappe
hoch. Ich sah nur Beine. Da bückte sich Joachim auf der anderen Seite
der Tür, so daß ich sein Gesicht sehen konnte, und wiederholte
noch einmal: "Mach doch endlich auf, dein Vati ist da!"
Wenn doch bloß Mutti da wäre! Zögernd öffnete ich
die Tür. Vor mir stand ein Soldat mit einem Holzkoffer in der Hand
und einem Rucksack auf dem Rücken. Was ich sah, konnte ich nicht
begreifen ... Zwar erkannte ich meinen Vati noch, und er sag-te auch meinen
Namen, aber er wirkte recht fremd auf mich. Er war so unheimlich groß
und so unheimlich dünn. Und dann fiel mir ein, daß wir in dem
kleinen Zimmer, das für Mutti und mich schon zu eng war, überhaupt
keinen Platz für ihn hatten.
"Mutti ist nicht da ...," waren meine ersten Worte.
Aber plötzlich begriff ich, daß da mein Vati vor mir stand,
mein Vati, auf den ich so lange gewartet hatte. Ich umarmte ihn stürmisch
und zog ihn in das kleine Zimmer. "Schau mal, Vati, ich kann schon
schreiben und rechnen!"
Mit diesen Worten zeigte ich ihm meine Schulhefte, die noch immer auf
dem Schreibtisch lagen. Er nahm mich hoch und drückte mich fest an
sich.
In diesem Moment riß Mutti die Tür auf. Sie war völlig
außer Atem und lachte und weinte und weinte und lachte. Im Milchladen
hatte man ihr erzählt, daß in der Drogerie am S-Bahnhof ein
Soldat nach einer Familie mit unserem Namen gefragt hatte. Dort lagen
auch Listen mit den neuen Adressen der ausquartierten Familien aus. So
hatte Vati uns gefunden. Was für ein Glück! Er war erst am 3.
Dezember aus dem amerikanischen Kriegsgefangenenlager Heilbronn entlassen
worden. Mutti war den ganzen Weg vom Milchladen zurück nach Hause
gerannt. Sie war so glücklich. Jetzt waren wir wieder eine richtige
Familie!
Noch am Abend räumten wir mit Hilfe der Wirtin das Klavier aus dem
Zimmer, stattdessen kam eine Chaiselongue an den Platz. Darauf schlief
von nun an Mutti und mein Vati kletterte zum Schlafen auf das obere Luftschutzbett.
Den 5. Dezember haben meine Eltern von da an immer als Gedenktag gefeiert
und sich gegenseitig mit kleinen Geschenken überrascht.
Bei Interesse am Abdruck, senden Sie bitte den Kupon aus dem Newsletter an uns zurück.
Aus
"Unvergessene Weihnachten" Band 1
Oberholz
bei Much, Rhein-Sieg-Kreis im Bergischen Land;
Dezember 1945]
Später Besuch
(5.190 Zeichen)
Eckhard Müller
Es war Anfang Dezember
1945. Der Zweite Weltkrieg hatte sein Ende gefunden. Seit einem halben
Jahr schwiegen die Waffen. Wir erwarteten das erste friedliche Weihnachtsfest
seit sechs Jahren.
Das Leben hatte sich zunehmend normalisiert. Obwohl die Menschen in unserer
ländlichen Gegend nicht in so hohem Maße unter dem Bombenterror
zu leiden brauchten wie die Menschen in den Städten, war auch hier
der Kriegsschrecken nicht spurlos vorübergegangen. Nun hieß
es, zusammenrücken, denn der Strom von Flüchtlingen und Obdachlosen
aus den Ostgebieten und aus den Großstädten hielt an. Wer noch
ein Zimmer oder eine Kammer in seinem Hause zur Verfügung stellen
konnte, nahm eine Flüchtlingsfamilie bei sich auf. Es gab eine für
heutige Verhältnisse unvorstellbare Solidarität. Das wenige,
das man selber noch besaß, wurde geteilt mit denen, die alles verloren
hatten.
Unser kleines Fachwerkhaus, das ich mit meinen Eltern und mit meiner Großmutter
bewohnte, teilten wir seit den letzten Kriegstagen mit einem älteren
Ehepaar. Es waren entfernte Verwandte, und sie hatten in einer Bombennacht
ihre ganze Habe verloren. Nun waren sie froh, bei uns wenigstens wieder
ein Dach über dem Kopf gefunden zu haben.
Die Militärregierung der Siegermächte hatte die zivile Verwaltung
in ihre Hand genommen und somit Gesetz und Ordnung wiederhergestellt.
Trotzdem waren die Zeiten noch sehr unruhig. Immer wieder machten umherstreunende
Banden von sich reden. Es entstanden die wildesten Gerüchte. Man
hörte von Greueltaten - auch aus einigen Dörfern in unserer
Gemeinde. Denn der Schutz des Gesetzes war noch nicht überall gewährleistet.
Diese umherziehenden Gruppen setzten sich zum großen Teil aus ehemaligen
Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern aus Osteuropa zusammen. Nach Wiedererlangung
ihrer Freiheit waren viele von ihnen nicht mehr gewillt oder in der Lage,
in ihre Heimat zurückzukehren. Was man ihnen nicht freiwillig gab,
nahmen sie sich mit Gewalt. Dabei kam es auch verschiedentlich zu Übergriffen
und Racheakten gegenüber ihren früheren Unterdrückern.
Nach Einbruch der Dunkelheit war es rat-sam, Fenster und Türen gut
zu verschließen. Wer draußen noch irgendeine Arbeit zu verrichten
hatte, trug Sorge, sich nicht allzuweit von den schützenden Häusern
zu entfernen.
Es war an einem solchen Abend in der Vorweihnachtszeit, ich glaube, es
war am Abend des zweiten Advent. Meine Eltern waren eben mit der Stallarbeit
fertiggeworden und wir schickten uns an, das Abendbrot zu essen, als plötzlich
an unsere Haustür geklopft wurde. Mein Vater begab sich nach draußen,
um nachzuschauen. Neugierig gesellte ich mich zu ihm. Ich war damals neun
Jahre alt.
Da stand in der Dunkelheit ein gutes halbes Dutzend Männer. In gebrochenem
Deutsch baten sie um ein Quartier für die Nacht.
Zögernd ließ mein Vater sie eintreten. Nachdem sie in unserer
Wohnstube Platz genommen hatten, konnten wir sie im Scheine der Lampe
näher betrachten. Sehr vertrauenerweckend sahen sie nicht aus. Das
Leben auf der Landstraße hatte sie gezeichnet.
Während meine Mutter das Abendbrot zubereitete, versuchte mein Vater
etwas über das Schicksal der Männer zu erfahren. Nach der einfachen,
mit wenigen Mitteln zubereiteten, aber kräftigen Mahlzeit wurde beratschlagt,
wie und wo man die Männer für die Nacht unterbringen könnte.
Im Hause selber war es, nicht zuletzt durch unsere Verwandten als neue
Mitbewohner, ziemlich eng geworden. Also blieb nur noch die Scheune. Im
Scheunenanbau befand sich der Holzschuppen, dort lagerte auch das Heu
als Wintervorrat für unsere beiden Kühe. Hier im Heu richteten
nun meine Eltern mit allerlei Decken und alten Mänteln ein warmes
und bequemes Nachtlager her. Unsere alte Petroleumlam-pe sorgte für
die nötige Helligkeit.
Kurz vor Schlafenszeit entschloß sich mein Vater zu einem "Kontrollgang",
wie er sich ausdrückte. Es ließ ihm nämlich keine Ruhe,
ob sich unsere Gäste auch an die Abmachung gehalten hatten, wegen
der großen Brandgefahr auf das Rauchen zu verzichten. Meine Mutter
bat mich mitzugehen. Im Beisein eines Kindes - so meinte sie - wäre
mein Vater sicherer vor eventuellen Übergriffen.
Als wir den Holzschuppen betraten, bot sich uns im Schein der Laterne
ein Bild, das ich bis heute nicht vergessen habe: Da hatte sich ein Teil
der Männer unserer Sä-gen bemächtigt und sie schnitten
nun die schweren Stämme, die hier als Brennholz lagerten, in Ofenlänge
durch. Die anderen spalteten die klobigen Klötze mit dem Beil zu
handlichen Scheiten und stapelten sie auf. Das alles bereitete ihnen ein
sichtliches Vergnügen, umso mehr, als sie nun unsere ungläubigen
und erstaunten Blicke sahen. Sie erklärten, das sei nur ein kleiner
Dank für die freundliche Aufnahme.
Am anderen Morgen sind sie dann nach einem guten Frühstück -
nicht ohne ein großes Butterbrotpaket, das jeder von ihnen zum Abschied
in die Hand gedrückt bekam - weitergezogen, einer ungewissen Zukunft
entgegen.
Viele Jahre sind seitdem ins Land gegangen, doch immer wieder muß
ich an jenen Dezemberabend denken, an dem die Angst, die Voreingenommenheit
und das Mißtrauen besiegt wurden durch ein wenig Menschenfreundlichkeit.
Bei Interesse am Abdruck, senden Sie bitte den Kupon aus dem Newsletter an uns zurück.
Aus "Unvergessene Weihnachten" Band 1
Flüchtlingslager
"Finnenhäuser"
zwischen Hüpede und Bennigsen bei Hannover;
1949
Die Schüssel
auf dem Schrank (2.656 Zeichen)
Klaus Seiler
Pfefferkuchen-Backzeit.
Der Pfefferkuchen mußte ja rechtzeitig gebacken werden, damit die
harten Plätzchen zu Weihnachten weich waren und ihr volles wunderbares
Aroma entfalteten. Diese unvergleichlichen Pfefferkuchen meiner Mutter!
Warum bloß hat sie das Rezept nie herausgerückt?
Sie hat es einfach mitgenommen. Manchmal denke ich, es gab gar kein geschriebe-nes
Rezept, sie hatte es in den Händen - und es stimmte immer!
Der braune Teig war Knetarbeit: eine Mischung aus Mehl, Kunsthonig, erhitztem
Sirup und anderen Zutaten und vor allem aus "Haima-Neunerlei",
der geheimnisvol-len Gewürzmischung aus dem silbrigen Tütchen.
Es lag ein betörender Duft im Raum, wenn meine Mutter den Teig zubereitete.
Der Teig wurde lange gewalkt, geknetet und zur Kugel geformt, bis schließlich
für ihn eine Zeit des Ausruhens kam. In eine Blechschüssel gelegt,
mit einem karierten Tuch bedeckt, in sicherem Abstand auf den Schrank
gestellt. Da konnte er in Ruhe gehen.
Normalerweise jedenfalls. Nicht jedoch in dem einen Jahr. Es war wieder
ein Junge zum Spielen gekommen. Meine Schwester weiß noch seinen
Namen: Armin. Abgelenktes, halbherziges Spielen der Kinder in dieser Pfefferkuchen-Luft.
Die Gewürze in der Nase, die Blicke immer wieder auf den Tisch gerichtet,
auf dem das Mehl zum Ausrollen des Teigs schon ausgestreut war, die leicht
verbogenen, genieteten Pfef-ferkuchenformen zum Greifen nah.
Nach der Ruhezeit für den Teig konnte endlich das Ausstechen beginnen.
Tannen-bäumchen, Engel, Herzen, Pilze, Karos ... Mein Vater verstand
es außerdem, mit dem Messer breitbeinige Weihnachtsmänner auszuschneiden
und ihren Mantel mit Wallnußknöpfen und das Gesicht mit Haselnußaugen
zu verzieren. Sie überstanden jedoch nur in seltenen Fällen
die Backhitze, kamen meistens ziemlich arm- und beinverletzt aus dem Ofen.
Es paßte in die Zeit.
Meine Mutter langt nach der abgelaufenen Zeit auf den Schrank, zieht das
Tuch weg - die Schüssel ist leer!
Armin ist inzwischen verschwunden. Irgendwie unbemerkt. Er muß den
Teig regel-recht in sich hineingestopft und verschlungen haben!
Wir haben sein Tun nicht bemerkt. Er muß dazu doch immer wieder
aufgestanden, ja auf einen Stuhl gestiegen sein, so klein wie er war.
Wir haben es nicht gesehen oder wollten es einfach nicht sehen. Er muß
so ausgehungert gewesen sein. Irgend etwas muß uns blind gemacht
haben ...
Wie es wohl der Kugel in seinem Bauch ergangen ist?
Sie war doch noch dabei zu gehen ...
Wir jedenfalls brauchten schnell einen neuen Backtag und dringend ein
neues Tütchen "Haima-Neunerlei" ...
Bei Interesse am Abdruck, senden Sie bitte den Kupon aus dem Newsletter an uns zurück.
Aus "Unvergessene Weihnachten" Band 1
Mühlhausen,
Thüringen, damals DDR;
Ende der 50er Jahre
Warten auf das
Christkind (7.000 Zeichen)
Elisabeth Schmack
Es war Ende der fünfziger
Jahre. Ich hatte das Schwesternexamen bestanden und glaubte voll jugendlicher
Arroganz, nun alles zu wissen, was man in der täglichen Arbeit auf
Station benötigte. Doch Theorie und Praxis ...
Irgendwie konnte ich beides nicht in Einklang bringen. Ich wurde immer
unsicherer. Zweifel kamen mir, ob es der richtige Beruf für mich
sei. Dabei war es einmal mein größter Wunsch gewesen, Schwester
zu werden. Was mir am meisten zu schaffen machte, war Verantwortung zu
tragen, wenn ich den Spät- oder Nachtdienst allein durchstehen sollte.
Ich scheute mich, darüber zu sprechen. Niemand schien zu be-merken,
wie mich die Unsicherheit quälte.
Inzwischen waren einige Wochen nach meiner Fachschulzeit vergangen. Ich
arbei-tete auf der Privatstation des Chefarztes unseres Kreiskrankenhauses.
Er war streng zu dem Personal, was meine Unsicherheit vielleicht noch
nährte. Ich hatte mich wahrlich nicht darum gerissen, hier zu arbeiten,
sondern wurde von der Kran-kenhausleitung als Absolventin zu dieser Station
dirigiert.
Es wurde Weihnachten. Am Heiligabend mußte ich um 20 Uhr den Nachtdienst
auf der kleinen, überschaubaren Station antreten. In den Korridoren
des Krankenhau-ses begegneten mir die letzten Besucher, die in Richtung
Ausgang eilten. Sie zogen den Nadelduft der Stationstannen und das Weihraucharoma
der heruntergebrann-ten Kerzen wie unsichtbare Schleier hinter sich her.
Doch mir war nicht weihnacht-lich. Der Dienstplan war noch in letzter
Minute umgeschrieben worden. "Da Sie keine Familie haben, macht Ihnen
das doch nichts aus?"
Das klang mehr nach einer Feststellung als nach Frage.
Na ja, dachte ich, wenigstens wird es eine ruhige Nacht werden, wenn ich
meiner Vorgängerin vom Tagdienst Glauben schenken konnte. Die Schwangere,
die seit dem Nachmittag in dem kleinen Kreißsaal der Station lag,
hatte sie mit einer Hand-bewegung abgetan: "Wieder mal viel zu früh
da. Typisch Erstgebärende, bißchen Ziepen und gleich in die
Klinik kommen. Sie wissen ja, wie das ist."
Nichts wußte ich, Geburtshilfe wurde auf der Fachschule nur gestreift.
Das wäre Sache der Hebamme. Im Kreißsaal und Operationssaal
durften wir Schülerinnen nur in Türnähe stehen, um nichts
unsteril zu machen. Mir wurde heiß und kalt. Wenn das nun in meiner
Schicht losgeht?
Ich konnte nicht zu Ende denken. Der gestrenge Chef schaute im Festanzug
nochmal nach der Patientin, die angefangen hatte zu stricken, er sagte
Artigkeiten wie, es würde heute nichts werden mit einem Christkind
und sie habe noch Zeit. Das beruhigte die junge Frau und normalisierte
meinen Puls. Beim Hinausgehen wünschte er frohe Weihnacht und sagte:
"Ich bin jederzeit erreichbar." An der Tür blitzten mich
seine Brillengläser noch einmal intensiv an: "Jederzeit, Schwester!"
Die werdende Mutter nahm ihre Strickarbeit wieder auf, ein Babyjäckchen,
hellgrün, da sie nicht wußte, was das Schicksal für sie
bereithielt.
Ultraschallaufnahmen gab es damals noch nicht, zumindest nicht in unserem
Krankenhaus. Ich machte meine erste Runde durch die gemischte Station.
Der kleine Kreißsaal wurde selten be-nutzt. In den paar Wochen,
in denen ich hier arbeitete, wäre es zum ersten Mal, daß ...
Ein Stöhnen riß mich aus meinen Gedanken. Lieber Gott, bitte,
bitte, nicht in meiner Schicht!
Die Patientin wälzte sich auf der schmalen Liege. Das Strickzeug
lag am Boden. "Schwester, Schwester, da tut sich was!"
Der Chef traf kurz nach dem Anruf ein. Er wohnte nur zwei Autominuten
entfernt und die Straßen waren kaum befahren. Es waren keine Wehen,
wie ich leicht vor-wurfsvoll zu hören bekam, sondern ganz gewöhnliche
Blähungen. Die Frau hatte zu Hause noch ein Mittagsmahl eingenommen,
Karpfen und Sauerkraut gehörten zum traditionellen Heiligabendessen
ihrer Familie. Ich mußte für Magentee sorgen und kam mir dabei
recht klein und dämlich vor.
Der Tee tat anscheinend gut, denn bald klapperten die Stricknadeln wieder.
Ich versah meine Arbeit weiter. Es war das Übliche, was für
den Nachtdienst anfällt. Hinzu kam das Wiederherrichten der großen
Tanne auf dem Flur: Neue Kerzen auf-stecken, Lametta und trockene Nadeln
zusammenfegen und festliche Ordnung schaffen. Zwischendurch mein leises
Stoßgebet, daß die Geburt nicht in meiner Schicht passieren
möge.
Nach Mitternacht hatte ich mich vom ersten "Wehenanfall" erholt.
Zu dieser Zeit ist es auf einer Station ohne Frischoperierte oder Schwerkranke
ruhig, nicht aber in unserem kleinen Kreißsaal. Von dort rief es:
"Schwester, es geht los!"
Vorsichtshalber wollte ich mich vor einem erneuten Telefonat erst einmal
selbst ü-berzeugen, daß ich nicht wieder einer Täuschung
zum Opfer fiel. Doch da kam ich bei meiner Patientin schlecht an. Diesmal
sei es ganz sicher, und sie würde nur den Doktor akzeptieren. Sie
machte mir deutlich, daß sie schließlich Privatpatientin sei.
Zu beruhigen war sie nicht. Und ich war zu ängstlich und konnte nicht
einschätzen, ob die Anwesenheit des Arztes wirklich notwendig war.
Ich hatte vorher versucht, Rat beim diensthabenden Arzt des Hauses zu
holen. Er meinte: "Chefpatientin? Nur bei Lebensgefahr."
Das allerdings war ja wohl wirklich nicht der Fall. Also Anruf! Der Chefarzt
war wie-der sofort da, den Kittel über dem Schlafanzug. Er stellte
leichte Ischialgie fest. "Da hilft etwas Einreibung, etwas Bewegung.
Die Liege ist hart. Sie machten mir gestern abend aber doch einen recht
erfahrenen Eindruck, Schwester." Seine Stimme klang ärgerlich.
Ein Lob war das nicht.
Nach all diesen für mich unrühmlichen Aufregungen braute ich
mir in der Stationsküche einen starken Kaffee.
"Den könnte ich jetzt auch brauchen", klang es kleinlaut
hinter mir. Die Hoch-schwangere hatte es auf der Liege nicht mehr ausgehalten.
Rücken und Bauch massierend stand sie im Nachthemd in der Küche.
Warum sollte ich ihr das ab-schlagen?
Weihnachten war für uns beide verkorkst. Beide mußten wir warten.
Sie auf das Kind und ich auf das Schichtende. Wir tranken den Kaffee im
Kreißsaal. Es war wohl eine unbewußte Vorausschau meinerseits.
Der Kaffee tat gut und machte mich wieder munter, aber anscheinend auch
das Kind. Nachdem ich mich noch etwas mit der werdenden Mutter unterhalten
hatte, trug ich das Geschirr in die Küche. Da hörte ich sie
rufen. Diesmal klang es noch dringlicher als vorher. Das Telefon!
Nein, zweimal blamieren reicht. Es blieb auch kaum Zeit zum Überlegen.
Es ging Schlag auf Schlag. Blasensprung, kaum Wehen. Schon guckte das
Köpfchen heraus, dann das ganze Christkind. Ich hatte gerade noch
Zeit, die sterilen Handschuhe über meine zitternden Hände zu
streifen. Jetzt alles tun, was notwendig ist, ging es mir durch den Kopf,
und keine Unsicherheit hinderte mich dabei. Es war, als hätte mir
jemand die Hände geführt.
An den Chef dachte ich erst später, ich hätte ihn längst
anrufen müssen. Da wird es sicher Ärger geben. Aber das war
mir jetzt egal, denn ich hörte die glückliche Mutter mit dem
Kind im Arm sagen: "Das war mein schönstes Weihnachten!"
Bei Interesse am Abdruck, senden Sie bitte den Kupon aus dem Newsletter an uns zurück.
Aus "Unvergessene Weihnachten" Band 1
Walsrode
in der Lüneburger Heide, Landkreis
Soltau-Fallingbostel, Niedersachsen;
Weihnachten 1950
Willis Heimkehr
(8.761 Zeichen)
Ernst Haß
Einer der Transporte,
die nach dem Krieg bis weit in die fünfziger Jahre hinein Rußlandheimkehrer
über das Lager Friedland nach Deutschland zurückbrachten, erreichte
im Dezember 1950 Walsrode. Ich war zu diesem Zeitpunkt in der dortigen
Landeskrankenanstalt (LKA) beschäftigt. Von meinem Arbeitsplatz in
der Telefonzentrale aus konnte ich am ersten Weihnachtstag unsere ehemaligen
Ostfrontsoldaten beim Aussteigen beobachten, überwiegend Männer
von 40 bis 45 Jahren, aber auch einige jüngere. Etliche waren so
stark abgemagert, sie hätten wohl zweimal in die Wattejacken hineingepaßt,
die sie zur Entlassung erhalten hatten. Sie schienen sehr müde und
auch psychisch am Ende zu sein. Die Augen dieser Männer waren leer.
Nun standen sie da und wußten nicht recht, wie es weitergehen sollte.
Daß sie hier keiner anschrie und über sie bestimmte, daß
sie keine Plennys - Gefangene - mehr, sondern frei waren, hatte wohl noch
keiner richtig begriffen. Vielleicht warteten sie auf ein Kommando?
Statt dessen erschienen unsere Krankenschwestern und brachten alle Heimkehrer
in die große Turnhalle, die man als Notunterkunft vorsorglich gut
geheizt und mit Matratzen und Wolldecken ausgelegt hatte. Hier erhielten
die Heimkehrer zu essen und zu trinken. Unsere Ärzte untersuchten
sie anschließend.
Jahrelang hatten diese Männer in Rußland kein Weihnachten mehr
erlebt. Viele weinten. Fragen nach den Familienangehörigen tauchten
auf. Ich hatte in der Telefonzentrale plötzlich reichlich zu tun.
Alle wollten mit ihren Verwandten telefonie-ren. Die Mädchen in der
Telefonzentrale der Post in Walsrode waren einmalig, sie brachten die
tollsten Verbindungen zustande. Ich wurde Zeuge dieser Gespräche,
ob ich wollte oder nicht. So erlebte ich viel Freude, viel Kummer und
Leid mit.
Ein noch jung aussehender Heimkehrer stellte sich vor: Willi Mußmann
sei sein Name. Ob er telefonieren dürfe?
"Natürlich", sagte ich. Nach kurzer Zeit hatte ich die
Verbindung hergestellt. Auf der anderen Seite meldete sich eine Männerstimme:
"Tischlerei Mußmann, guten Tag."
Ich stellte mich als Mitarbeiter der LKA Walsrode vor und fragte vorsichtig:
"Sind Sie der Vater von Willi Mußmann?"
"Ja, der bin ich, aber was soll das? Mein einziger Sohn ist seit
1944 verschollen."
Ich antwortete freudig: "Das stimmt nicht, Herr Mußmann. Ihr
Sohn steht hier neben mir und will mir den Hörer aus der Hand reißen.
Ich übergebe das Gespräch!"
Nach einer Weile reichte mir der Mann den Hörer ganz verstört
zurück: "Mein Vater sagte, daß sein Sohn Willi nicht mehr
lebt und meint, daß ich ein Betrüger sei. Aber ich lebe doch
noch! Was soll ich nur machen?"
Er weinte und mir kamen auch schon die Tränen. Es war schlimm. Schließlich
konnte ich ihn beruhigen und ließ ihn erzählen. Er sprach von
seiner Kindheit in Winsen, von seiner Schwester Änni, die eines Tages
vom Apfelbaum herunterfiel. Er bekam Schläge, weil er als älterer
Bruder hätte aufpassen müssen. Wir unterhielten uns etwa eine
halbe Stunde. Danach schien mir sicher, daß dieser Willi Mußmann
echt und kein Betrüger sei. Wie konnte ich ihm nur helfen?
Zunächst schickte ich ihn in die Turnhalle zurück: "Du
bekommst von mir Bescheid, beruhige dich erst einmal!"
Ich überlegte eine Weile und entschloß mich, nochmals bei Mußmanns
anzurufen. Jetzt meldete sich auf der anderen Seite eine Frauenstimme:
"Hier Tischlerei Mußmann!"
Sicher hatte mein Anruf für Aufregung gesorgt und so versuchte ich,
die Wogen wieder zu glätten. Sie sagte: "Ja, das hat wirklich
eine ziemliche Aufregung ins Haus gebracht. Vater war sehr aufgebracht,
hat geschimpft und mehrfach ,Betrüger!' gerufen. Was ist denn überhaupt
los?"
Ich fragte sie, ob sie die Schwester von Willi Mußmann sei, was
sie bestätigte. Nun erklärte ich wie schon beim ersten Telefonat
den Grund meines Anrufs. Aber auch sie zweifelte noch daran, daß
es sich hier wirklich um ihren verlorengeglaubten Bruder handelte. Wir
überlegten gemeinsam, wie sich die Familie Gewißheit verschaffen
könne und vereinbarten, daß sie mit ihren Eltern nach Walsrode
kommen sollte. Den Bruder informierte ich nicht über diese Absprache,
es sollte eine Überraschung sein. Falls es sich um einen Betrüger
handelte, würde man ihn anzeigen.
Zu Hause sprach ich mit meiner Frau darüber. Wir waren gespannt,
wie diese Geschichte ausgehen würde.
Am nächsten Morgen,
es war der zweite Weihnachtstag, stellte sich gegen zehn Uhr die Familie
Mußmann bei mir in der Telefonzentrale ein. Gemeinsam mit Eltern
und Tochter ging ich hinüber zur großen Turnhalle, wo die 60
Heimkehrer untergebracht waren. Beim Hineingehen gab ich den traurigen
Zustand der Heimkehrer zu beden-ken. Wir waren noch keine zwei Minuten
in der Halle, als der junge Mußmann auf-sprang. Er lief auf uns
zu und rief dabei "Änni, Änni!"
Bruder und Schwester fielen sich in die Arme. "Mein Willi, mein Willi
..." brachte Änni hervor. Sie umarmten und küßten
sich, beide weinten vor Freude. Ihren Eltern sagte Änni: "Mama
und Papa, das ist unser Willi!"
Ich beobachtete die beiden. Sie standen da wie versteinert und sahen regungslos
zu. Wollten sie nicht wahrhaben, daß dieser Mann ihr Sohn war? Auf
meine Fragen antworteten die Eltern: "Das ist nicht unser Sohn. Unser
Willi hat anders ausgese-hen. Er war viel kleiner und von schmächtiger
Gestalt, dieser Riese ist ein Schwindler!"
Wie ich inzwischen wußte, war Mußmanns Sohn mit 16 Jahren
freiwillig zum Volks-sturm gegangen. Damals war er 1,62 m groß und
wog keine 50 Kilo. Willi geriet in russische Gefangenschaft. Die schwere
Arbeit in einem sibirischen Bergwerk hatte ihn körperlich verändert.
Der damals noch nicht ausgewachsene Junge hatte jetzt breite Schultern
und eine stattliche Größe von 1,83 m.
Als Willi nun auf seine Mutter zuging, um sie in den Arm zu nehmen, wehrte
diese ab und sagte: "Sie sind nicht mein Sohn. Sie sind ein Betrüger!"
Beide Eltern schüttelten den Kopf. Diese Dramatik - es war fürchterlich!
Es ging auch mir unter die Haut! Ich glaubte, die Zeit stünde still.
Als der Vater nun auch noch meinte: "Nein, das ist nicht unser Junge!"
war das Maß für mich voll. Ich mischte mich wieder ein und
sagte: "Kommen Sie bitte mit, damit wir andernorts darüber verhandeln
können."
Willi Mußmann stand mit seiner Schwester im Arm ganz verstört
da. Änni beharrte: "Ohne Willi gehe ich hier nicht weg, komme
was will!" Sie klammerte sich an ihren Bruder.
Nun redete die Mutter auf Änni ein: "Komm, mein Kind. Er ist
nicht dein Bruder!"
"Doch Mama, er ist es. Gerade hat er mir erzählt, wie ich damals
vom Apfelbaum gefallen bin und wie Papa ihn verhauen hat. Er weiß
auch, wo wir im Garten immer am liebsten gespielt haben!"
Es lag eine ungeheure Spannung in der Luft, und viele Heimkehrer standen
schon um uns herum. Ich konnte die Eltern einfach nicht verstehen. Man
muß doch sein eigenes Kind wiedererkennen, dachte ich.
Endlich stellte die Mutter Fragen an ihn, die nur ihr einziger Sohn beantworten
konnte. Plötzlich wurde sie schneeweiß im Gesicht und fiel
in Ohnmacht. Willi konnte seine Mutter gerade noch auffangen. Er küßte
sie und sie kam wieder zu sich. "Er ist es, er ist es! Er ist mein
Willi!" rief sie glücklich und legte ihre Arme um seinen Hals.
Der Vater stand immer noch ungläubig dabei und stellte seinerseits
Willi nun Fragen. Wo er in der Werkstatt am liebsten gespielt, an welchen
Holzstützen er immer Nägel mit dem kleinen Hammer hineingeschlagen
habe?
Als Willi dies alles richtig beantworten konnte, wischte der Vater sich
mit der Hand über die Augen und gab zu: "Mudder, das ist doch
unser Junge! Herrgott ich danke dir, daß du uns unseren Sohn zurückgegeben
hast!"
Er nahm seinen Sohn in den Arm, Willi hielt seine Mutter dabei fest umklammert.
Änni weinte und lachte gleichzeitig vor Glück.
Während ich dies schreibe, erlebe ich alles noch einmal - die innere
Anspannung, die heftigen Gefühle. Ich sehe die Mußmanns noch
vor mir, wie sie alle vier glücklich die Halle verlassen. Sie ließen
sich die Entlassungspapiere geben und nahmen den jungen Mann gleich mit
nach Hause.
Am anderen Tag meldete
sich Willi Mußmann noch einmal telefonisch bei mir. Ob er etwas
vergessen habe, fragte ich. "Ja, ich habe gestern vor lauter Glück
vergessen, mich von Ihnen zu verabschieden, auch Dankeschön zu sagen!
Ich bin so glücklich, wieder zu Hause zu sein. Vielen Dank für
Ihre Hilfe! Alles Gute für Sie und Ihre Familie. Und einen guten
Rutsch ins neue Jahr!"
Ich freute mich mit ihm. Damals war ich 37 Jahre alt und Willi Mußmann
nach fünfjähriger Gefangenschaft 21. Heute müßte
er also 72 oder 73 Jahre alt sein! Vielleicht führen seine Kinder
die Tischlerei weiter, und es meldet sich immer noch jemand mit "Tischlerei
Mußmann, guten Tag"?
Bei Interesse am Abdruck, senden Sie bitte den Kupon aus dem Newsletter an uns zurück.
