| Leseprobe |
|
|
Spasibo Iwan
- Danke Soldat Sammlung der Zeitzeugen |
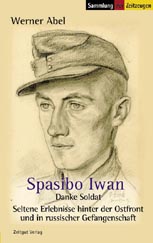 |
|
Leseproben
aus dem Buch
Ende Januar 1945 So schnell der Spuk begonnen hatte, so schnell war er auch wieder vorbei, zumindest akustisch. Wir drei hetzten weiter, vergewisserten uns immer wieder, ob wir verfolgt würden, und versteckten uns in einem Dickicht aus Schilf und Weidenbüschen. Dort setzten wir uns auf einen Baumstamm, um uns von dem Schreck der ersten Feindberührung zu erholen. Ob die anderen Kameraden sich wie wir drei hatten retten können, wussten wir nicht und haben es nie erfahren. Die beiden Maschinengewehrgarben und ein paar Einzelschüsse aus Karabinern und Maschinenpistolen, das war der ganze »Gefechtslärm«, den ich von der Ostfront hörte. Das Ganze hatte nur etwa zehn Sekunden gedauert. Zum Glück kannte ich die beiden anderen vom Dienst in der Truppe her recht gut. Aber Kameraden, das ist ein gefühlsstarkes Wort; Kameraden im Sinne einer verschworenen Schicksalsgemeinschaft waren wir nicht, jedenfalls noch nicht. Über unsere völlig neue Situation hatten wir, als der Morgen nahte, noch nicht gesprochen. Bei Tagesanbruch trauten wir uns aus Angst, entdeckt zu werden, nicht aus unserem Versteck, denn wir rechneten damit, überall auf Russen zu stoßen. Wir gingen davon aus, dass die russische Front uns inzwischen überrollt hatte, obwohl es dafür außer dem Schusswechsel vor wenigen Stunden keinerlei Anzeichen gab: keine Motorengeräusche, weder von Panzern noch von Fahr- oder Flugzeugen. Kein Geschützdonner und keine Gewehrschüsse waren zu hören. Nichts, woraus man auf ein Kriegsgeschehen hätte schließen können. So hatte ich mir die Front wirklich nicht vorgestellt. Den ganzen Tag über hielten wir uns im Schilf verborgen, hatten also ausreichend Zeit, uns darüber zu beraten, wie es weitergehen sollte. Zunächst tauschten wir unsere Adressen aus: Einer war aus Thüringen, der andere war Rheinländer. Einig waren wir uns darüber, uns nicht zu ergeben. Denn wir waren wie alle anderen im Bataillon davon überzeugt, dass die Russen keine Kriegsgefangenen machen würden. Wir gönnten den Russen nicht den Triumph, uns zu erschießen, und wollten uns an die an der ganzen Ostfront gängige Devise halten: Die letzte Patrone ist für mich selbst. Wir beschlossen,
nur nachts im Schutz der Dunkelheit weiterzulaufen, immer nach Westen,
womöglich schneller als die Russen, um so rasch wie möglich
unsere Einheit einzuholen. Ein Hindernis würde allerdings die
Weichsel sein. Aber man würde ja sehen. Gegen Abend hatten wir den Schock einigermaßen überwunden. Wir hatten uns auf einen festen Plan geeinigt und fühlten uns nunmehr als eine Schicksalsgemeinschaft. Heute, nach so langer Zeit, sehe ich die nächtliche Feindberührung mit ganz anderen Augen. Ein Beispiel für soldatische Tugenden war unser Verhalten jedenfalls nicht, eher ein Beweis unserer mangelhaften militärischen Ausbildung und Erfahrung. Bei einer umsichtigen, fronterfahrenen Führung hätte der Zusammenstoß mit den Rotarmisten einen anderen Verlauf nehmen müssen. Warum hatte der Unteroffizier keine Wachen eingeteilt, die uns rechtzeitig hätten warnen können? Warum hatten wir uns nicht rechtzeitig in die Dunkelheit zurückgezogen und die Russen mit unserer gemeinsamen Feuerkraft überrascht? Unsere gute Stimmung schlug in Skepsis um, als wir nach Einbruch der Dunkelheit unser Versteck verließen. Denn da erst fiel uns auf, dass die Senke, an deren tiefster Stelle wir uns versteckt hatten, recht klein war. Nicht einmal ein Feldweg führte hindurch. Kein Wunder, dass wir den ganzen Tag über niemanden zu sehen bekommen hatten und allein geblieben waren! Was aber erwartete uns jetzt wohl hinter dem Horizont? Anfang Februar 1945 Wie viel Zeit seit jener Nacht vergangen war, in der mich ein russischer Soldat am Schlafittchen gepackt hatte, kann ich heute nur noch schätzen. Eine knappe Woche mögen wir anfangs zu dritt unterwegs gewesen sein. Gut zwei Wochen war ich dann wohl allein als Versprengter hinter der russischen Front unterwegs. Heute frage ich mich, wie ich diese Strapazen aushalten und gesundheitlich überstehen konnte: Hunger, Übermüdung, Durst, Kälte, körperliche Strapazen, meist unter freiem Himmel im winterlichen Polen und in den letzten Wochen mutterseelenallein auf der Flucht. Ich kann mich nicht erinnern, Hunger oder Durst verspürt zu haben. Auch durchnässte Kleidung und eiskalten Wind nahm ich gelassen hin. Sogar massiver Schlafmangel störte mich nicht ernstlich. All das war nicht so wichtig. Meine ganze Aufmerksamkeit, alle meine Gedanken und meine ganze Kraft galten nur einem Ziel: »Komme was da wolle, sie kriegen mich nicht.« Nur bei oberflächlicher Betrachtung entwickelte sich zwischen den Russen und mir ein geistiges Kräftemessen. In Wirklichkeit befand ich mich mit ihnen in einem Wettkampf um Leben und Tod. In jenen Tagen und Nächten war ich von einer tief verwurzelten Angst um mein Leben beherrscht, ohne dass mir das völlig bewusst gewesen wäre. Wie bereits erwähnt, schlief ich anfangs tagsüber zunächst in irgendeinem Gebüsch, später, als im Freien kein Versteck mehr zu finden war, in Scheunen und Heuspeichern. Ich lief querfeldein über Wiesen und Felder bei jedem Wetter, und das war in jenen Tagen im Januar und Februar 1945 höchst unterschiedlich. Zurechtfinden musste ich mich sowohl in mondhellen als auch in stockfinsteren Nächten. Es gab Nächte mit absoluter Windstille und solche, in denen ein eiskalter Ostwind mir den Rücken vor Kälte erstarren ließ oder in denen ein lauer Westwind mir unablässig ins Gesicht blies. Mit eisigem Frost hatte ich ebenso wie mit nassem Tauwetter fertig zu werden. Unverändert hoch lag der Schnee, durch den ich die ganze Zeit stapfte. Wer schon einmal Rehe beobachtet hat, wie sie in einer Wiese stehen und äsen, wundert sich darüber, dass ihnen eigentlich nur wenig Zeit zum Grasen bleibt. Ständig sichern sie. Unentwegt schauen sie in alle Richtungen, ohne Pause bewegen sich ihre Lauscher, das geringste Geräusch wird wahrgenommen. Unablässig zittern ihre Nüstern, sie nehmen jede verdächtige Witterung auf. Bevor ein Wanderer sich ihnen nähern kann, haben sie ihn schon längst entdeckt und die Flucht ergriffen. Meine Situation und mein Verhalten waren dem der Rehe durchaus vergleichbar. In mondhellen Nächten verließ ich mich ganz auf meine Augen. Ich musste den Feind zuerst bemerken. Deshalb ließ ich mich bei jeder verdächtigen Beobachtung augenblicklich hinfallen. Das war mir während meiner Flucht schon so stark zur Gewohnheit geworden, dass ich daran im Einzelnen keine Erinnerung mehr habe. In dunklen
Nächten oder bei Schneefall musste ich alle paar Schritte anhalten,
um in die Nacht hineinzulauschen. In sehr kalten Nächten knirschte
der Schnee unter meinen Stiefeln so stark, dass kaum ein anderes Geräusch
zu hören war. Dann war doppelte Vorsicht geboten. |
|
 |
|
