Mauer-Passagen
Grenzgänge,
Fluchten und Reisen
1961-1989
46 Geschichten und Berichte von Zeitzeugen
368 Seiten, viele Abbildungen, Mauer-Chronologie, Ortsregister
Reihe Zeitgut Band 19
ungekürzte Taschenbuchausgabe
ISBN 978-3-86614-171-1
9,90 EUR
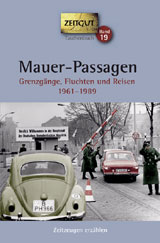
Wanke-Kreh,
Udo
Das erste Leben
Erinnerungen eines Nichtangepaßten 1947-1972
228 Seiten, Fotos und Dokumente.
Englische Broschur mit Schutzumschlag.
Sammlung der Zeitzeugen (4)
ISBN:
3-933336-37-6
19,80 EUR
zum
Buchshop »
zur
Leseprobe »

zum Buch "Mauer-Passagen"
In den frühen Morgenstunden des 13. August 1961 mußten die Menschen in Ost- und West-Berlin fassungslos zusehen, wie zwischen ihnen, quer durch die gesamte Stadt, eine Mauer entstand. Bewachte Baukommandos legten Stacheldrahtrollen aus, rissen das Straßenpflaster auf und begannen, mit Steinen und Mörtel eine Mauer zu errichten, bis sie selbst dahinter verschwanden. Damit war in Berlin das letzte Schlupfloch zwischen Ost und West geschlossen. Endgültig war der eiserne Vorhang niedergegangen, 28 Jahre blieb er verschlossen. Leseprobe >>
zum Buch "Das erste Leben"
Originell
und leicht sarkastisch erzählt Udo Wanke-Kreh die Geschichte seines
"ersten Lebens". Dabei bietet er komische und informative Einblicke
in den Alltag und in die Gesellschaft des Arbeiter- und Bauernstaates,
die mit seiner gefahrenvollen Flucht 1972 aus dem inzwischen ungeliebten
Vaterland endet.
Leseprobe >>
[West-Berlin; 12./13. August 1961]
Hermann
Meyn
Allein auf weiten Fluren
Es war die
Nacht der Nächte, jedenfalls für einen 26jährigen, der
einige Wochen zuvor auf Honorarbasis für 60 Mark pro Schicht in der
Nachrichtenredaktion des RIAS angeheuert hatte. Kurz vor zwei Uhr stürzte
an diesem 13. August 1961 ein spärlich bekleideter Amerikaner in
den Nachrichtenraum, in dem ich mutterseelenallein versuchte, vier unablässig
klingelnde Telefonapparate zu bedienen, und fragte mich in gebrochenem
Deutsch: "Sind die Verbindungswege betroffen?"
Ich antwortete: "Nein, es geht um die Abriegelung Ost-Berlins."
"Dann ist alles okay", sagte er sichtlich erleichtert und verschwand
so schnell, wie er gekommen war.
Ich war fassungslos. So hatte ich mir das Engagement der größten
westlichen Weltmacht für die Freiheit Berlins nicht vorgestellt.
Aber zu längerem Nachdenken blieb mir keine Zeit. Seit einer reichlichen
halben Stunde bemühte ich mich bereits ebenso verzweifelt wie vergeblich,
die US-Mission, die Chefredaktion des Senders, den Leiter der Nachrichtenredaktion
und Kolleginnen und Kollegen zu erreichen. Diese Reihenfolge sah der Alarmplan
vor, nach dem ich im Falle eines Falles handeln sollte. Meine Schicht
begann um Mitternacht. Normalerweise ein ruhiger Sechs-Stunden-Job bis
zum nächsten Morgen. Damals strahlte der RIAS, der Rundfunk im amerikanischen
Sektor, stündlich Nachrichten aus, die während dieser Schicht
nur selten verändert wurden. Nun war allerdings in den letzten Wochen
der Strom von DDR-Flüchtlingen nach West-Berlin sprunghaft gestiegen.
Tag für Tag berichteten die Westmedien triumphierend über neue
Rekorde der Abstimmung mit den Füßen. Die Reaktion des SED-Regimes
auf diese Fluchtwelle war unklar. Der DDR-Staatsratsvorsitzende Walter
Ulbricht hatte noch vor kurzem anläßlich einer Pressekonferenz
auf die Frage einer westdeutschen Korrespondentin geantwortet, niemand
denke daran, eine Mauer zu errichten. Dennoch blieb die politische Hochspannung
in Berlin spürbar, es lag etwas in der Luft.
Hier,
im RIAS-Funkhaus in der Kufsteiner Straße in Berlin-Schöneberg,
hatte ich in der Nacht zum 13. August 1961 Dienst und versuchte verzweifelt,
die US-Mission und die Chefredaktion des Senders zu erreichen. Hörer
hatten mich über die Einstellung des S-Bahnverkehrs und Absperrungen
an der Grenze zu Ost-Berlin informiert.
Als ich an
diesem Sonnabend kurz vor 24 Uhr in der Nachrichtenredaktion erschienen
war, fragte ich routinemäßig die Kolleginnen und Kollegen von
der Spätschicht, ob es irgendetwas Besonderes gäbe.
"Alles ruhig", lautete die Antwort, "wir wünschen
eine ruhige Nacht." Sagten's und verschwanden.
Von nun an war ich der einzige Journalist im Haus, allein auf weiten Fluren,
auf denen ich höchstens einmal einen Nachrichtensprecher traf, der
für den Fall Bereitschaftsdienst hatte, daß tatsächlich
einmal nachts die Nachrichten neu gesprochen werden mußten. Außer
uns wachte noch jemand in der Telefonzentrale. Die Technik war ebenfalls
besetzt. Und im Nebenraum harrte eine Mitarbeiterin aus, die mir die eventuell
eingehenden Agenturmeldungen vorlegte.
Kurz nach Mitternacht klingelte das Telefon. Ein Hörer teilte mit,
die S-Bahn, die damals den östlichen mit dem westlichen Teil Berlins
verband, verkehre nicht mehr. Ich hielt das für eine individuelle
Beobachtung ohne Nachrichtenwert und beruhigte den Anrufer, er möge
nicht so ungeduldig sein. Nachts seien eben die Fahrabstände ein
wenig größer. Aber die Anrufe häuften sich - der RIAS
galt damals als eine der wichtigsten Informationsquellen, wurde aber auch
nachts gelegentlich als Seelsorgestation benutzt. Da ich zu diesem Zeitpunkt
der einzige war, der Auskünfte geben konnte, stellte die Zentrale
sämtliche Anrufe zu mir in die Nachrichtenredaktion durch. Vollauf
damit beschäftigt, gleichzeitig vier Telefonapparate zu bedienen,
die unglücklicherweise auch noch so weit voneinander entfernt standen,
daß ich ständig um mehrere zusammengestellte Schreibtische
herumrennen mußte, hörte ich dennoch, daß plötzlich
nebenan der Nachrichtenticker lief. Nichts als unverständliche Nachrichten.
Es war die amerikanische Nachrichtenagentur AP, die gegen ein Uhr über
ein Kommuniqué der Warschauer Paktstaaten berichtete. Minutenlang
bemühte ich mich, den Text zu verstehen. Darin war von "Maßnahmen"
die Rede, ohne daß gesagt wurde, was damit konkret gemeint war -
von Hinweisen auf die Teilung Berlins durch Stacheldraht und Sperren keine
Spur. Eine Sekretärin war nicht zur Stelle, die Dame von nebenan
konnte mit der Schreibmaschine nicht umgehen. Ich mußte mich also
selbst ans Werk machen, ausnahmsweise, denn Nachrichten wurden damals
im RIAS anhand von Agenturmeldungen grundsätzlich einer Sekretärin
diktiert. Sobald ich einen Halbsatz getippt hatte, mußte ich wieder
aufspringen, weil die Telefone klingelten. Nachtdienst zu dieser Zeit
hieß, das hatte mir der RIAS-Nachrichten-Chef Hans-Werner Schwarze
eingebläut, in erster Linie Telefonbedienung und im Notfall nach
Plan Alarmierung der Verantwortlichen.
Bevor ich
beim Sender in der Kufsteiner Straße in Schöneberg begann,
arbeitete ich bereits zwei Jahre lang nebenbei als Korrespondent für
den Südwestfunk. Zu meiner täglichen Lektüre gehörte
deshalb das SED-Zentralorgan "Neues Deutschland". Ich hatte
also Übung darin, Parteichinesisch in die Alltagssprache zu übersetzen.
Aber diese AP-Meldung über das Kommuniqué der Warschauer Paktstaaten
überforderte mich schlichtweg. Ich konnte sie nicht entschlüsseln,
erkannte nicht ihre politische Tragweite. Ich schaffte es nicht, für
die Nachrichtensendung um ein Uhr eine Meldung zu formulieren, die klar
zum Ausdruck brachte, worum es tatsächlich ging. Ja, es kam mit Ach
und Krach eine Meldung zustande, aber sie war weitgehend unverständlich,
und deswegen sah ich auch davon ab, nach dem Alarmplan zu verfahren.
Kurz nach ein Uhr lief eine knappe Meldung der Deutschen Presse-Agentur
über den Ticker, in der zum ersten Mal konkret von Abriegelungsmaßnahmen
am Brandenburger Tor die Rede war. Nun begann mein Kampf gegen vier Telefonapparate,
die laufend klingelten, und mein Versuch, die Verantwortlichen zu alarmieren.
Kostbare Minuten verrannen, bis endlich eine Leitung frei wurde. Ich kam
durch, aber am anderen Ende der Leitung meldete sich niemand, weder die
US-Mission noch die obersten Verantwortlichen auf deutscher Seite - es
war zum Verzweifeln!
Das Schweigen
der Schutzmacht
Gestützt auf mehrere Agenturen, vermittelten dann die Zwei-Uhr-Nachrichten,
die ich trotz Telefonstreß formuliert habe, ein erstes realistisches
Bild von der neuen Lage in Berlin. Irgendwie muß diese Meldung die
RIAS-Spitzen in den Bars und auf den mitternächtlichen Sommerpartys
erreicht haben. Allmählich füllte sich die Redaktion. Kolleginnen
und Kollegen, die gar nicht auf dem Dienstplan standen, fanden sich ein.
Das Programm wurde geändert, und nun informierte der RIAS praktisch
pausenlos über die Geschehnisse mit Nachrichten pur rund um die Uhr.
Morgens um 6 Uhr war mein Dienst vorbei. Ich blieb noch eine Stunde länger,
weil ich viel zu aufgewühlt von den nächtlichen Erlebnissen
war und auch wissen wollte, wie die Schutzmächte reagieren würden.
Daß sie nach längerem Schweigen nur protestieren würden,
konnte ich mir an diesem Morgen nicht vorstellen, es hätte mir aber
nach der nächtlichen Begegnung mit dem Vertreter der US-Mission klar
sein müssen. Doch diese Fehleinschätzung teilte ich sicherlich
mit vielen Berlinern, auch mit etlichen Kommentatoren in der Stadt, die
in drastischer Form ihre Enttäuschung über die Amerikaner, Engländer
und Franzosen zum Ausdruck brachten.
Um 7 Uhr bin ich mit einem Taxi zum Brandenburger Tor gefahren. Dort sah
ich mit Wut und Trauer und Enttäuschung, wie Angehörige der
Grenztruppen der DDR mit Preßlufthämmern den Asphalt vor dem
Tor aufbohrten. Ich sah tatenlos zu und eine andere Verhaltensweise wäre
wider alle Vernunft gewesen. Aber das Hämmern klingt mir noch heute
in den Ohren, wenn ich an den 13. August 1961 denke.
Ostberlin 13. August 1961
Einschnitt Mauerbau (Auszug aus dem Buch "Das erste Leben)
Am Sonntagmorgen, dem 13. August 1961, erwachte ich aus süßem Schlummer. Verschlafen schaltete ich das Radio ein, hörte im Halbschlaf „Berlin ist abgeriegelt“ oder etwas Ähnliches, drehte mich auf die andere Seite und schlummerte weiter. Erst verzögert drang mir die hektische Stimme des Nachrichtensprechers ins Bewußtsein. Auf einmal war ich hellwach, sprang auf, zog mich an und flitzte ohne Frühstück zu Achim. Der war auch schon angezogen, und wir gingen zu Jürgen. Zu dritt, etwas gefaßter und mutiger, eilten wir zum Grenzübergang Bernauer Straße, der am nächsten lag. Schon im Vorfeld, in Nebenstraßen und auf freien Plätzen, überall sahen wir Panzer und motorisierte Einheiten der Russen und der Nationalen Volksarmee.
An der Grenze
standen Uniformierte in vier Reihen hintereinander, jede Reihe im Abstand
von 15 bis 20 Metern zur nächsten. Die erste Kette auf Ostberliner
Seite, Schulter an Schulter, in Tarnanzügen und mit Maschinenpistolen
quer vor der Brust, bildeten die Betriebskampfgruppen. Sie fühlten
sich offensichtlich nicht gerade wohl in ihrer Haut. Die zweite Kette
bestand aus Volkspolizisten, dann folgte als dritte die Nationale Volksarmee
und direkt an der Grenze standen die Soldaten und Offiziere der sowjetischen
Armee, alle mit dem Rücken nach Westberlin und dem Gesicht nach Ostberlin.
Sie hatten augenscheinlich keine Angst vor dem Klassenfeind, sondern vor
ihren eigenen „Brüdern und Schwestern“.
Zwischenzeitlich hatten sich, entlang der Sektorengrenze immer mehr Ostberliner
zusammengefunden. Es war eine unheimliche Situation, der die Menschen
verblüfft, schweigend und völlig überrascht von der nicht
faßbaren Tatsache gegenüberstanden. Unvorbereitet, überrumpelt
und handlungsunfähig fühlten sich alle. Entsprechend verhielten
sie sich wie verängstigte, neugierige Tiere, die sich einen Fluchtweg
nach hinten offenhielten und vorsichtig ausloteten, wie weit sie sich
der Grenze nähern durften. Sobald man eine unsichtbare Linie überschritt,
wurde man aufgefordert zurückzutreten und nach Hause zu gehen. In
die Zuschauer hinein, etwa um sie zu zerstreuen, wagte sich kein Uniformierter.
Es war ein Patt, dem der zündende Funke fehlte – woher auch?
Wir pilgerten die Sektorengrenze entlang, blieben ab und an stehen, überall
das gleiche Bild.
Nach ein paar Stunden verdrückten wir uns, um das Erlebte und Gesehene erst einmal zu verarbeiten. Die Gefühle und Meinungen darüber waren zwiespältig und weitgehend aggressionslos. Erst im Laufe der nächsten Tage schälte sich ein Meinungsbild heraus. Einerseits betrachteten wir den Mauerbau einhellig als Freiheitsberaubung und Willkürakt und erörterten im jugendlichen Eifer Fluchtpläne. Andererseits brachten wir für den Mauerbau ein gewisses Verständnis auf, wußten wir doch, daß täglich Tausende DDR-Bürger in den Westen geflüchtet waren, was einer Massenpsychose gleichkam. Wie ich hatten viele andere ebenfalls die Absicht, nach der Ausbildung abzuhauen. Es leuchtete uns ein, daß kein Staat einen solchen Aderlaß zulassen und verkraften konnte. Zudem war uns das Gefühl, im Westen als Mensch zweiter Klasse behandelt worden zu sein, gegenwärtig, weshalb wir einen nicht unerheblichen Groll gegen die Westler hegten. Nicht zuletzt war Neid mit im Spiel. Das alles führte zu einer irrationalen Schadenfreude im Sinne von: „Jetzt haben wir es denen auch mal gezeigt“.
Aus diesem Zwiespalt und der Neuorientierung heraus hätte die DDR einen Teil meiner Generation für sich gewinnen können. Wie wäre das zu schaffen gewesen? In den ersten Wochen nach dem Mauerbau hätte ein neuer Sozialismus propagiert und mit einigen spektakulären Entscheidungen realisiert werden müssen, eine Art „Berliner Frühling“, ähnlich dem „Prager Frühling“ sieben Jahre später. Wirkungsvoll wäre die völlige Reisefreiheit innerhalb des Ostblocks gewesen, selbst auf die Gefahr hin, daß weitere DDR-Bürger, die man ohnehin nicht hätte halten können, über Drittländer geflüchtet wären.
Vor allem
hätte die Regierung die Intellektuellen, Künstler und Studenten
als Podium und Aushängeschild für sich gewinnen müssen.
Dieser Personenkreis besaß in der DDR einen hohen Vertrauensbonus.
Unter dem Motto „Vom Kapitalismus lernen, um seine Fehler zu vermeiden
und seine Vorteile zu nutzen“ hätte sich die DDR in den geistes-
und naturwissenschaftlichen Bereichen öffnen müssen. Bedingt
durch die gleiche Sprache in Ost und West, war es letzten Endes nicht
möglich, uns etwas zu verheimlichen. Meine Privatbibliothek umfaßte
mit meinen 17 Jahren bereits acht laufende Meter Bücher, und ich
war Benutzer von zwei großen öffentlichen Bibliotheken. Ich
hatte bereits mehr Westliteratur gelesen, als mancher Westdeutsche in
seinem ganzen Leben – und nicht nur Romane. Und über das Gelesene
wurde im Freundeskreis diskutiert. Was konnte die DDR mir an Informationen
vorenthalten? Ich warf ihr mit Recht vor, daß sie meine Erwartungen
nicht erfüllt hatte.
Für umfassende Reformen des Sozialismus fehlten der Partei und Regierung
der Mut und das Wissen. Die SED wollte ihr Menschenbild erzwingen und
hielt in ihrer Beschränktheit Scheinerfolge für wirkliche Erfolge.
Je öfter ich mich in den folgenden Jahren auf die Wünsche des
Staates einzugehen gezwungen sah, um so stärker wuchsen meine Abneigung
und mein innerer Protest. Statt durch den Mauerbau die sich abzeichnende
Auszehrung abzuwenden, leitete die Staatsmacht dadurch den schleichenden
Zerfall von innen ein. Ich komme noch darauf zurück.
Der Vergnügungspark Westberlin war also geschlossen, „Republikflucht“ nur noch unter Lebensgefahr möglich. Für die Ostberliner folgte eine Umorientierung im privaten und gesellschaftlichen Leben. Das ging nicht von heute auf morgen, aber erstaunlich schnell. Nach einigen Jahren hatten sich die Fronten innerhalb der DDR geklärt.