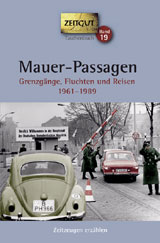 Mauer-Passagen
Mauer-Passagen
Grenzgänge,
Fluchten und Reisen
1961-1989
46 Geschichten und Berichte von Zeitzeugen
368 Seiten, viele Abbildungen, Mauer-Chronologie, Ortsregister
Reihe Zeitgut Band 19
ungekürzte Taschenbuchausgabe
ISBN 978-3-86614-171-1
9,90 EUR
Leserstimmen
>>
Inhalt
der Leseprobe
Hermann
Meyn: Allein auf weiten Fluren
Rudolf Bentz: Republikflüchtige
Aale
Marianne Doerfel: Blinde Passagiere
Hans Peter Kutscha: Meine Volkspolizisten
Hans-Joachim
Musiol: Vorkommnisse
Helga
Brachmann: Angst
Irmgard
Pondorf: Die ruhiggestellte Tante
Rudolf
Bentz: Die Demonstration
zum
kompletten Inhaltsverzeichnis
[West-Berlin; 12./13. August 1961]
Hermann
Meyn
Allein auf weiten Fluren
Es war die
Nacht der Nächte, jedenfalls für einen 26jährigen, der
einige Wochen zuvor auf Honorarbasis für 60 Mark pro Schicht in der
Nachrichtenredaktion des RIAS angeheuert hatte. Kurz vor zwei Uhr stürzte
an diesem 13. August 1961 ein spärlich bekleideter Amerikaner in
den Nachrichtenraum, in dem ich mutterseelenallein versuchte, vier unablässig
klingelnde Telefonapparate zu bedienen, und fragte mich in gebrochenem
Deutsch: "Sind die Verbindungswege betroffen?"
Ich antwortete: "Nein, es geht um die Abriegelung Ost-Berlins."
"Dann ist alles okay", sagte er sichtlich erleichtert und verschwand
so schnell, wie er gekommen war.
Ich war fassungslos. So hatte ich mir das Engagement der größten
westlichen Weltmacht für die Freiheit Berlins nicht vorgestellt.
Aber zu längerem Nachdenken blieb mir keine Zeit. Seit einer reichlichen
halben Stunde bemühte ich mich bereits ebenso verzweifelt wie vergeblich,
die US-Mission, die Chefredaktion des Senders, den Leiter der Nachrichtenredaktion
und Kolleginnen und Kollegen zu erreichen. Diese Reihenfolge sah der Alarmplan
vor, nach dem ich im Falle eines Falles handeln sollte. Meine Schicht
begann um Mitternacht. Normalerweise ein ruhiger Sechs-Stunden-Job bis
zum nächsten Morgen. Damals strahlte der RIAS, der Rundfunk im amerikanischen
Sektor, stündlich Nachrichten aus, die während dieser Schicht
nur selten verändert wurden. Nun war allerdings in den letzten Wochen
der Strom von DDR-Flüchtlingen nach West-Berlin sprunghaft gestiegen.
Tag für Tag berichteten die Westmedien triumphierend über neue
Rekorde der Abstimmung mit den Füßen. Die Reaktion des SED-Regimes
auf diese Fluchtwelle war unklar. Der DDR-Staatsratsvorsitzende Walter
Ulbricht hatte noch vor kurzem anläßlich einer Pressekonferenz
auf die Frage einer westdeutschen Korrespondentin geantwortet, niemand
denke daran, eine Mauer zu errichten. Dennoch blieb die politische Hochspannung
in Berlin spürbar, es lag etwas in der Luft.
Hier,
im RIAS-Funkhaus in der Kufsteiner Straße in Berlin-Schöneberg,
hatte ich in der Nacht zum 13. August 1961 Dienst und versuchte verzweifelt,
die US-Mission und die Chefredaktion des Senders zu erreichen. Hörer
hatten mich über die Einstellung des S-Bahnverkehrs und Absperrungen
an der Grenze zu Ost-Berlin informiert.
Als ich an
diesem Sonnabend kurz vor 24 Uhr in der Nachrichtenredaktion erschienen
war, fragte ich routinemäßig die Kolleginnen und Kollegen von
der Spätschicht, ob es irgendetwas Besonderes gäbe.
"Alles ruhig", lautete die Antwort, "wir wünschen
eine ruhige Nacht." Sagten's und verschwanden.
Von nun an war ich der einzige Journalist im Haus, allein auf weiten Fluren,
auf denen ich höchstens einmal einen Nachrichtensprecher traf, der
für den Fall Bereitschaftsdienst hatte, daß tatsächlich
einmal nachts die Nachrichten neu gesprochen werden mußten. Außer
uns wachte noch jemand in der Telefonzentrale. Die Technik war ebenfalls
besetzt. Und im Nebenraum harrte eine Mitarbeiterin aus, die mir die eventuell
eingehenden Agenturmeldungen vorlegte.
Kurz nach Mitternacht klingelte das Telefon. Ein Hörer teilte mit,
die S-Bahn, die damals den östlichen mit dem westlichen Teil Berlins
verband, verkehre nicht mehr. Ich hielt das für eine individuelle
Beobachtung ohne Nachrichtenwert und beruhigte den Anrufer, er möge
nicht so ungeduldig sein. Nachts seien eben die Fahrabstände ein
wenig größer. Aber die Anrufe häuften sich - der RIAS
galt damals als eine der wichtigsten Informationsquellen, wurde aber auch
nachts gelegentlich als Seelsorgestation benutzt. Da ich zu diesem Zeitpunkt
der einzige war, der Auskünfte geben konnte, stellte die Zentrale
sämtliche Anrufe zu mir in die Nachrichtenredaktion durch. Vollauf
damit beschäftigt, gleichzeitig vier Telefonapparate zu bedienen,
die unglücklicherweise auch noch so weit voneinander entfernt standen,
daß ich ständig um mehrere zusammengestellte Schreibtische
herumrennen mußte, hörte ich dennoch, daß plötzlich
nebenan der Nachrichtenticker lief. Nichts als unverständliche Nachrichten.
Es war die amerikanische Nachrichtenagentur AP, die gegen ein Uhr über
ein Kommuniqué der Warschauer Paktstaaten berichtete. Minutenlang
bemühte ich mich, den Text zu verstehen. Darin war von "Maßnahmen"
die Rede, ohne daß gesagt wurde, was damit konkret gemeint war -
von Hinweisen auf die Teilung Berlins durch Stacheldraht und Sperren keine
Spur. Eine Sekretärin war nicht zur Stelle, die Dame von nebenan
konnte mit der Schreibmaschine nicht umgehen. Ich mußte mich also
selbst ans Werk machen, ausnahmsweise, denn Nachrichten wurden damals
im RIAS anhand von Agenturmeldungen grundsätzlich einer Sekretärin
diktiert. Sobald ich einen Halbsatz getippt hatte, mußte ich wieder
aufspringen, weil die Telefone klingelten. Nachtdienst zu dieser Zeit
hieß, das hatte mir der RIAS-Nachrichten-Chef Hans-Werner Schwarze
eingebläut, in erster Linie Telefonbedienung und im Notfall nach
Plan Alarmierung der Verantwortlichen.
Bevor ich
beim Sender in der Kufsteiner Straße in Schöneberg begann,
arbeitete ich bereits zwei Jahre lang nebenbei als Korrespondent für
den Südwestfunk. Zu meiner täglichen Lektüre gehörte
deshalb das SED-Zentralorgan "Neues Deutschland". Ich hatte
also Übung darin, Parteichinesisch in die Alltagssprache zu übersetzen.
Aber diese AP-Meldung über das Kommuniqué der Warschauer Paktstaaten
überforderte mich schlichtweg. Ich konnte sie nicht entschlüsseln,
erkannte nicht ihre politische Tragweite. Ich schaffte es nicht, für
die Nachrichtensendung um ein Uhr eine Meldung zu formulieren, die klar
zum Ausdruck brachte, worum es tatsächlich ging. Ja, es kam mit Ach
und Krach eine Meldung zustande, aber sie war weitgehend unverständlich,
und deswegen sah ich auch davon ab, nach dem Alarmplan zu verfahren.
Kurz nach ein Uhr lief eine knappe Meldung der Deutschen Presse-Agentur
über den Ticker, in der zum ersten Mal konkret von Abriegelungsmaßnahmen
am Brandenburger Tor die Rede war. Nun begann mein Kampf gegen vier Telefonapparate,
die laufend klingelten, und mein Versuch, die Verantwortlichen zu alarmieren.
Kostbare Minuten verrannen, bis endlich eine Leitung frei wurde. Ich kam
durch, aber am anderen Ende der Leitung meldete sich niemand, weder die
US-Mission noch die obersten Verantwortlichen auf deutscher Seite - es
war zum Verzweifeln!
Das Schweigen
der Schutzmacht
Gestützt auf mehrere Agenturen, vermittelten dann die Zwei-Uhr-Nachrichten,
die ich trotz Telefonstreß formuliert habe, ein erstes realistisches
Bild von der neuen Lage in Berlin. Irgendwie muß diese Meldung die
RIAS-Spitzen in den Bars und auf den mitternächtlichen Sommerpartys
erreicht haben. Allmählich füllte sich die Redaktion. Kolleginnen
und Kollegen, die gar nicht auf dem Dienstplan standen, fanden sich ein.
Das Programm wurde geändert, und nun informierte der RIAS praktisch
pausenlos über die Geschehnisse mit Nachrichten pur rund um die Uhr.
Morgens um 6 Uhr war mein Dienst vorbei. Ich blieb noch eine Stunde länger,
weil ich viel zu aufgewühlt von den nächtlichen Erlebnissen
war und auch wissen wollte, wie die Schutzmächte reagieren würden.
Daß sie nach längerem Schweigen nur protestieren würden,
konnte ich mir an diesem Morgen nicht vorstellen, es hätte mir aber
nach der nächtlichen Begegnung mit dem Vertreter der US-Mission klar
sein müssen. Doch diese Fehleinschätzung teilte ich sicherlich
mit vielen Berlinern, auch mit etlichen Kommentatoren in der Stadt, die
in drastischer Form ihre Enttäuschung über die Amerikaner, Engländer
und Franzosen zum Ausdruck brachten.
Um 7 Uhr bin ich mit einem Taxi zum Brandenburger Tor gefahren. Dort sah
ich mit Wut und Trauer und Enttäuschung, wie Angehörige der
Grenztruppen der DDR mit Preßlufthämmern den Asphalt vor dem
Tor aufbohrten. Ich sah tatenlos zu und eine andere Verhaltensweise wäre
wider alle Vernunft gewesen. Aber das Hämmern klingt mir noch heute
in den Ohren, wenn ich an den 13. August 1961 denke.
[Potsdam,
Brandenburg -Quitzöbel
Neuwerben bei Havelberg/Elbe, damals DDR;
Juli 1961-Mai 1963]
Rudolf
Bentz
Republikflüchtige Aale
Die politische
und wirtschaftliche Lage in der DDR war - wieder einmal - schlecht oder
treffender gesagt, katastrophal. Nach der Methode "Haltet den Dieb!"
gab es in der Presse eine große Kampagne über "Schieber
aus dem Westen", die ihr Westgeld in Ostgeld umtauschten und dann
in Ost-Berlin hochwertige Waren und subventionierte Lebensmittel einkauften.
Die bereits stark angeschlagene Stimmung der Menschen wurde durch kleinliche
Schikanen noch mehr angeheizt, zum Beispiel gegenüber jenen, die
Mitte Juli 1961 zum Kirchentag nach West-Berlin fuhren.
Ende Juli 1961 setzten sich an einem einzigen Tag rund 1900 DDR-Bürger
nach West-Berlin ab, und einen Tag nach dem Mauerbau ließen sich
dort rund 7000 als Flüchtlinge registrieren. In Potsdam wurden die
Parkplätze gesperrt. Viele Leute kamen nämlich per Auto, stellten
ihr Fahrzeug dann einfach irgendwo ab und nahmen die S-Bahn nach West-Berlin.
Am 1. August zählte ich auf einem dieser Parkplätze 20 herrenlose
Autos. Die DDR blutete aus. Daß die Regierung dagegen etwas unternehmen
mußte, war verständlich, nur mit einer Mauer "zum Schutz
unserer Bürger vor den imperialistischen Klassenfeinden" hatte
keiner gerechnet.
Anfang August 1961 verbrachte meine Familie im Berliner Umland, in Prieros,
ihren Urlaub. Wir badeten, angelten, fuhren mit dem Kahn und sammelten
Pilze. Außerdem halfen mein Sohn und ich den Wirtsleuten bei der
Roggenernte. Radio hörten wir nicht, wir machten ja Urlaub. So erfuhren
wir im Laufe des 13. August erst von anderen Leuten, die aus Berlin gekommen
waren, von den Ereignissen. Wegen der aus unserer Sicht völlig unklaren
Situation beschlossen wir, den Urlaub abzubrechen und nach Hause zu fahren.
Gleich am nächsten Tag begab ich mich zu meiner Dienststelle, der
Wasserwirtschaftsdirektion Potsdam. Das Direktionsgebäude befand
sich damals in der Menzelstraße, also nahe der Glienicker Brücke.
Am Ufer der Havel liefen bewaffnete Posten Streife, die Brücke nach
West-Berlin, die den bezeichnenden Namen "Brücke der Einheit"
trug, war nicht mehr passierbar.
Anfang April 1961 hatte ich eine leitende Funktion in der Wasserwirtschaftsdirektion
Potsdam übernommen. Mein neues Aufgabengebiet erstreckte sich auf
wasserwirtschaftliche Aufgaben im Einzugsbereich der rund 340 Kilometer
langen Havel mit allen ihren Nebenflüssen, außer der Spree.
Vier Oberflußmeistereien, in Neuruppin, Neustadt/Dosse, Genthin
und Trebbin, mit 48 Schleusen zählten dazu. Die Anzahl der Wehre,
Schöpfwerke und dergleichen Bauten dürften einige Hundert betragen
haben.
Im Mai 1962 führte der wissenschaftlich-technische Beirat des Amtes
für Wasserwirtschaft seine jährliche Beratung durch, die diesmal
mit der Besichtigung und Erläuterung der Wehrgruppe Quitzöbel
- Neuwerben an der Mündung der Havel in die Elbe verbunden war. Etwa
30 Mitarbeiter der Bereiche Wasserwirtschaft, Wasserstraßenverwaltung
und Landwirtschaft, der Räte der anliegenden Kreise und Bezirke sowie
aus anderen Institutionen hatten sich im Tagungslokal in der Nähe
der großen Wehrgruppe nördlich von Havelberg versammelt. Als
Vertreter der Direktion, in deren Bereich sich die Anlage befand, nahm
ich an der Beratung teil. Nach der Mittagspause mit einem ansehnlichen
Essen begann die Diskussion. Dabei beklagte ein Vertreter der Binnenfischerei,
daß ein beträchtlicher Teil der Aale, nachdem sie sich mehrere
Jahre lang in Gewässern der DDR - sozusagen auf Staatskosten - gemästet
hätten, während ihrer großen Rückwanderung havel-
und elbabwärts hin zum Atlantik innerhalb der Bundesrepublik gefangen
und in kostbaren Rauchaal verwandelt würde. Dem sei entschieden entgegenzutreten.
Eine Fangeinrichtung am letzten großen Wehr auf DDR-Seite könne
Abhilfe schaffen.

Aalflucht
in den Westen? - Aber nicht mit uns! Also wurde die Wehranlage Quitzöbel
nördlich von Havelberg 1962 mit einer Fangvorrichtung versehen. Das
Wehr ist die letzte Staustufe der Havel vor der Einmündung in die
Elbe und hat sich 2002 im Hochwasserschutz bewährt. Das Foto aus
dem Jahr 2003 zeigt das alte, 1936 gebaute Wehr.
Alle, einschließlich
unser oberster Chef, hatten ein Einsehen in diese hochrangige Angelegenheit.
So wurde angewiesen, der an der Wehrgruppe ansässigen Fischereiproduktionsgenossenschaft
die Genehmigung zur Installierung einer Fanganlage am mittleren Wehrpfeiler
zu erteilen. Damit war das Thema vorerst beendet.
Ein Jahr später ereilte uns die Kunde, daß es an dieser Wehranlage
"brenne". Den wahren Grund aber konnte oder wollte niemand nennen.
Jedenfalls gab es dort ständig Reibereien. Ich fuhr nach Quitzöbel,
wo wir alle Interessenten zu einer Besprechung eingeladen hatten. Ich
leitete die Veranstaltung. Es gelang mir jedoch nicht herauszufinden,
worauf all das Gerede hinauslief.
In einer Pause nahm ich mir den alten Wehrwärter beiseite und fragte
ihn, was hier eigentlich gespielt werde. Zögernd ließ er die
Katze aus dem Sack. Mit ostpreußischem Akzent und hinter jedem Halbsatz
"doch" sagend, erzählte er: Einer der Wehrwärter habe
sich wunderbare Gänse herangefüttert, von denen gut die Hälfte
zum kommenden Weihnachtsfest den Weg nach West-Berlin nehmen sollte. Die
"Vögelchen" seien so friedlich oberhalb des Wehres dahingeschwommen,
bis sie plötzlich beschlossen hätten, sich lieber unterhalb
des Wehres zu tummeln. Alle 15 hätten sich erhoben, aber aus irgendeinem
Grund es nicht geschafft, über die Wehrbrücke zu fliegen, sondern
setzten unter der Brücke auf das Wasser auf. Dort habe sie die starke
Strömung in die etwa einen halben Meter über den Wasserspiegel
ragende Oberkante des Fangnetzes gedrückt, wodurch ihr Gänseleben
beendet worden sei. Das war es also!
Nach der Pause kamen wir relativ schnell auf einen Nenner. Die Fischer
konnten zwar ihre Fanganlage behalten, das Netz durfte aber nicht mehr
über die Wasseroberfläche hinausragen. Ganz abgesehen von den
Gänsen, hätte das Netz auch für Menschen zur Todesfalle
werden können. Korrekterweise hätte es überhaupt nicht
angebracht werden dürfen. Wurde aber eine Sache, wie in unserem Fall
die "republikflüchtigen" Aale, politisch verbrämt,
spielten Vorschriften nur noch eine untergeordnete Rolle.
[West-Berlin
- Grenzkontrollstelle Helmstedt-
Marienborn - Hannover, Niedersachsen;
1962]
Marianne
Doerfel
Blinde Passagiere
Am Jahresende
1961 war ich zurückgekehrt nach Berlin, um dort zu promovieren. Sieben
Jahre waren vergangen, seit ich sie 1955 schweren Herzens verlassen mußte.
Im ersten eigenen Auto fuhr ich nun durch die Stadt und fühlte mich
nicht mehr als "Insulaner". Jetzt konnte ich jederzeit Freunde
im Westen besuchen, wenn es mich hinauszog, eine Freiheit, die ich nach
den Jahren des dürftigen Studentenlebens sehr bewußt erlebte.
Damals konnte man nur mit dem Bus oder dem Interzonenzug in den Westen
reisen, brauchte dazu einen Interzonenpaß. Das änderte sich
zwar nach einigen Jahren, aber es war doch ein anderes Gefühl, einfach
mit dem Auto durch die Clayallee und die Potsdamer Chaussee in Richtung
Wannsee zum Kontrollpunkt Dreilinden fahren zu können und legal weiter,
über die bedrückende Grenze zu rollen.
Für die Fahrt von und nach Berlin über eine der Transitstrecken
mußte sorgfältig gepackt werden. Keine Drucksachen, vor allem
keine Zeitungen, keine Briefe, die offensichtlich erst im Westen eingesteckt
werden sollten. Bei Fotoapparaten mußte der Film herausgenommen
werden, sonst bestand der Verdacht, daß man unterwegs fotografiert
hatte. Anhalten war verboten, die Volkspolizei hielt sich in den Wäldern
versteckt, Streifenwagen fuhren die Strecke ab.
"Achtung! Hier Ende von West-Berlin!"
Schon wieder eines dieser lästigen Schilder. Der Grenzübergang
mit seinen trübseligen Baracken, improvisiert, etwas abseits die
Kontrollstation für die Alliierten.
"Personalausweis bitte! Wohin?" - "Nach Hannover."
"Allein?" - "Ja."
"Keine Bücher oder Zeitschriften dabei?" - "Nein."
Der West-Berliner Grenzpolizist nickt: "Weiterfahren, gute Reise!"
Auf der Ostseite, an der Kontrollstelle Drewitz, geht es umständlicher
zu, die Grenzpolizei ist auf erhöhte Wachsamkeit trainiert. Erste
Kontrolle im Fahrzeug, dann zur Baracke, aussteigen, Papiere aushändigen.
Transit-Passierschein ausfüllen, Stempel, Unterschrift und Einlaß
in die DDR.
Die Straße ist baufällig, auf den unebenen Betonplatten schaukelt
man dahin. Das Tempolimit ist überflüssig, man muß sowieso
darunter bleiben …
lrxleben,
Rottmersleben, Nordgermersleben, oft gehörte Namen, aber unbekannte
Orte. Es ist ein kühler Tag, Herbstwetter. Die Ortschaften wie ausgestorben
zwischen Waldstücken, Feldern, nirgendwo ist Licht zu sehen, kein
Traktor oder Pferdefuhrwerk ist unterwegs. Dann taucht der erste Wachturm
auf. Langsam heranfahren. Einige Wagen warten vor mir. Papiere bereithalten.
Der Grenzsoldat schlendert heran und fragt: "Transit von West-Berlin?"
"Ja." - "Allein?" - "Ja."
Ein kurzer Blick in den Wagen, dann erhalte ich die Papiere zurück.
Etwa 30 Meter weiter die nächste Kontrolle. Warten. Der vorderste
Wagen wird gerade auf blinde Passagiere untersucht. Motorhaube öffnen,
Gepäckhaube öffnen, Rücksitz hochheben. Prüfung des
Fahrzeugbodens mit dem schräggestellten Spiegel auf kleinen Rädern,
von vorne, von beiden Seiten, von hinten. Noch zwei Wagen, dann bin ich
dran.
Es dauert ziemlich lange, bis endlich der vorderste Wagen weiterfährt.
Schnell die Tür öffnen, vielleicht kann man etwas sehen. Tatsächlich,
da vorn muß irgendetwas Ungewöhnliches vor sich gehen. Neben
den beiden Grenzsoldaten steht ein Offizier, hinter ihm zwei junge Leute
in Zivil, ein Mann und eine Frau. Es sieht aus, als ob sie nicht dazu
gehören, vielleicht haben sie eine Panne. Der Kleidung nach zu urteilen
kommen sie aus Westdeutschland. Der Offizier spricht mit dem Fahrer des
Fahrzeugs vor mir. Als es abgefertigt ist, weiterfährt, werde ich
herangewinkt. Motor abstellen, aussteigen, Papiere. Handschuhfach öffnen,
Gummimatten hochheben, Blick in die Seitenfächer an den Türen,
unter die Sitze. Der Spiegelwagen wird um mein Auto geführt, das
Gepäck steht auf der Straße.
"So, Sie können wieder einpacken, hier sind die Papiere."
Jetzt tritt der Offizier an mich heran. Es ist ein Oberleutnant, gut dreißig
Jahre alt. Höflich fragt er mich, ob ich "die Herrschaften"
wohl bis zur Grenzbaracke mitnehmen könnte, mit ihren Papieren sei
etwas nicht in Ordnung, sonst müßten sie die gut 300 Meter
zu Fuß laufen. Er selbst würde auch mitkommen, "damit
die Sache in Ordnung geht".
Unter den Augen der Posten steigen alle drei bei mir ein. Sie haben es
offenbar eilig. Noch während ich auf der hinteren Bank Platz mache,
steigt der Oberleutnant hinten ein - und setzt sich prompt auf meine Handtasche,
ohne es zu bemerken! Die junge Frau setzt sich neben ihn, der junge Mann
vorne auf den Beifahrersitz. Wir fahren ab. Der Offizier macht sogleich
Konversation, spricht über das Wetter, den Straßenzustand,
die Annehmlichkeit, jetzt nicht zu Fuß gehen zu müssen, und
da er selbst mitkäme, könne die Angelegenheit rasch erledigt
werden. Ich frage die jungen Leute, ob sie gleich weiter mitfahren wollten.
Wohin ginge denn ihre Reise?
Nach Braunschweig, die Karten hätten sie schon.
Karten - ob sie Fahrkarten meinen? Oder Busfahrkarten? Aber wie waren
sie hierhergekommen?
Einen Wagen habe ich nicht gesehen, und der nächste Bahnhof mußte
eigentlich ziemlich weit entfernt sein. Vermutlich waren sie aus einem
Bus geholt worden. Doch in Gegenwart des Offiziers mag ich nicht weiter
fragen.
Bei der nächsten Kontrolle blickt der Posten mich stumm an, denn
auf dem Passierschein ist nur eine Person aufgeführt. Gelassen beruhigt
der Oberleutnant: "Das geht in Ordnung, Genosse, ich bringe nur die
Herrschaften zur Kontrollbaracke."
Kein Kommentar, meine Papiere werden zurückgegeben. Ankunft bei der
Kontrollbaracke. Nun muß ich aussteigen, in der Baracke alle Papiere
vorlegen. Auch meine Mitreisenden steigen aus, das erwartete Dankeschön
oder ein kurzes Abschiedswort bleiben jedoch aus.
"Sie brauchen nicht abzuschließen", sagt der Offizier,
"wir warten hier".
So gehe ich allein zur Baracke, finde mich eingekeilt in die Menge der
Wartenden, die meist stumm vor sich hinblicken. Langsam rücke ich
näher an das kleine Abfertigungsfenster, kann schließlich meine
Papiere hineinreichen. Wieder warten, bis zum Aufruf. Endlich wird mir
alles zurückgegeben, mit Stempel auf dem Passierschein. Als ich zu
meinem Auto zurückkehre, stehen meine Mitreisenden wieder - oder
noch? - daneben und blicken mir entgegen.
"Alles erledigt?" fragt der Offizier freundlich und steigt zu
meiner Überraschung wieder in meinen Wagen, ebenso die beiden anderen
Reisenden. Sie haben ostdeutsche Ausweise, das habe ich vorhin bemerkt.
Ob sie inzwischen bei einer anderen Abfertigung gewesen waren?
Stumm sitzen meine drei Fahrgäste neben und hinter mir. Der Offizier
hat sich tief in die Ecke gedrückt. Das Rückfenster beim VW-Cabriolet,
Baujahr 1959, ist nur klein, von hinten kann man nicht sehen, wie viele
Personen in dem Wagen saßen. Auch das hintere Seitenfenster ist
nicht sehr groß, das schwarze Stoffdach verengt den Aus- und Einblick.
Nach wenigen Metern letzte Kontrolle vor dem Schlagbaum: "Die Papiere
bitte!"
Der Posten blickt auf meinen Passierschein, sieht den Beifahrer und stutzt:
"Hier steht nur eine Person - wieso sehe ich hier noch eine, nein,
drei weitere Personen?"
Er fordert sie auf, die Ausweise zu zeigen, ich soll den Motor abstellen.
Meinen Ausweis hält er noch in der Hand. Schweigend reichen ihm meine
zivilen Mitfahrer ihre ostdeutschen Ausweise. Er studiert sie genau.
"So, und was ist mit dir, Genosse?"
Nun sucht der Offizier noch einmal mit dem schon bekannten Satz zu beruhigen,
es sei alles in Ordnung, die Papiere hätten überprüft werden
müssen, deswegen sei er mitgekommen.
Doch der Posten erklärt in breitem Sächsisch: "Die drei
auf dem Passierschein nicht aufgeführten Personen steigen jetzt aus!"
Zu mir: "Sie können sitzenbleiben."
Zögernd steigt der junge Mann aus, die Frau folgt ihm.
"Na und du, Genosse? Willst du nicht auch aussteigen?"
Der Offizier zeigt sich erstaunlich gelassen. "Wieso denn, ich bin
ja schon dabei, muß doch erst mal hier rauskommen, es ist ziemlich
eng ..."
Er ist großgewachsen und muß sich tief bücken, um aus
dem Fond herauszuklettern.
Der Posten beobachtet ihn jetzt mit einem hämischen, zufriedenen
Grinsen: "Na, das wollte ich doch meinen. War wohl Trick Nr. 17,
was?"
Gleich darauf reicht er mir meinen Ausweis zurück: "Sie fahren
jetzt weiter, da vorn ist die Schranke."
Er winkt dem Posten am Schlagbaum zu, ich lasse den Motor an. Meine Mitfahrer
blicken mich nicht einmal an, stehen da, mit versteinerten Gesichtern.
Als ich noch einmal zurückblicken will, drängt der Posten: "Worauf
warten Sie noch? Sie können fahren, habe ich doch gesagt!"
Also langsam, langsam das kurze Stück bis zum Schlagbaum, er ist
bereits hochgezogen. Zwischen den beiden großen Betonblöcken
rechts und links, die auf Schienen gelagert sind, um jede halsbrecherische
Durchfahrt sofort aufhalten zu können, holpert der Wagen über
die Grenze.
Ich bin zu benommen, um nachdenken zu können. Von dem Augenblick,
als die drei zum zweiten Mal bei mir einstiegen, habe ich nur noch mechanisch
reagiert. Ein Offizier der Volksarmee in voller Uniform besteigt zehn
Meter vor dem Schlagbaum, angesichts von ungezählten Zeugen mit und
ohne Uniform, ein VW-Cabriolet mit westdeutschem Kennzeichen - das ist
einfach unfaßlich!
Erst als das ovale Schild mit dem schwarzen Adler auf ockergelbem Grund
und der Umschrift "Bundesrepublik Deutschland" vor mir auftaucht,
beginne ich, wieder normal zu atmen. Wie immer weckt die grüne Uniform
der westdeutschen Grenzer ein tiefes Gefühl der Erleichterung. Aber
sprechen, berichten, kann ich nicht. Die Lähmung weicht nur langsam.
Der Übergang auf die glatte, ebene Fahrbahn ohne das ständige
dumpfe Geräusch heim Überfahren von abgebrochenen Kanten der
Betonplatten beruhigt. Kein Schütteln und Rütteln mehr, der
Körper entspannt sich.
Erst jetzt beginnt das Nachdenken. Trick Nr. 17. Ein Schlagwort der Zeit,
irgendwann aufgekommen. Es konnte nicht anders sein - das war ein tollkühner
Fluchtversuch gewesen!
Ahnungslos habe ich mitgemacht. Der Oberleutnant hatte vermutlich den
Dienstplan gekannt und mit einem anderen Posten bei der letzten Kontrolle
gerechnet. Vielleicht mit einem Bekannten, der eingeweiht war.
Immer noch zweifele ich an den Fakten, die eine so deutliche Sprache sprachen.
Immer wieder rufe ich mir die letzte Szene ins Gedächtnis. Es schien,
als wollten sie mit mir weiterfahren, auch nach der letzten Kontrolle.
Weiterfahren in den Westen. Fast hätten sie es geschafft, der Posten
an der Schranke prüfte nicht mehr, er war nur für das Öffnen
und Schließen zuständig. Gleich hinter mir war die Schranke
wieder heruntergegangen, das hatte ich im Rückspiegel gesehen. Meine
drei Fahrgäste konnte ich nicht mehr entdecken. Wo mochten sie jetzt
sein? Schon beim Verhör?
Nach der
Ankunft bei Freunden in Hannover wurde mir allmählich klar, welches
Risiko der Offizier mir aufgebürdet hatte. "Deinen Wagen hättest
du gleich verkaufen können", hieß es. "Die haben
doch die Nummer vom Chassis und vom Motor notiert oder fotokopiert und
deinen Führerschein auch, mit allen Angaben, du hättest überhaupt
nicht mehr über die Grenze fahren können. Fluchthelfer - und
dann noch bei einem Offizier der Volkspolizei, das gibt mindestens fünf
Jahre! Die hätten dir doch nie im Leben geglaubt, daß das nicht
verabredet war, schon dein Studium an der Hochschule für Politik
macht dich verdächtig."
Überhaupt, so fanden sie, war es erstaunlich, daß man mich
so ohne weiteres hatte die Reise fortsetzen lassen. Der Posten war wohl
so überrascht von seinem unglaublichen Fang, daß er mich darüber
vergessen hatte. "Du kannst froh sein, daß er sie rausgeholt
hat, so leid es einem auch tut für die armen Leute."
Bei der Rückfahrt,
einige Wochen später, flatterten die Nerven. Zögernd ging ich
in die graue Grenzbaracke mit den verhangenen Fenstern, reichte meine
Papiere dem Uniformierten hinter dem Fenster. Jetzt mußte es sich
entscheiden - würde man mich zum Verhör holen? Hätte ich
vielleicht doch lieber den Motor austauschen sollen?
Ich mußte lange warten, so schien mir, länger als andere. Aber
dann wurde meine Nummer aufgerufen, die Papiere wurden zurückgereicht,
ohne weitere Kommentare. Nun begann die Phantasie zu arbeiten. Vielleicht
hatten sie in Berlin angerufen, von dort einen Wagen losgeschickt, der
mich unterwegs anhalten würde, um kein Aufsehen an der Grenze zu
erregen, oder einer fuhr hinter mir her, oder es nahm mich jemand am Grenzübergang
Drewitz in Empfang?
Es wurde eine unheimliche Fahrt. Doch es gab keine Folgen. Was immer bei
dem Verhör gesagt worden war, der "Fluchtwagen" blieb unbeachtet.
Auch bei der nächsten und übernächsten Reise gab es keine
Fragen und die Nervosität schwand. Nur die Erinnerung blieb, an drei
Unbekannte, die alles gewagt und alles verloren hatten.
(In "Mauer-Passagen" ist noch eine weitere Geschichte von Marianne Doefel veröffentlicht. In "Kannitverstan" erzählt sie von einem Anwerbungsversuch der Staatssicherheit beim Grenzübergang Bornholmer Straße nach Ost-Berlin.)
[West-Berlin
- Kyritz, Brandenburg -
Neustadt/Dosse - Kontrollpunkt Drewitz;
- damals DDR,
60er bis 80er Jahre]
Hans Peter
Kutscha
Meine Volkspolizisten
"Was?
Sie haben bei der Grenzkontrolle immer in der Autoschlange gestanden,
die am langsamsten abgefertigt wurde? Das kann gar nicht sein! Da hätten
wir uns doch treffen müssen."
Jeder Zeitgenosse, den ich vor oder nach der Wende über seine Erlebnisse
an der deutsch-deutschen Grenze befragte, reagierte so oder ähnlich.
Vor dem Berlin-Abkommen der Alliierten von 1971 gestaltete sich eine Transitreise
von West-Berlin durch die DDR in die Bundesrepublik äußerst
schwierig. Sie war mit langwierigen Prozeduren verbunden. Von den zahlreichen
Begegnungen mit den Grenzpolizisten verliefen die meisten "normal".
Die bizarren aber haben sich fest in mein Gedächtnis eingegraben
…
Der Pfiffikus
Mein Freund und ich wollten zum Fischen nach Ratzeburg. Am Kontrollpunkt
Staaken rückten wir, während das Auto auf dem Parkplatz stand,
zu Fuß inmitten der Menschenschlange langsam Schritt für Schritt
in Richtung Grenzbaracke vor. Endlich erreichten wir einen der Schalter.
Der hinter dem Fenster sitzende uniformierte Zollbeamte heischte, den
Grenzbestimmungen der DDR folgend, von uns Auskunft über unsere Westgeldbeträge
und andere mitgeführte Wertgegenstände. Die Frage nach einem
Fotoapparat hatte mein Freund bereits verneint. Er ergänzte freiwillig:
"Wir führen aber einen Bootsmotor mit."
"Welche Marke?" wollte der Zöllner wissen.
"Evinrude."
"Wie heißt das Ding?"
Langsam, gleichsam buchstabierend, wiederholte mein Freund: "Evinrude!"
Der Beamte schien etwas verwirrt. Nach kurzem Zögern entschied er:
"Is' gut, ich schreib' einfach: Ein Bootsmotor!"
Der sächsische
Spiegel
Bei erfahrenen Ost-West-Reisenden standen Grenzpolizistinnen im Ruch,
strenger zu sein als ihre männlichen Kollegen. Ich machte eine andere
Erfahrung.
Wer von den Westberliner Autofahrern kannte ihn nicht, den großen,
rechteckigen Spiegel, der auf einem Fahrgestell mit zwei Rädern ruhte,
die reflektierende Fläche nach oben. Gesteuert wurde dieses Kontrollinstrument
mit einer langen geschwungenen Stange, was dem Kontrolleur erlaubte, jeden
Quadratzentimeter des Fahrzeug-Unterbodens zu beäugen. Meist führte
der Beamte auch einen langen, biegsamen Stab aus geflochtenem, weißlackierten
Draht mit sich. Er fädelte ihn in den Stutzen des Benzintanks ein.
Durch intensives Stochern versuchte der Polizist, eine eventuell an diesem
Ort versteckte Konterbande aufzuspüren.
An einem Sonntagmorgen wollten meine Frau und ich nach Stendal reisen.
An der Kontrollstelle Drewitz unterwarfen wir uns den üblichen Prozeduren
und reichten unsere Reisedokumente aus dem Seitenfenster. An diesem Tag
führte eine Polizistin die Spiegelkontrolle durch. Gleich nach ihrem
ersten prüfenden Hinschauen kam die kategorische Aufforderung: "Steichen
Se bidde mal aus!"
Ich gehorchte mit mulmigem Gefühl in der Magengrube.
"Gucken Se mal nei!"
Ich guckte. Aufgrund ihres Tonfalls erwartete ich, das Spiegelbild eines
fluchtbereiten, am Unterboden meines Autos sich festkrallenden Einheimischen
zu erblicken. Gott sei Dank, Fehlanzeige! Ich konnte nichts Auffälliges
entdecken. Fragend sah ich zur filia saxoniae hinüber.
Leicht den Kopf schüttelnd, meinte sie, nunmehr mit einem gewissen
mitleidigen Ton in der Stimme: "Sähn Se wärklich nischt?"
"Nein", erwiderte ich nervös und zermarterte mein Gehirn.
Man konnte ja nie wissen, ob nicht eine neuartige Schikane auf einen wartete.
"Nu! Ihr Ausbuff hat zwee gleene Löcher, dän wärn
Se wohl balde rebariern lassen müssen!" lautete die verblüffende
Aufklärung.
Aufatmen. Erleichtert bedankte ich mich von ganzem Herzen für den
wohlgemeinten Rat. Mit einem verschmitzten Lächeln und dem Wunsch
für einen angenehmen Aufenthalt in der DDR wurden wir von ihr in
Gnaden entlassen.
Der Schizophrene
Einmal sollte uns die Fahrt in den kleinen brandenburgischen Ort Neustadt
an der Dosse führen. Unser Kirchenchor gedachte, dort bei der Einweihung
einer Orgel mitzuwirken. Auf dem Hinweg wollten wir zudem den legendenumwobenen,
mumifizierten Ritter Kahlbutz besuchen. Die Sänger fuhren getrennt
in eigenen PKWs, eine gemeinsame Busfahrt wäre von den DDR-Behörden
nicht genehmigt worden. Schon gegen fünf Uhr morgens bogen wir am
Kontrollpunkt Staaken in die vorgeschriebene Fahrspur ein. Wir waren um
diese Zeit die einzigen "Kunden".
Aus dem Schlagschatten einer Baracke löste sich eine Gestalt. Wir
harrten der üblichen Rituale. Der Grenzer legte grüßend
die Hand an die Mütze: "Guten Morgen! Ihre Papiere bitte!"
Mit scharfem Blick verglich er aufmerksam das Foto im Ausweis mit dem
lebenden Original.
"Wohin fahren Sie?"
"Nach Neustadt an der Dosse."
"Komisch", bemerkte er, "ist da heute was Besonderes los?
Sie sind bereits das dritte Auto nach Neustadt!"
Wir gaben uns verwundert: "Keine Ahnung!"
Er reichte uns die Papiere zurück und verwies auf das seitlich gelegene,
niedrige Holzgebäude. Dort sollte der 1:1-Pflichtumtausch von 25
DM pro Person in Mark der DDR stattfinden. Er selbst machte sich ebenfalls
in Richtung Baracke auf den Weg. Wir betraten den Flachbau. Wer saß
dort barhäuptig hinter dem Schalterfenster? Unser Grenzpolizist!
Meine Frau schob ihm die Geldscheine zu. Er jedoch machte keine Anstalten,
sie entgegenzunehmen. Seelenruhig setzte er seine Dienstmütze auf,
wünschte uns erneut einen "Guten Morgen" und verlangte
unsere Reisedokumente.
Ungläubig blickten wir erst uns, dann ihn an. Wollte er uns auf den
Arm nehmen? Vor eben einer Minute hatte er uns doch nach ausführlichem
Studium unsere Ausweise wieder in die Hand gedrückt. Zeit zum Überlegen
blieb nicht, denn schon deutlich ungnädiger und mit erhöhtem
Stimmaufwand wiederholte er: "Ihre Dokumente bitte!"
Im Geiste den Kopf schüttelnd, taten wir, wie uns geheißen.
Unbeeindruckt von unserer Verwirrung verglich er abermals die Fotos mit
unseren Gesichtern. Danach gab er Ausweise und Einreiseberechtigungen
zurück und begann gleichmütig die Formalitäten des Geldumtausches
abzuwickeln.
Der Pädagoge
An einem Dezembertag brachen wir von West-Berlin aus zum Besuch des Weihnachtsmarktes
nach Lübeck auf. Seinerzeit war der Ausbau der Autobahn Richtung
Hamburg noch nicht abgeschlossen. Man fuhr auf der Bundesstraße
5 bis zum Grenzübergang Lauenburg. Da ich mehrmals im Jahr zum Fischen
in den Norden fuhr, kannten mein Wagen und ich diese Strecke aus dem Effeff.
Etwa einen Kilometer vor dem eigentlichen Grenzgebiet stoppte uns ein
Grenzbeamter. Natürlich hielt ich brav an und reichte unaufgefordert
die Reiseunterlagen aus dem Auto. Der Vopo nahm sie und sagte nach einigen
Minuten genauen Studiums der Papiere wie beiläufig: "Wenn Sie
die Straßen der DDR befahren, Herr Kutscha, müssen Sie auch
die Vorschriften der DDR befolgen!"
Ich bejahte pflichteifrig, war mir aber keiner Schuld bewußt.
"Steigen Sie bitte aus!" verlangte der Grenzer mit vorwurfsvoller
Miene.
Mit einiger Beklemmung folgte ich der Aufforderung.
"Drehen Sie sich um, und gehen Sie die Straße zurück,
und zwar solange, bis ich Halt rufe!"
Was sollte ich machen? Ich gehorchte und kam mir dabei - als gestandener
Lehrer - wie ein ungezogener Schüler vor, der in die Ecke geschickt
wird. Nach ungefähr fünfzig Metern erscholl das "Halt!",
dann der Ruf: "Umdrehen!"
Ich parierte.
"Was sehen Sie auf der rechten Straßenseite?"
Langsam erschien mir die Situation grotesk. Ich brüllte zurück:
"Ein Schild mit der Aufschrift: Halt! Weiterfahrt nur auf Handzeichen."
"Jetzt können Sie wieder zurückkommen!"
Ich konnte mir den Einwand nicht verkneifen: "Dieses Schild hat in
der vorigen Woche noch nicht dort gestanden! Ich bin diese Strecke doch
erst am Sonnabend gefahren."
"Stimmt", gab er ungerührt zu. "Da sehen Sie mal,
wie wichtig es ist, ständig die Augen offen zu halten! Ich nehme
an, Sie beherzigen meine Mahnung, denn das nächste Mal kommen Sie
mir nicht so glimpflich davon!"
Er gab die Papiere zurück, hob seine Hand grüßend an die
Dienstmütze und hieß mich weiterfahren.
Die Stimme
vom Turm
"Ein Spaziergang wird uns guttun!" Meine Frau hatte recht, bei
diesem strahlenden Sonnenschein mußte man einfach ins Grüne.
Wenig später stand unser Auto auf dem Parkplatz in der Nähe
des Hubertussees in Frohnau. Der kleine Teich liegt in einem West-Berliner
Waldstück, das damals wie ein Auswuchs in das Gebiet der DDR hineinragte.
Die Erbauer der Befestigungen hatten diese hier im Umfeld des Sees einige
Meter vor der Grenze errichtet. Nur die von den westlichen Behörden
aufgestellten Schilder: "Halt! Sie verlassen den französischen
Sektor!" deuteten auf den tatsächlichen Grenzverlauf hin.
"Laß uns einen Blick über die Grenzanlagen tun",
schlug meine Frau vor, und schon war eine kleine, sandige Anhöhe
erklommen. Höchstens dreißig Meter vor uns begannen die Sperranlagen:
der hohe Drahtzaun, danach der Stacheldraht. Dahinter liefen große
Wachhunde unruhig, aber aufmerksam an langen Führungsleinen hin-
und her. Nach einem schmalen, geharkten Sandstreifen zog sich die Betonstraße
für die Fahrzeuge der Nationalen Volksarmee hin, und, etwas weiter
entfernt, ragte der große Wachturm aus Beton in den blauen Himmel.
Seine Fenster, hoch oben angebracht, gestatteten den östlichen Wachposten
einen ungehinderten Blick nach allen Seiten. Wir verharrten vielleicht
einige Sekunden an diesem Platz, als uns eine herrische Stimme zusammenfahren
ließ. Über Lautsprecher scholl es vom Wachtturm herüber:
"Bürger der selbständigen Einheit Westberlin! Sie befinden
sich widerrechtlich auf dem Staatsgebiet der Deutschen Demokratischen
Republik! Wir fordern Sie auf, unverzüglich die Grenzverletzung zu
beenden und das Hoheitsgebiet der Deutschen Demokratischen Republik zu
verlassen!"
Gleich danach wiederholte die Stimme in demselben drohenden Tonfall den
Befehl.
Wir taten dem unerbittlichen Grenzschützer den Gefallen und bewegten
uns die zwei Meter bis hinter das Schild. Mehr aus Trotz denn aus Neugier
verharrten wir noch eine Weile, bis wir betroffen zurück zum Auto
schlenderten.
[Halle/Saale
-Grünheide bei Erkner, Brandenburg - Autobahnkontrollpunkt Beelitz,
damals DDR - Berlin-Grünau - Grenzbahnhof Berlin-Friedrichstraße;
1969 - Mai/Juli 1970]
Hans-Joachim
Musiol
Vorkommnisse
Von 1968
bis 1972 studierte ich an der Universität in Halle an der Saale Pädagogik,
Französisch und Geschichte. Das Literaturangebot in Französisch
war mehr als dürftig. Im "Internationalen Buch", der einzig
passenden Buchhandlung, hatten die Romanistikstudenten die zwei Regalreihen
schnell durchgesehen. Besonders haperte es an einsprachigen Wörterbüchern
und an Belletristik. Wir bekamen eine lange Liste an Pflichtlektüre,
aber davon gab es kaum etwas zu kaufen. Selbst die Lehrbuchreihe, mit
der ein wesentlicher Teil der Sprachausbildung bestritten wurde, war nicht
im DDR-Buchhandel erhältlich. Also mußte das alles "besorgt"
werden, und das ging nur über Kontakte ins westliche Ausland. Einerseits
hieß es "Abgrenzung vom Klassenfeind", andererseits war
jeder von uns das gesamte Studium über damit beschäftigt, seine
"Westkontakte" zu intensivieren - vor allem nach Frankreich.
Selbst die Dozenten und Lehrer hielten uns dazu an, alle Möglichkeiten
zu nutzen, um mit der Sprache immer wieder in Kontakt zu kommen und sich
"Sachen mitbringen" zu lassen.
Unser größtes Problem war die Anwendung der Fremdsprache außerhalb
des Institutes. Eine Reise oder gar ein Studienaufenthalt in Frankreich
- undenkbar!
Deshalb konnte man zur Leipziger Messe an französischsprachigen Ständen
oft Mitstudenten treffen. Ich hatte mir im lnterhotel in Halle, das zur
Messezeit ausschließlich mit westlichen Gästen belegt war,
einen Job gesucht: Kofferträger, nachts Schuhputzer, Autowäscher
und Dolmetscher an der Rezeption. Alles, was im Hotel französischsprachig
ablief, regelte ich, der Hotelboy. Ich war zufrieden, konnte ich doch
Französisch sprechen, genoß eine gewisse Sonderstellung und
die Trinkgelder konnten sich auch sehen lassen, zumal es Westgeld gab!
Eine andere Möglichkeit des Sprachkontakts eröffnete sich uns
Studenten bei Dolmetschereinsätzen in den Semesterferien. Die DDR
wollte ihre Errungenschaften auch im westlichen Ausland publik machen.
So kam es unter Mithilfe der "Gesellschaft DDR - Frankreich"
zu einem Schüleraustausch, allerdings nur einseitig. Das war Klassensolidarität:
arme französische Arbeiterkinder, die es sich nicht leisten konnten,
in die Ferien zu fahren - die SED machte es möglich. In Frankreich,
von der Kommunistischen Partei organisiert, bezahlten die Franzosen nur
einen Bruchteil dessen, was der Aufenthalt eigentlich kostete. Dabei waren
es recht komfortable Ferien; viel, sehr viel, wurde geboten! Auf diese
Weise verbrachten jedes Jahr Tausende junger Franzosen ihren Sommerurlaub
in der DDR. Im Sommer 1969 verlebte ich als Betreuer vier wunderschöne
Wochen im Betriebsferienlager des VEB Funkwerke Köpenick in Grünheide
bei Erkner. Für einen angehenden Lehrer war das einfach perfekt!
Arbeit mit Kindern, von früh bis abends Französisch, und dazu
wurde diese Tätigkeit auch noch bezahlt!
Mit Denis, dem französischen Betreuer der etwa 20köpfigen Gruppe
- offiziell Delegation genannt - bahnte sich bald eine Freundschaft an.
Schon während dieses ersten Einsatzes wurde angefragt, ob ich im
kommenden Jahr wieder zur Verfügung stünde. Natürlich sagte
ich zu, und auch Denis wollte im nächsten Jahr wiederkommen. In unzähligen
Gesprächen mit den französischen Gästen fiel mir auf, daß
die Franzosen fast nichts von der DDR wußten. An Politik waren sie
nicht sonderlich interessiert und bei der obligatorischen Darstellung
der "Errungenschaften" unseres sozialistischen Staates hörten
sie nur höflich zu. In Berlin nun wurde aber DDR-Politik sichtbar
durch Mauer und strenges Grenzregime. Das stieß in der Regel auf
wortloses Darüberhinwegsehen. In den vielen Jahren, die ich als Dolmetscher
gearbeitet habe, gab es kaum einen französischen Jugendlichen, der
zur Teilung Berlins Zustimmung geäußert hätte.
Und da gab es noch eine Kleinigkeit, oder sollte man dazu besser sagen,
eine grobe Unhöflichkeit?
Normalerweise wird ein Gast nicht an der Bahnhofstür, sondern am
Zug, verabschiedet. Aber was war schon normal im Grenzbahnhof Friedrichstraße?
- Nicht auf dem Bahnsteig, der schon Grenze war, sondern im "Tränenpavillon",
der Ausreisehalle für S- und U-Bahn und Fernzüge in Richtung
West-Berlin, hatte das zu geschehen. So wurden viele positive Eindrücke,
die die Jugendlichen mit in ihre Heimat nahmen, zunichte gemacht - eine
Meisterleistung unserer Führung, der politisches Fingerspitzengefühl
fremd war.
Jeden Sommer
kamen einige hundert junge Franzosen nach Berlin, und das bedurfte einiges
an Vorbereitungen. Für die Ferienlageraktion im Sommer 1970 wurde
Denis von der französischen Seite beauftragt, letzte Einzelheiten
mit den dafür verantwortlichen Genossen in Berlin abzustimmen. Er
wurde dazu offiziell eingeladen. Eines Tages im Mai erhielt ich einen
Anruf: "Ich bin jetzt in Köln auf der Fahrt nach Berlin. Wenn
es dir möglich ist, würde ich dich gern zu den Absprachen als
Dolmetscher mitnehmen."
Da ein Student zeitlich recht flexibel ist, sagte ich freudig zu. Er wolle
in sechs bis sieben Stunden in Halle sein, ich müßte nur zusteigen.
Und so war es auch. Freude über das Wiedersehen, kurze Pause mit
ein paar belegten Broten und Kaffee, hinein in seinen auffallend gelben
Renault R4 und ab ging es über die Autobahn Richtung Berlin. Wir
kamen aber nur bis zur Kontrollstelle Beelitz. Dort stoppten Volkspolizisten
unsere recht flotte Fahrt. Ich vermutete eine Geschwindigkeitsübertretung,
denn ab Halle fuhren wir auf der Autobahn konstant 130 km/h, 100 km/h
waren aber nur erlaubt. Denis mußte aussteigen und reichte dem Vopo
seine Papiere. Ich wollte ebenfalls aus dem Wagen, aber mir wurde per
Handzeichen angedeutet, im Auto zu bleiben. Da es sehr warm war, kurbelte
ich die Scheibe herunter und konnte auch hören, was sich abspielte.
Der obligatorischen Nummernschildüberprüfung folgte zuerst eine
technische Inspektion: Licht, Abblendlicht, Blinker, Hupe, Motorklappe
auf. Denis konnte mir zuraunen: "lls sont fous!" ("Die
sind wohl verrückt!")
Daraufhin wurde er barsch angefahren, daß er sich im Kontrollbereich
nicht mit Privatpersonen zu unterhalten habe. Denis verstand es nicht,
also redete er weiter, worauf ich sagte, er hätte jetzt mit mir Redeverbot.
Nun wurde auch mir bedeutet zu schweigen.
Immer wieder wurde der Paß von Denis durchgeblättert, die Zählkarte
untersucht, und weil das länger dauerte und der Kontrolleur wieder
und wieder den Kopf schüttelte, gesellte sich ein zweiter Vopo hinzu
und murmelte: "Der muß die Transitstrecke verlassen haben,
hier, der darf nur von Marienborn nach West-Berlin."
Beide gingen um das Auto, beglotzten nochmals die Kennzeichen: "Da
stimmt was nicht, und dann versteht der uns nicht, hole mal den ..."
Ein Name wurde genannt.
Nach einigen Minuten erschien der dritte Vopo, ein Offizier. Der ließ
sich kurz Bericht erstatten‚ fragte nach, ob der da - ich war gemeint
- schon kontrolliert sei. "Noch nicht? Dann mal los!"
Mein "Paßport" wurde verlangt. Durch das Fenster reichte
ich meinen blauen Personalausweis der DDR.
"Was? Sie sind ja Bürger der DDR! Was machen Sie in einem westlichen
Fahrzeug - wollten wohl abhauen?"
Ich mußte aussteigen und wurde "zwecks Klärung dieses
Sachverhaltes" vorläufig festgenommen. Wir zwei mußten
uns nun, bewacht von einem Polizisten, neben das Fahrzeug stellen. Der
zweite durchsuchte das Auto und der Offizier verschwand in der Baracke,
wahrscheinlich wollte er telefonieren. Nach einer Weile tauchte er wieder
auf, immer noch unsere Papiere in der Hand. Endlich konnte ich ihm erklären,
wie ich in dieses Auto gekommen war und warum.
"Wenn das so ist, wie Sie sagen, angenommen, das ist so, dann ist
das eine Verletzung des Transitabkommens, und wenn der Franzose da gut
rauskommt aus dieser Sache, dann können Sie übersetzen, daß
er über West-Berlin die DDR zu verlassen hat! Doch das werden die
Genossen klären, die ich verständigt habe. Bis dahin bleiben
Sie bei uns."
Jetzt wurde ich wirklich ungeduldig, mir reichte es, und ich forderte
von ihm den gefalteten Briefbogen, der in Denis' Paß lag. Den wollte
ich übersetzen. Knurrend reichte er mir das Blatt, die offizielle
Einladung, die ich jetzt auf Deutsch vorlas. Sein Gesicht wurde immer
länger. Auch war da eine Telefonnummer angegeben, die bei auftretenden
Problemen anzurufen sei. Ich verlangte, mir dieses Telefonat zu ermöglichen.
Unsicher geworden, brachte mich der Offizier in sein Dienstzimmer, und
bald hatte ich einen Herrn vom Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten
der DDR am Hörer. Der fiel aus allen Wolken, als ich ihm mitteilte,
daß wir zwei vorübergehend festgenommen worden seien. Er könne
aber leider den bewaffneten Organen keine Weisung erteilen, deshalb müsse
er über den Dienstweg gehen ..., in ein paar Minuten aber sei die
Sache geklärt.
Nun wurde auch Denis hereingeführt, und ich teilte ihm kurz die Entwicklung
mit. Der Vopo wurde zusehends freundlicher, er bot Zigaretten an, wir
lehnten dankend ab. Nach nicht einmal zehn Minuten klingelte das Telefon.
Am anderen Ende der Leitung mußte wohl die Luft brennen, ich konnte
einige Wortfetzen mithören und die waren nicht gerade angenehm für
den Offizier, der mit hochrotem Kopf in strammer Haltung immer wieder
in den Telefonhörer hineinstammelte: "Jawohl, wird sofort erledigt
... jawohl, zu Befehl, Genosse General, jawohl ..."
Damit war das Telefonat beendet. Immer wieder sich entschuldigend brachte
uns der Offizier zum Auto. Von den anderen beiden Vopos war nichts zu
sehen, die hatten wohl Wind bekommen und sich schleunigst verzogen.
Später sagte Denis im Auto zu mir: "Unglaublich, wie die mit
uns umgesprungen sind. Wie müssen die sich erst aufführen, wenn
man nicht offizieller Gast ist ..."
Denis, damals Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs, trat vier
Jahre später aus dieser Partei aus. Seine Gründe teilte er mir
bei unserem letzten gemeinsamen Ferienlagereinsatz mit.
Im Sommer dieses Jahres wurden wir in einer Schule an der Regattastraße
in Grünau untergebracht, wunderbar gelegen und nicht weit zum Strandbad
und zur S-Bahn. Dort logierte ebenfalls eine italienische Kinder- und
Jugendgruppe. Die vier Wochen vergingen mit Baden, Sport, Besichtigungen
und Ausflügen wie im Fluge. Besonders beliebt waren die abends von
uns organisierten Discos, die auch von einer Menge deutscher Jugendlicher
besucht wurden. Es waren für uns alle wunderschöne Tage!
Am Morgen des Abreisetages dann die allgemeine Hektik, die letzte gemeinsame
Fahrt mit dem Bus zum Bahnhof Friedrichstraße. In der Ausreisehalle
herrschte ein unglaubliches Gewühl. Hunderte Kinder und Jugendliche
warteten auf die Ausreisekontrolle. Die verschiedensten "westlichen"
Sprachen schwirrten durch die Luft. Schließlich waren die Franzosen
an der Reihe. Ein Grenzoffizier las Name für Name vor, und dann ging
der zu Kontrollierende mit seiner carte d'identité, seinem Personalausweis,
durch die Kontrolle zum Transitbahnsteig. Nun kam meine Gruppe zur Abfertigung.
Händeschütteln, Umarmung, Tränen. Plötzlich fluchte
der vor mir stehende Offizier, der die Namen aufrief: "Mistdurchschlag,
kaum zu lesen ... wer soll denn das aussprechen können?" Offenbar
war er in diesem Durcheinander sehr genervt. Schweißperlen rannen
über sein Gesicht. Bei einem Namen war es dann soweit. Keiner wußte,
wen er da eben aufgerufen hatte - die Kinder lachten. Der Grenzer blickte
sich hilfesuchend um, der Kontrollablauf stockte.
Da wir die gesamte Zeit hinter ihm gestanden und uns schon über ihn
amüsiert hatten, klopfte ich ihm auf die Schulter: "Geben Sie
her, ich lese vor und Sie brauchen nur noch zu kontrollieren."
Der Offizier starrte mich einen Augenblick verwundert an und reichte mir
dann wortlos die Liste. Also las ich die einzelnen Namen vor, verabschiedete
mich dabei von den Kindern und der Grenzer kontrollierte.
"Kommst du noch mit zum Zug?" - Jedesmal mußte ich diese
Frage verneinen. Der letzte Franzose ging durch die Sperre, letzter Gruß
- das war's. Vier Wochen anstrengende, aber auch schöne Arbeit lagen
hinter mir. Ich gab die Namensliste zurück. Eine andere französische
Gruppe wurde jetzt abgefertigt, und der Offizier bat mich, deren Namen
ebenfalls zu lesen. Wieder ging Kind für Kind durch die Sperre. Mittlerweile
hatte sich die Ausreisehalle stark geleert, und nur einige Privatreisende
strebten der Kontrolle zu. Ich gab die Blätter zurück.
"Danke, Mäsjö, merci", der Offizier blickte auf seine
Armbanduhr. "In fünf Minuten" - er zeigte die fünf
Finger -, "schnell! Zug fährt gleich ab!"
Dabei schob er mich durch den Paßkontrollgang. Jemandem von seiner
Truppe rief er zu: "Braucht nicht mehr - habe ich schon - der muß
noch zum Zug hoch", und er bugsierte mich weiter durch den schmalen
Gang auf eine Tür zu, die sich wie von Geisterhand öffnete.
Was ging mir in diesen Sekunden nicht alles durch den Kopf! Ich brauchte
nur den Stufen zu folgen - schon wäre ich in West-Berlin. Trennung
von Eltern und Bruder, was ist mit dem Studium ...?
Nein, das kam zu plötzlich, außerdem hatte ich zu dieser Zeit
nie ernsthaft über ein Weggehen nachgedacht. Wie angewurzelt blieb
ich stehen, drehte mich um: "Ich bin kein Franzose, ich bin nur der
Dolmetscher!"
Der Uniformierte hatte sofort begriffen, wurde aschfahl, schaute sich
kurz um und raunte mir zu: "Um Gottes willen, zu keinem ein Wort,
das kostet uns Kopf und Kragen!"
Ich nickte und ging die paar Meter zurück. Er blieb mitten im Gang
breitbeinig stehen, offenbar hatte er sich wieder gefaßt. Draußen
nahm mich der Lärm der verkehrsreichen Friedrichstraße auf.
Bis zum Fall der Mauer wußten nur zwei Menschen von diesem Vorkommnis:
der Offizier und ich.
Leipzig,
Sachsen, damals DDR - Köln, Rheinland;
August 1973 - Frühjahr 1974]
Helga
Brachmann
Angst
"Was
für ein gemeiner Scherz", war mein erster Gedanke. Was hatte
die Männerstimme eben am Telefon gesagt? - "Ihre Tochter Barbara
ist in die Bundesrepublik geflüchtet."
Das konnte doch nicht wahr sein! Wie sollte ein junges Mädchen den
Stacheldraht, die Selbstschußanlagen und die Mauer überwinden?
An der Grenze wurde doch scharf geschossen! Und ein Schlupfloch im Eisernen
Vorhang gab es doch auch nicht! Republikflucht im Jahr 1973 - das war
lebensgefährlich, das war strafbar, auch für Mitwisser und Helfer.
Dann hatte der anonyme Anrufer hinzugefügt, Barbaras Freundin sei
auch geflohen, ich solle der Mutter Bescheid geben, er wußte die
Adresse. Ach ja - langsam konnte ich meine Gedanken ordnen -, ich hatte
nach seinem Namen gefragt, er aber hatte stattdessen das Gespräch
mit den Worten beendet: "Barbara läßt Sie grüßen,
Sie sollen ihr nicht böse sein und sie hätte Sie sehr lieb!"
Das war eine typische Redewendung meiner Tochter, keine Frage. Wieder
und wieder nahm ich die kurze Mitteilung zur Hand, die ich abends auf
der Flurgarderobe gefunden hatte: "Bleibe übers Wochenende bei
Joachim, komme übermorgen zurück. Tschüs! Babs."
Joachim war ihr Freund, er besaß kein Telefon. Hoffentlich war meine
Tochter dort, am anderen Ende der Stadt!
Qualvolles Grübeln bis zum Morgen. Oder war Bärbel gar einem
Verbrechen zum Opfer gefallen und der Täter wollte mich durch seinen
Anruf auf eine falsche Spur führen?
Wie oft hatte ich meine Jüngste gebeten, sich nicht von Fremden im
Auto mitnehmen zu lassen. Oder sollte gar dieser Rheinländer eine
Flucht organisiert haben?
Barbara hatte mir von einem "tollen West-Mann" vorgeschwärmt,
den sie in einer Gaststätte während der Leipziger Frühjahrsmesse
flüchtig kennengelernt hatte. Aber der Mann sei katholisch und verheiratet,
habe auch drei Kinder. Es war doch unmöglich, daß dieser Kaufmann
ein junges Mädchen unterstützen, geschweige denn aufnehmen konnte!
Was wollte Bärbel allein in einem anderen Land, ohne einen Pfennig
Geld? Oder hatte sie ihr Sparbuch geplündert?
Aber der Umtausch brächte ja viel zuwenig‚ um sich eine Existenz
aufbauen zu können! Und zu meinem Bruder konnte sie doch auch nicht
gehen‚ die Wohnung war zu klein und mir wäre es schrecklich
peinlich gewesen, wenn Bärbel meine Verwandten um Unterstützung
gebeten hätte!
Hier war das Zuhause meiner Tochter, hier begann in wenigen Tagen das
Medizinstudium‚ das sie so hartnäckig angestrebt hatte! Hier
lebte ihr Freund, der junge Arzt Joachim! Und was würde diese Flucht
für meine anderen Kinder und mich bedeuten? Berufliche Nachteile?
Oder gar Haft?
Gut, ich hatte nichts geahnt‚ aber ob man mir das glauben würde?
Brachte man gar den kurzen Besuch bei meinem schwerkranken Vater in Stuttgart
mit Bärbels Verschwinden in Zusammenhang? Aber - da war keiner!
Fünf Monate waren seitdem vergangen. Konnte man mir daraus einen
Strick drehen?
Und was würde nun aus meiner neuen und interessanten Tätigkeit
an der Hochschule für Musik in Leipzig werden? Ich hatte nur die
mündliche festversprochene Zusage. Wenn sich Barbaras Flucht als
Tatsache erweisen würde‚ nähme mich kein staatliches Institut
als Lehrkraft. Nur gut, daß ich die jetzige Stellung im Theater
als Repetitorin noch nicht gekündigt hatte!
"Also doch, ich habe Babs schon seit einer Woche nicht gesehen",
stieß Joachim am nächsten Morgen wütend hervor.
Verblüfft fragte ich: "Was heißt hier also doch?"
"Ein anderer Mann, natürlich! Hab ich's doch geahnt!" Mehr
war aus dem jungen Mann nicht herauszubringen.
Was für ein Mann? Bärbel hatte viele Verehrer. Ob es der Rheinländer
war, dieser "tolle West-Mann", dem ich damals beim Anruf zur
Zeit der Frühjahrsmesse den Umgang mit meiner Tochter auszureden
versucht hatte?
Barbara wußte doch, wie hart unerlaubter Grenzübertritt bestraft
wurde! Ihr war auch klar, was diese Flucht für die übrige Familie
bedeuten würde. Sie hatte mir ja selbst in allen Einzelheiten von
der Verhaftung einer Kollegin erzählt, deren Freund in den Westen
verschwunden war.
Wie mußte ich mich jetzt verhalten? Die Arbeit hatte meine Tochter
gekündigt, da würde man so schnell nichts merken - aber sie
war doch eingeschriebene Studentin! Es würde sehr auffallen, wenn
jemand das Medizinstudium nicht antrat. Verheimlichte ich Bärbels
Verschwinden, machte ich mich der ,Beihilfe zur Republikflucht' verdächtig.
Nach reiflichem Überlegen, etwa 24 Stunden nach dem anonymen Anruf,
benachrichtigte ich das nächste Polizeirevier und beschrieb die Ereignisse.
"Da müssen Se 'ne Vermißtenmeldung aufgeben! Aber ich
sag's Ihnen gleich, wenn wir jedes junge Mädchen suchen wollten,
das mal nachts nicht heimkommt, hätten wir viel zu tun. Hab'n Se
'ne Garage? ... Ja? Sehen Sie dort nach! Hab'n Se 'nen Keller? ... Ja?
Auch dort suchen! Schließlich gibt es ja auch bei uns Verbrechen.
Hab'n Se noch mehr Kinder? ... Ach, alle erwachsen? Na, dann fahr'n Se
hin und fragen dort erstmal, auch die Freunde der Vermißten fragen,
dann könn' Se wieder anrufen!"
Es war am späten Nachmittag des Sonntags, da würde ich die jungen
Leute kaum alle antreffen. So bestellte ich die Taxe für den nächsten
Morgen 6 Uhr. Quer durch die Stadt fahrend, befragte ich Kinder und Schwiegerkinder,
auch Bärbels Freundinnen. Nichts. Keiner wußte etwas.
Die Arbeit und die Konzentration darauf fielen mir schwer, immer wieder
rollten mir Tränen aus den Augen - gegen meinen Willen. Endlich,
am Abend, verschaffte mir ein Anruf meines Bruders aus Stuttgart etwas
Erleichterung.
"Ich wollte es anfangs gar nicht glauben, aber deine Jüngste
ist auf irgendeine geheimnisvolle Weise über die Grenze nach West-Berlin
gelangt. Sie rief hier an, ich soll dir sagen, es ginge ihr gut, und sie
ließe wieder von sich hören!"
"Hast du die Adresse?"
"Weiß ich auch nicht, hat sie nicht nennen wollen!"
Meine Tochter lebt! Kein Verbrechen! Doch - wie ging es jetzt weiter?
Ich rief dieses Mal auf dem Polizeipräsidium an und meldete, was
ich von meinem Bruder erfahren hatte. Bereits zwei Stunden später
stand ein Eilbote vor der Tür, und ich wurde für den nächsten
Vormittag zu einer Vernehmung bestellt.
Eine nicht endenwollende Fragerei und immerzu dasselbe in diesem kalten,
grau-kahlen Raum! Als Mutter müßte ich doch wissen, mit wem
meine Tochter Umgang hatte.
"Ich kontrolliere nicht eine 23jährige! Außerdem bin ich
bei meinem Beruf oft abends nicht zu Hause!"
Aber dieses Argument beeindruckte den hartnäckigen Frager keineswegs.
"Weshalb hat Ihre Tochter unsere Republik verlassen? Mit wem hatte
sie im Westen Kontakt? Wer gab ihr die Anweisungen zur Flucht? Wer hat
ihr geholfen? Wie war der Fluchtweg?"
Und immer wieder meine Antwort: "Ich weiß es doch auch nicht!"
Man drohte mir, vor Gericht würde man meine Mitwisserschaft schon
herausfinden, und ich sei mir doch wohl im klaren darüber, was unerlaubter
Grenzübergang, Landesverrat oder gar Spionage meiner Tochter für
mich bedeutete?
In meiner Not äußerte ich die Vermutung‚ daß vielleicht
der verheiratete West-Mann hinter der Flucht stecken könne. Ich erzählte,
daß ich am Telefon den Rheinländer gebeten hatte, sich von
meiner Tochter zurückzuziehen, und daß wenige Wochen später
ein Päckchen aus Köln gekommen sei. Daraufhin hatte ich brieflich
meine Bitte wiederholt, sich nicht mehr zu melden.
"Dann kennen Sie also den Mann! Wie heißt er? Wo wohnt er?"
"Ich habe den Mann nie gesehen, ich weiß es nicht!"

Meine Tochter Barbara mit ihrem "West-Mann" Silvester 1973/74.
Es war der erste Jahreswechsel, den sie nach ihrer geglückten Flucht
im Westen erlebte.
"Das
sagen Sie immerzu! Wie können Sie einen Brief geschrieben haben‚
wenn Sie Namen und Adresse des Mannes nicht kennen?"
"Ja, natürlich!" Zum Glück fiel mir ein, daß
ich seinerzeit die Anschrift des Absenders auf dem Packbogen abgeschrieben
hatte, um den Brief abschicken zu können.
"Und wo ist die Adresse?"
"Ich habe sie nicht aufgehoben! Barbaras Freund wollte sie heiraten.
Da fand ich es nicht gut, wenn ich die Anschrift eines anderen Verehrers
in unser Verzeichnis geschrieben hätte. Aber vielleicht ist das Packpapier
noch im Keller?"
"Na, das haben wir gleich!"
Und nun fuhren zwei in Zivil gekleidete Männer mit mir in meine Wohnung.
Der gesuchte Packbogen fand sich schnell. Fast gleichzeitig kam die Post,
ein Eilbrief.
"Das ist Bärbels Schrift", entfuhr es mir. Ich mußte
den Brief im Beisein der Fremden öffnen und lesen, dann nahmen sie
mir das Schreiben weg. "Liebe Mama", hatte da gestanden, "sei
mir nicht böse, ich hab' Dich sehr lieb. Mir geht es gut. Ich melde
mich wieder! Babs!"
Der Poststempel ließ deutlich Köln erkennen, ein Absender fehlte.
Nun wurde das Packpapier geglättet - und richtig, der Mann wohnte
in einem kleinen Ort nahe Köln.
"Da haben wir ja den Jugendfreund", spottete einer der Männer.
Mir war nun auch klar, daß der Verheiratete hinter Barbaras Flucht
steckte. Wieder und wieder versuchte ich, die beiden herumstehenden Männer
zu überzeugen, daß dieses Verschwinden doch nichts mit Politik
zu tun hatte. Junge Mädchen seien zu allen Zeiten durchgebrannt,
wenn es um die große Liebe ging.
"Das überprüfen wir noch! Von jetzt an übergeben Sie
uns jeden Brief Ihrer Tochter! Sie dürfen ihn aber vorher öffnen
und lesen!" Dann wurde Barbaras Zimmer versiegelt.
Endlich war ich allein! Vor Angst war ich kr
ank! Die Gerichtsverhandlung! Auch war mir der Gedanke, daß mein
Kind sich nun wahrscheinlich als Geliebte aushalten ließe, entsetzlich.
Angst hatte ich auch vor dem Gefängnis. Bestraft sollte ich werden
für etwas, das ich weder gewußt noch veranlaßt hatte!
Ich brachte keinen Bissen herunter, nachts fand ich keine Ruhe.
Wochen vergingen‚ dann durchsuchten zwei Frauen Bärbels Zimmer.
Sie beschlagnahmten die Möbel, die Bücher, die Kleidung, den
Plattenspieler, das Radio. "Das wird alles von uns abgeholt!"
"Darf ich denn gar nichts behalten? Schließlich sind das die
Sachen meiner Tochter, das meiste hat sie doch von mir!"
"Sie können die Möbel von uns kaufen! Alles andere kommt
weg!" - So schrieb ich einen Scheck aus und "erwarb" dadurch
die Schrankwand und den Couchtisch.
Dann begann das Durchwühlen der Einrichtung. Man fand Bärbels
Adreßbüchlein, holte das noch unverbrannte Papier aus dem Ofen,
leerte den Papierkorb aus. Jedes Zettelchen, jeder alte Briefumschlag,
jede Notiz - alles wurde gelesen.
"Wer ist das? Was bedeutet diese Abkürzung? Von wem ist diese
Postkarte? Wer ist Häschen?"
Eine qualvolle Fragerei!
Das Sparbuch wurde gefunden. Vor einem Monat war eine größere
Summe abgehoben worden.
"Aha, da hat also Ihre Tochter ihr Geld abgehoben, um es im Westen
zum Schwindelkurs umzutauschen!"
"Aber nein, Barbara hat das Geld ihrer ältesten Schwester zum
Möbelkauf geborgt!"
"Das kann ja jeder behaupten! Beweise?"
Froh war ich, daß meine Tochter mir seinerzeit das formlose Blatt
gegeben hatte, auf dem meine Älteste sich verpflichtete, monatlich
500 Mark zurückzuzahlen.
"Und jetzt zahlt Ihre große Tochter an uns die Raten. Uns gehört
jetzt das Sparbuch! Name und Adresse?"
Endlich ging man, das Zimmer wurde erneut versiegelt. Meine Furcht blieb
und quälte mich weiter.
Nach einiger Zeit wurde Barbaras Zimmer ausgeräumt‚ bis auf
die Möbelstücke, die ich "gekauft" hatte. Zu meinem
Schreck gaben mir die Männer den Schlüssel nicht, sondern schlossen
ab und steckten ihn ein.
Ich protestierte. Barsch wurde ich zurechtgewiesen: "Nichts da, den
Schlüssel müssen wir im Rathaus abliefern!"
Also, auf zum Wohnungsamt. Ich dachte, ich höre nicht recht: "Den
Schlüssel behalten wir und weisen Ihnen eine Person in das freigewordene
Zimmer ein!"
Das hatte mir noch gefehlt! Ein fremder Mensch in der kleinen 2-Zimmer-Wohnung!
Ich führte an, daß ich täglich auf dem Instrument üben
müsse, daß ich oft zu Hause mit Kollegen probte. Und da hatte
ich Glück! Mein Gegenüber erinnerte sich jetzt, daß ich
Pianistin war und nach einigem Hin und Her bekam ich dann Bärbels
Zimmerschlüssel zurück.
Die versprochene Arbeit an der Hochschule erhielt ich nicht. "Wir
wissen schon Bescheid!" So empfing mich der Prorektor. "Und
im übrigen wird diese Stelle mit einem Gesellschaftswissenschaftler
besetzt! Mit der Republikflucht Ihrer Tochter hat das nichts zu tun. Wir
sind doch keine Nazis, bei uns gibt es keine Sippenhaft!"
Nun, ich wußte es besser ...
Herbst, Winter, Frühling verstrichen. Da flatterte mir Barbaras Heiratsannonce
ins Haus. Aus Köln! Mit dem tollen West-Mann! Erstaunlich, wie schnell
es mit der Scheidung gegangen war.
Ich schickte die Anzeige an das Polizeipräsidium mit der Bemerkung,
nun sei es wohl erwiesen‚ daß es sich bei der Flucht meiner
Tochter um Liebe gehandelt habe. Ich hörte nichts mehr! Ich begann
aufzuatmen.
Nach neun Jahren machte eine Amnestie Bärbels Besuch hier möglich.
Als junges Mädchen war sie fortgegangen, nun hatte sie zwei Kinder
an der Hand!
Wie die aufregende Flucht im Kofferraum über die Grenze verlief,
zugedeckt mit Stroh, das erfuhr ich erst nach dem Fall der Mauer.
Heute liegen die geschilderten Ereignisse 31 Jahre zurück. Aber wenn
ich an die Zeit nach Barbaras Verschwinden denke, davon erzähle oder
darüber schreibe, fühle ich immer noch die Beklemmung, die Sorge,
die Furcht und die ANGST von damals.
(In "Mauer-Passagen" ist noch eine Geschichte von Helga Brachmann veröffentlicht. Darin schildert sie unter anderem, wie sie ihren Sohn Christian Kunert, genannt Kuno, Mitglied der Klaus Renft Combo in der "Magdalene", dem Staasi-Untersuchungsgefängnis in Berlin, besuchte. Nach sieben Monaten durfte sie ihn am 16. August 1977 zum ersten und einzigen Mal sehen und sprechen.)
Ampfing,
Bayern - Berlin-Friedrichstraße - Strausberg - Altreetz, Oderbruch,
damals DDR;
Oktober 1983]
Irmgard Pondorf
Die ruhiggestellte Tante
Unsere Oma
wollte 1983 wie jedes Jahr zu unseren Verwandten in den Oderbruch fahren,
obwohl sie gerade erst eine Krankheit überstanden hatte. Wir Kinder
waren sehr dagegen, weil die Strapazen der langen beschwerlichen Reise
und die ständigen Aufregungen an der Grenze ihrem schwachen Herzen
nicht gerade förderlich sein würden. Aber unsere Oma war willensstark
und beharrte auf dieser Reise. Schon bald hatte sie die erforderliche
Einreisegenehmigung.
Am Abreisetag brachten wir sie zum Bahnhof nach Ampfing. Sie lehnte es
energisch ab, sich von uns bis nach München begleiten zu lassen,
wo wir sie in den Interzonenzug setzen wollten. Mit einem Augenzwinkern
meinte sie, sie werde schon einen jungen Kavalier finden. Wir machten
noch ein Abschiedsfoto von ihr, dann lief der Zug ein. Oma bahnte sich
den Weg in ein Abteil, wohin sie unsere Blicke begleiteten. Im Nu hatte
sie ihren ersten Freund gefunden: Ein junger Mann hievte ihren Koffer
ins Gepäcknetz. Fröhlich winkte sie uns zum Abschied durch das
Fenster zu, während wir mit Sorge an ihr schwaches Herz dachten.
Was sich dann in Berlin ereignete, erzählte meine Cousine Gerda Voß
aus dem Oderbruch später so:
Die Tante meines Mannes, Tante Lina, besuchte uns jedes Jahr, so auch
im Oktober 1983. Sie hatte das Bedürfnis, ihre Verwandten wiederzusehen,
die schon seit 1961 hinter Mauer und Stacheldraht eingesperrt waren. Weil
Tante Lina allein aus Bayern anreiste, verabredeten wir, daß ich
sie in Berlin am Bahnhof Friedrichstraße abholen würde, wo
der Fernzug aus München ankam.
Also machte ich mich von Altreetz, unserem kleinen Dorf nahe der Oder,
auf den Weg nach Berlin-Friedrichstraße, um die Tante in Empfang
zu nehmen. Im Bahnhofsgebäude wimmelte es von Menschen, die ihre
Lieben aus dem anderen Teil Deutschlands in die Arme schließen wollten.
Man kann sich heute kaum mehr vorstellen, daß die Reisenden aus
Westdeutschland, wenn sie im Bahnhof Friedrichstraße angekommen
waren, durch einen regelrechten Irrgarten geleitet wurden. Die Räume
waren durch hohe Wände und enge Gänge unterteilt, in denen die
Pässe und die Kofferinhalte kontrolliert wurden. Nach einem unerfindlichen
System gab es aber auch gründliche Durchsuchungen der Kleidung, die
man trug, und sogar Leibesvisitationen. Das gesamte Gebäude war von
Volkspolizisten bewacht und umstellt, die schwerbewaffnet und zum Teil
von Hunden begleitet waren. Ein Fluchtversuch in den Westen war hier hoffnungslos.
Mit zunehmender Nervosität sah ich dem Wiedersehen mit Tante Lina
entgegen. Endlich öffnete sich die Tür am Ende des Kontrollbereiches
und sie war da. Unter Tränen fielen wir uns in die Arme. Die Halle
glich einem Ameisenhaufen, deshalb wollte ich so schnell wie möglich
zur S-Bahn, die uns nach Strausberg bringen sollte.

Vor der Abfahrt des Zuges in Ampfing machten wir noch ein Abschiedsfoto
von unserer reisefreudigen Oma.
Doch Tante
Lina schwankte auf eine Säule zu und klammerte sich daran fest. Erschrocken
fragte ich sie, was mit ihr sei, doch sie sah mich nur mit glasigen Augen
an und reagierte nicht. Ein Passant bot mir Hilfe an. Mit der einen Hand
trug er den Koffer, mit der anderen umklammerte er den Arm meiner Tante.
Ich stützte sie auf der anderen Seite, und so schleppten wir die
alte Frau durch die endlose Halle und unzählige Stufen hinauf bis
zum S-Bahnsteig. Als der Zug nach Strausberg einlief, setzte der junge
Mann die Tante vorsichtig auf einen Eckplatz im Zug und verstaute den
Koffer. Dankbar drückte ich meinem Helfer die Hände.
Ich setzte mich ganz dicht neben Tante Lina und rätselte, was wohl
die Ursache ihrer Benommenheit sei. Plötzlich sackte sie in sich
zusammen, der schicke Hut rutschte ihr vor das Gesicht, die Handtasche,
die sie so lange krampfhaft festgehalten hatte, fiel zu Boden und der
gesamte Inhalt kullerte unter die Sitzbank. Reisende, die uns gegenüber
saßen, stützten und hielten die Ohnmächtige, und so konnte
ich unter einigen Verrenkungen alle Utensilien einsammeln. Dabei fand
ich auch eine angebrochene Packung mit Beruhigungstabletten. Waren die
etwa die Ursache für Tante Linas Apathie? Mir schwante so etwas,
als ich den Beipackzettel las.
Nach knapp einstündiger Fahrt erreichten wir Strausberg, Tante Lina
schlief fest, sie hatte hin und wieder friedlich geschnarcht. Hilfsbereite
Mitreisende halfen beim Aussteigen, und schon winkte uns mein Mann, der
uns bereits erwartete. Mit vereinten Kräften schleppten wir Tante
Lina ins Auto und schnallten sie fest. Zuhause hoben und schoben wir sie
ins Schlafzimmer, entkleideten sie und legten sie unter das mollige Federbett.
In den frühen Morgenstunden erschien eine blasse schlaftrunkene Gestalt
und jammerte: "Ich muß doch nach Altreetz, wo bin ich nur?"
Erleichtert nahmen wir unsere liebe alte Tante in die Arme und versicherten
ihr, daß sie schon an Ort und Stelle sei. Nachdem sie noch einmal
mehrere Stunden geschlafen hatte, war Tante Lina mit der ihr eigenen Mobilität
wieder ganz sie selbst. Von der Fahrt vom Bahnhof Friedrichstraße
bis nach Altreetz wußte sie nichts mehr.
Und die Tabletten in ihrer Handtasche?
Ja, die Tabletten ...
Die Ärztin hatte sie ihr zur Beruhigung vor der Reise verschrieben.
Und um bei den Kontrollen der Vopos ruhig zu erscheinen, hatte Tante Lina
viel zu viele davon auf einmal genommen. Die Tablette, die ihr auf der
Fahrt nach Strausberg den Rest gab, hatte sie geschluckt, während
ich neben ihr saß - und ich hatte es nicht bemerkt!
Wir verlebten noch schöne gemeinsame Tage. Die Geschichte ihrer Reise
machte allerdings in der Familie die Runde. Bis heute gibt sie immer wieder
Anlaß zum Schmunzeln und erinnert uns gleichzeitig an die traurigen
politischen Verhältnisse damals.
Potsdam,
Brandenburg - Berlin, damals DDR -Berlin;
Januar 1988-Herbst 1989]
Rudolf Bentz
Die Demonstration
Am 16. Januar
1988, es war Samstag, brachte unser Sohn seine Tochter übers Wochenende
zu uns. Es war nicht ungewöhnlich, daß sie bei uns blieb, die
Kinder hatten viele Bekannte, und wir alle wohnten in Potsdam. Mein Sohn
beschäftigte sich noch eine Weile in unserem Keller. Ich fragte ihn:
"Ich denke, ihr wollt nach Berlin fahren?"
"Ja, wir wollen morgen (zusammen mit dem Bruder in Berlin) zur Liebknecht-Luxemburg-Demonstration
in der Frankfurter Allee, und dazu muß ich noch ein Plakat anfertigen."
Jetzt sah ich, daß er den in jenen Tagen häufig gebrauchten
Ausspruch von Rosa Luxemburg, Freiheit bedeute auch immer die Freiheit
der Andersdenkenden, auf sein Plakat geschrieben hatte.
Am Abend verabschiedete ich ihn dann mit den Worten: "Na, hoffentlich
geht das nicht in die Hose."
Tags darauf verfolgten meine Frau und ich im DDR-Fernsehen die Übertragung
der alljährlichen Demonstration zur Gedenkstätte der Sozialisten
in Berlin-Friedrichsfelde. Wie immer marschierte alles hinter der Führungsspitze
her und bejubelte sie. Gegen Abend rief unsere Berliner Schwiegertochter
an. Sie war wegen einer Beinverletzung nicht zur Demo mitgegangen. Ob
sich denn die Potsdamer schon gemeldet hätten, wollte sie wissen.
Das war nicht der Fall.
Aus der Tagesschau erfuhren wir, daß es am Rande der Demonstration
zu Verhaftungen gekommen sei. Das West-Fernsehen berichtete von Auseinandersetzungen
zwischen Demonstranten auf der einen und Polizei und Staatssicherheit
auf der anderen Seite. Als wir bis 21 Uhr noch immer nichts von unseren
Söhnen und der Potsdamer Schwiegertochter gehört hatten, machten
wir uns große Sorgen. Uns wurde klar, daß unsere Kinder dabeisein
mußten.
Am Montag war von 100 Verhaftungen die Rede. Westliche Reporter hatten
am Ort des Geschehens gefilmt, wobei sie jedoch stark behindert worden
waren. Dank ihrer Anwesenheit gingen die Geschehnisse in Windeseile um
die Welt. Wäre das nicht der Fall gewesen, wären die Verhafteten
sang- und klanglos für längere Zeit in irgendwelchen Gefängnissen
verschwunden.
Unsere beiden Söhne und die Schwiegertochter waren am Sonntag in
Richtung Frankfurter Tor gefahren und hatten ihren Trabi in der Nähe
abgestellt. Am Treffpunkt waren bereits viele Menschen versammelt, darunter
Mitarbeiter der Staatssicherheit in Zivil. Noch ehe sich die Demonstranten
recht orientieren, geschweige denn formieren konnten, waren sie umstellt.
Von Polizei und Staatssicherheit wurden sie zur Seite abgedrängt
und auf LKWs gezwungen. Viele junge Leute fanden sich zusammengepfercht
irgendwo wieder.
Weiterhin ohne Nachricht von ihrem Mann, begab sich die Berliner Schwiegertochter
am Dienstag, dem 19. Januar, zum Generalstaatsanwalt, wo ihr mitgeteilt
wurde, daß die drei verhaftet worden seien und sich in Potsdam im
Gefängnis befänden.
Zusammen mit anderen Demonstranten waren unsere Kinder in Spezialtransportern
von Berlin nach Potsdam gebracht worden. Wie sie uns später schilderten,
wußte keiner, wohin die Fahrt ging. Jeder saß isoliert in
einer engen Kiste ohne Fenster. Keiner wußte etwas vom anderen.
Am Zielort mußten sie sich ausziehen und Gefangenenkleidung überziehen,
in der sie dann fotografiert wurden. Mit dem Gefühl der Ohnmacht
saß jeder in einer engen Einzelzelle bei ständiger Beleuchtung
und ohne zu wissen, was auf ihn zukam. Dazwischen Verhöre, Türenschlagen
und Schritte der Posten draußen. Manchmal wurden sie zum Freigang
in einen Lichthof geführt, einen Betonkäfig von etwa zwei mal
zwei Metern, der oben mit Draht abgedeckt und von den Posten einsehbar
war. Als ihre Zellentür einmal geöffnet wurde, hörte unsere
Schwiegertochter die Stimme ihres Mannes. Jetzt wußte sie, er war
ebenfalls hier.

Die "Freigang-Zellen" im Stasi-Gefängnis in Potsdam.
Im Januar 1988 wurden meine beiden Söhne und eine Schwiegertochter
hier eingesperrt.
Am 20. Januar
erreichte uns folgendes Schreiben des Generalstaatsanwalts mit Datum vom
18. Januar 1988:
Gegen
Ihren Sohn ... wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und Haftbefehl
erlassen, da er dringend verdächtig ist, eine strafbare Handlung
begangen zu haben. Ihr Sohn befindet sich in der Untersuchungshaftanstalt
Potsdam. Sie haben die Möglichkeit, monatlich vier Briefe zu schreiben.
Äußerungen über die Straftat sind darin nicht gestattet.
Paketsendungen können nicht entgegengenommen werden. Geldsendungen
von monatlich bis zu 50 Mark (nur per Postanweisung) sind zulässig
...
In der Zionskirche
in Berlin-Prenzlauer Berg, wo sich in diesen Tagen Abend für Abend
Hunderte von Menschen versammelten, bekam unsere Schwiegertochter am 20.
Januar den Tip, sich an einen kirchlichen Rechtsanwalt in der Sophienstraße
zu wenden. Gleich am nächsten Tag begaben meine Frau und ich uns
dorthin. Eine düstere Gegend. Meine Frau ging in das Haus und ich
beobachtete die Straße, ob uns eventuell jemand gefolgt sei oder
das Haus im Visier habe. Der Anwalt war nicht anwesend, er sei zur Zeit
in Rostock, wir sollten gegen Abend noch einmal nachfragen.
Später hörten wir, daß dieser Anwalt mit der Staatssicherheit
zusammengearbeitet haben soll. Ohne Ergebnis fuhren wir zur Wohnung unseres
Sohnes in Berlin, wo uns die Schwiegertochter aufgeregt mitteilte, daß
sie im Rechtsanwaltsbüro von Dr. Vogel noch für denselben Nachmittag
einen Termin erhalten habe. Während die 6jährige Enkeltochter
mit ihrer 10jährigen Cousine - versehen mit den erforderlichen Verhaltensmaßregeln
- in der Wohnung blieben, fuhren wir drei nach Friedrichsfelde. Im Büro
von Dr. Vogel wurden wir von einem seiner Mitarbeiter sehr zuvorkommend
empfangen. Unser Anliegen bestand eigentlich nur darin, für den uns
angekündigten Prozeß einen Rechtsanwalt zu engagieren.
Unser Gesprächspartner erklärte seine Bereitschaft, verwies
jedoch auf das kommende Wochenende, das wir unbedingt erst abwarten sollten.
Es werde sich "etwas bewegen", nur könne er jetzt noch
nicht darüber reden. Wir wunderten uns noch sehr darüber, daß
die Akten, die der Anwalt aus seinem Schreibtisch hervorholte, Daten unserer
Söhne enthielten. Optimistisch gestimmt, fuhren wir zurück.
Bald würde die Familie wieder beisammen sein.
Allein in der Wohnung, hatten die beiden Enkeltöchter in der Zwischenzeit
versucht, Griesbrei zu kochen, es aber doch für sinnvoller gehalten,
das Produkt ihres Bemühens in die Toilette zu schütten. Nach
einer anderweitigen kleinen Stärkung kehrten wir nach Potsdam zurück.
Am nächsten Morgen, wir saßen noch beim Frühstück,
erhielten wir einen Anruf von der Abteilung Inneres des Rates der Stadt.
Man müsse uns wegen der Dinge, die auf uns zukämen, dringend
sprechen. Wann sie kommen könnten?
Weil ich an diesem Tag unbedingt zu meiner alten Dienststelle wollte,
wo ich noch immer stundenweise, aber ohne feste Arbeitszeiten beschäftigt
war, gab ich 15 Uhr an. Irgend etwas trieb mich jedoch gleich nach dem
Mittagessen wieder nach Hause, wo mich meine Frau sehr besorgt empfing.
Die Polizei habe angerufen, es sei dringend, es handle sich um das Enkelkind.
Sie würden gleich da sein. Wir hatten bereits besprochen, wie wir
uns verhalten wollten, falls man uns unsere Enkeltochter wegnehmen würde.
Kurz nach mir erschienen eine Frau und ein Mann, beide von der Abteilung
Inneres. Die Frau holte eine dicke Mappe aus der Tasche und breitete die
Papiere auf dem Tisch aus. "Also", begann sie, "Ihre Kinder
befinden sich in Hamburg."
Darauf ich recht erregt: "Was ist los? Habe ich richtig verstanden
- in Hamburg?"
"Ja, sie wurden heute morgen zur Grenze gebracht." -Jetzt, so
erklärte die Frau weiter, seien die notwendigen Maßnahmen zu
besprechen, um das Kind den Eltern wieder zuzuführen. Sie hätten
die erforderlichen Papiere bereits dabei. Es fehlte nur noch ein Paßbild.
Wer hat schon von einem sechsjährigen Kind ein Paßfoto zur
Hand? Das Bild sollte Montag früh bei der Abteilung Inneres vorgelegt
werden.
Inzwischen waren noch zwei Männer gekommen, die sich auf den Anruf
vom Vormittag bezogen. Sie brachten das Auto unseres Sohnes sowie alle
möglichen Dinge, die man ihm abgenommen hatte, bis hin zum Straßenbahnfahrschein.
Als das erledigt war, setzte ich mich mit der Kleinen in Bewegung, um
von ihr ein Paßfoto machen zu lassen. Vergeblich klapperten wir
alle mir bekannten Fotoläden ab. Es war Freitagnachmittag! Schließlich
bekam ich den Hinweis auf einen Foto-Expreßdienst in der Straße
"Am Stern", wo es dann mit dem Fotografieren doch noch klappte.
Meine Frau erhielt schnell die erforderlichen Genehmigungen, als Rentnerin
durfte sie in die BRD reisen. Am Morgen des 26. Januar 1988 gingen wir
drei schwerbepackt zum Bahnhof. Das Kind mit einem Campingbeutel auf dem
Rücken, aus dem oben ihre Puppe herausguckte. Meine Frau brachte
das Kind zu seinen Eltern, die es in Frankfurt am Main in Empfang nahmen.
Am Grenzkontrollpunkt mußten beide aus dem Zug aussteigen und zur
Durchleuchtung eines Stofftieres in eine Zollbaracke gehen. Beim Umsteigen
in Hannover, mit dem schweren Gepäck und dem Kind an der Hand, waren
andere Fahrgäste meiner Frau sehr behilflich.
Noch am gleichen Tag reisten auch die Berliner Schwiegertochter und Enkelin
aus. Von der Abteilung Inneres war ihnen ein Zug ab Schöneweide genannt
worden, der aber an jenem Abend gar nicht fuhr. Da sie jedoch bis Mitternacht
die DDR verlassen haben mußten, blieb ihnen nichts anderes übrig,
als für Westgeld ein Taxi von Berlin bis zur Grenze nach Helmstedt
zu nehmen, für DDR-Geld wollte kein Fahrer die weite Fahrt machen.
Weil der Fahrer nicht bis an den Kontrollpunkt - dort war Sperrbezirk!
- heranfahren durfte, mußten Mutter und Kind, ebenfalls mit schwerem
Koffer, in der stockdunklen Nacht und bei beginnendem Regen den Rest der
Strecke zu Fuß zurücklegen.
Damit endete für meine Söhne und ihre Familien die Liebknecht-Luxemburg-Demonstration
des Jahres 1988.
Unsere
Ausreise
Meine Frau und ich waren von der Staatssicherheit darüber aufgeklärt
worden, daß unsere in den Westen abgeschobenen Kinder in den nächsten
zehn Jahren die DDR nicht besuchen dürften. Wer ahnte denn, daß
bereits zwei Jahre später die DDR nicht mehr existieren würde?
Nach gründlichen Überlegungen kamen meine Frau und ich zu der
Auffassung, diesem Land ebenfalls den Rücken zu kehren. "Laßt
alles stehen und liegen! Was wollt ihr dort noch?", meinten unsere
Kinder am Telefon. Es war jene Phase, in der DDR-Bürger in Scharen
das Land verließen.
Im Februar 1989 stellten wir den Ausreiseantrag. Ein Wust von Erklärungen
aller Art kam auf uns zu, Rücksprachen bei allen möglichen Ämtern
und Dienststellen waren zu führen. Unser Hab und Gut mußte
untergebracht werden, zum Teil wurde es verschleudert. Neben vielen ehrlichen,
hilfsbereiten Menschen lernten wir auch solche Mitbürger kennen,
die sich mit überschwenglichem Gehabe unser Vertrauen erschlichen,
um dann Haus und Bungalow zu ergattern. Als wir ausgereist waren, wollten
sie von dem, was "sicherheitshalber" nur mündlich vereinbart
worden war, nichts mehr wissen.
Am 11. August 1989 zogen meine Frau und ich, mit Koffern und Taschen schwerbepackt,
aus der Potsdamer Wohnung aus und fuhren über den Bahnhof Friedrichstraße
nach West-Berlin. Als wir am letzten Grenzer vorbeiliefen, sagte dieser
leise: "Jetzt sind Sie frei!"
Infolge der bereits herrschenden Ausreiseflut war es kompliziert, in West-Berlin
eine Wohnung zu finden. Zum Glück konnten wir beim ältesten
Sohn, der inzwischen vom Münsterland nach Spandau übergesiedelt
war, provisorisch unterkommen. Unser Bestreben war es, nach der Ausreise
aus der DDR im heimatlichen Bereich zu bleiben, also in West-Berlin, was
die Behörden auch akzeptierten. Es dauerte alles seine Zeit, täglich
von Spandau nach Marienfelde zum Aufnahmelager zu fahren. Dort wurden
wir von einer Baracke zur anderen geschickt. Dazwischen stundenlanges
Warten. Der Papierkrieg war hier, wie wir bald merkten, noch ausgeprägter
als in der DDR.
In Absprache mit den "Käufern" unseres Hauses hatten wir
die zur Mitnahme bestimmten Möbelstücke und Hausratsgegenstände
dort in einem Zimmer vorerst untergestellt. Wir hofften, das Wohnungsproblem
werde in vier bis sechs Wochen gelöst sein. Doch es dauerte erheblich
länger.
Es gelang uns, in Spandau einen leerstehenden Kellerraum zur vorläufigen
Unterbringung unserer Sachen ausfindig zu machen. Endlich konnten unsere
Möbel aus Potsdam geholt werden. Durch den bereits deutlich fortschreitenden
Verfall der DDR war es sogar möglich, daß wir das selbst erledigten.
Der bis dato vorgeschriebene offizielle Weg eines solchen Umzuges wäre
über die DDR-Spedition DEUTRANS gegangen und hätte uns 2500
DM gekostet, die wir nicht besaßen.
Also mieteten wir einen LKW, und mein Sohn und ich fuhren mit den erforderlichen
Papieren nach Potsdam. Unter dem wachsamen Auge unserer Haus-"Erbin",
die uns an der Tür abfertigte, luden wir unsere Sachen auf den LKW
und ab ging es zur Grenzkontrollstelle Staaken. Der Zöllner dort
machte Schwierigkeiten. Erst verlangte er noch eine bestimmte Genehmigung
des Rates des Bezirkes Potsdam, die sich allerdings bei den Unterlagen
befand, die er in der Hand hielt. Aber ungeachtet dessen könne er
uns nicht passieren lassen. Das ginge nur über die Zolldienststelle
in Potsdam. Es war Freitagmittag. Auf unsere dringende Bitte rief er dort
an und kündigte an, daß noch Reisende kommen würden. Von
der Kontrollstelle aus konnten wir das Viertel in West-Berlin sehen, wo
wir hinfahren wollten.
Es half nichts. Wieder einsteigen, den LKW gewendet und zurück. Quer
durch Potsdam ging die Fahrt. Erst zum Kontrollpunkt Drewitz, wo DEUTRANS
seinen Sitz hatte. Dort waren 50 DM zu bezahlen, wofür weiß
ich nicht, aber ich bekam die wichtige Quittung. Gegen 14 Uhr kamen wir
beim Zoll in der Karl-Marx-Straße an. Ich klingelte. Ein Zollbeamter
öffnete, nahm die Papiere entgegen und verschwand wieder. Nach einigen
Minuten bangen Wartens - man kam sich ja bei solchen Gelegenheiten wie
ein armer Sünder vor - erschien ein älterer Zöllner und
meinte zu mir: "Was macht denn der Anglerverband, wenn du nicht mehr
da bist?"
Es war ein Bekannter vom Potsdamer Anglerverband. Theoretisch hätte
er uns an eine Rampe auf dem Hof heranfahren und alles ausladen lassen
können. Er rief einen jüngeren Kollegen, der einen Blick in
den LKW warf, und während wir noch ein paar Worte wechselten, wurde
die Ladung versiegelt. Der Zöllner in Staaken wunderte sich, daß
wir so schnell zurück waren und sich alles in ordnungsgemäßem
Zustand befand. Ein wenig Glück gehört eben auch dazu.
Bald nach unserer Übersiedlung nach West-Berlin ist die Mauer gefallen.
Nach vier Monaten hatten wir endlich eine neue Bleibe gefunden.

Ein Mauerloch
bei Berlin-Staaken, nicht weit von unserem heutigen Wohnsitz auf der Westseite.
Von dort sind es nur ein paar hundert Meter zu unserer vertrauten Umgebung.
[nach
oben]
Inhalt
Orte
9
Chronologie 1961-1989 11
Vorbemerkungen 24
Hermann Meyn, Allein auf weiten Fluren 27
Dietrich O. A. Klose, Abschied von Berlin 32
Rudolf Bentz, Republikflüchtige Aale 39
Marianne Doerfel, Kannitverstan 43
Marianne Doerfel, Blinde Passagiere 56
Reinhard Lauenstein, Mit List und Tücke 65
Traute Siegmund, Schlangestehen lohnt immer! 71
Peter Franke, Schwester rollt seit sechs Uhr ... 80
Meinhard Schröder, Zur Fahndung ausgeschrieben 89
Erna Hannemann, „Gefüllte“ Leberwurstbrötchen im Interzonenzug
100
Jan Eilers, Dresdner Christ-Stollen 103
Marianne Diepen, Patenschaft für einen DDR-Turner 107
Maria-Elisabeth Warnke, Die Prag-Connection 117
Lothar Böttcher, Hochsitz 127
Clemens Kugelmeier, Unglücklich das Land, das Helden nötig hat
129
Evelyn Steudel, Getrennte Wege 134
Hans Peter Kutscha, Meine Volkspolizisten 140
Hans-Joachim Musiol, Vorkommnisse 149
Helga Brachmann, Angst 157
Ingeborg Hoffmann-Sagebiel, Fast ein Katzensprung 165
Lothar Böttcher, Balkonsonntag 171
Manfred Glashagen, Stippviste im anderen Deutschland 174
Anneliese Ohlenburg, Fremdes, deutsches Land 180
Renate Strebel, Klassentreffen 185
Helga Brachmann, Mein Sohn und die „Magdalene“ 195
Heinz Csallner, „Halt! Stehenbleiben!“ 210
Falko Berg , Verkrampfte Beziehungen 213
Inge Wolter, Urlaub in der geteilten Stadt 226
Paul Misch, Das Corpus delicti 231
Michael Deutsch, Solo durch die DDR 236
Jürgen Hagenmeyer, Dresden – Erwartung und Wirklichkeit
249
Judith Finke, Lüge und Wahrheit 254
Jürgen Hagenmeyer, Konfirmation mit Hindernissen 258
Irmgard Pondorf, Die ruhiggestellte Tante 261
Erika Tappe, Kurswagen nach Kopenhagen 265
Paul Misch, Lampenfieber 274
Inge Dreßler, Grenzerfahrung 279
Helga Hauthal, Ein Jahr mindestens 281
Dorothea F. Voigtländer, Verschollen 287
Elfriede Brückner, Meine Reise zum „Klassenfeind“
297
Ingrid Franke, Einmal Gießen – und zurück 302
Rudolf Bentz, Die Demonstration 315
Helmut Heimrich, Das Ende einer Illusion 325
Erika Tappe, „Nun ist er endgültig kaputt!“ 336
Renate Grobe, Das Pannenschaf 339
Roland Walter, Ein Traum wird wahr 342
Verfasser 354
Seitenkopf »