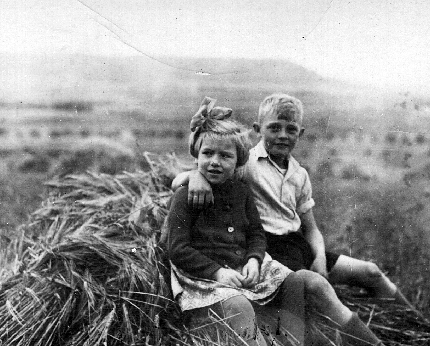|
Kurzbeschreibung
Auf Wanderschaft zur Sommerweide – Dorfgeschichten 1914–1968
Ein Sonntag im Jahr 1925: Ein ganz besonderer Tag für alle Dorfbewohner.
Die harte Arbeitswoche ist vorüber und die Familien nutzen die
Zeit für ein bisschen Müßiggang. Es sind Kleinigkeiten,
die den Sonntag zum Festtag machen: Das Plaudern mit Bekannten nach
der Heiligen Messe, Weißbrot zum Frühstück, mit dem
Vater Spazierengehen, Himbeersaft zum Pudding, ein Mittagsschläfchen
machen.
Authentischen Erinnerungen aus vergangener Zeit, machen diese Sammlung
von Dorfgeschichten aus ganz Deutschland so spannend. Aus über
1.000 Zeitzeugen-Erinnerungen des Zeitgut-Archivs sind 55 ausgewählt
worden und liegen nun als zweibändige Taschenbuch-Ausgabe vor.
Eltern, Großeltern und Urgroßeltern erinnern sich an die
Zeit von 1912 bis 1968 und bringen ein halbes Jahrhundert Geschichte
in greifbare Nähe.
Das Leben auf dem Land ist durch harte Arbeit auf Feld und Hof geprägt.
Sehnsüchtig wird die nächste Kirmes erwartet, die einmal im
Jahr, meist im September, stattfindet. Jung und alt haben dort die Gelegenheit,
zu feiern, es wird zum Tanz geladen – froh und ausgelassen, vergisst
man für eine Zeit das anstrengende Alltagsleben.
Währen der Kriegszeit werden viele Stadtkinder in ländliche
Umgebungen geschickt. „Das also ist das Land, das Feld. Es riecht
nach Kuhstall“, erinnert sich der 9jährige Harry an seine
Ankunft im thüringischen Eichsfeld. Für den Jungen aus Berlin
ist das Landleben aufregend. Er erlebt seine erste Kutschfahrt, hilft
bei der Runkelrübenernte mit und genießt das reichhaltige
Frühstück: in Würfel geschnittenes Graubrot, das mit
Malzkaffee, frischer Milch und Zucker serviert und „Bröckchen“
genannt wird.
In den 50er Jahren kommen dann die ersten elektrischen Weidezäune
in Mode. Doch wozu teuere Batterien kaufen, wenn der Strom gleich aus
der Melkkammer nebenan fließen kann? Der Bauer macht sich ans
Werk und bastelt flink aus isolierten Haken, dünnen Drähten
und ein paar Holzpfählen einen elektrischen Weidezaun. „Rosa,
laß die Küah raus, dr Zau isch fertig!“, ruft er stolz.
Schon erreicht die erste Kuh den Zaun, berührt ihn und fällt
wie vom Blitz getroffen um. Dass nicht auch der Bauer, der die kostbaren
Kühe retten will, fast sein Leben lässt, hat er seiner Frau
zu verdanken.
Über ein halbes Jahrhundert Zeitgeschichte ist in den zwei Bänden
„Wo morgens der Hahn kräht“ zu finden. Die Erinnerungen
sind interessant für diejenigen, „die diese Zeit miterlebt
haben, und ihre Kinder und Enkel, die mehr erfahren wollen, als in den
üblichen Geschichtsbüchern zu lesen ist.“ (Westfälische
Rundschau)
Leseproben:
»Wo morgens der Hahn kräht«
Band
1: Margot Linke: Das Huhn "Tuck-Tuck"
Band 1: Harry
Banaszak: Plötzlich habe ich zwei Schwestern (Auszug)
Band 2: Hildegard Kupko: Saure Gurken vom Feld
Band 2: Georg Hörmann: Der elektrische
Weidezaun
Band 2: Bärbel Böhme: Ein tierischer
Hochzeitstag
[nach
oben]
Leseprobe
aus: Wo morgens der Hahn kräht, Band 1
[am
Ortsrand von Gröditz bei Riesa/Elbe,
Sachsen; 1930/31]
Das Huhn „Tuck-Tuck“
von Margot
Linke
Unsere Nachbarn
hatten hinter dem Haus einen kleinen Hühnerstall mit fünf
bis sechs Hühnern und seiner Majestät, dem Hahn. Der Bursche
ließ niemanden in die Nähe seiner Frauen. Also mußte
ich mit vielen Tricks und gutem Futter seine Gunst erobern. Das gelang
mir auch sehr bald. Allerdings jagte er seine Damen weg, sobald ich
Leckerbissen für alle brachte. Bei Regenwürmern war der Kampf
groß.
Als Küken
ausschlüpften, war ich nicht mehr zu bremsen. Frau Beck, die Nachbarin,
erlaubte mir, die kleinen gelben Wollknäuel in die Hand zu nehmen
und zu streicheln. Ein kleines Küken piepste immer, wenn ich in
die Nähe des Hühnerstalles kam. Sehr bald kannte es meine
Stimme und begrüßte mich mit „Tuck-Tuck“. Unsere
Freundschaft war besiegelt. Es war ein besonders kluges Hühnchen.
Auf meinen Ruf hin lief es bald hinter mir drein ins Haus und hüpfte
die Treppenstiege hinauf. Kam ich mit dem Puppenwagen angefahren und
rief: „Komm, Tuck-Tuck!“, nahm es Anlauf und flatterte in
den Wagen. Manchmal setzte ich ihm eine Pudelmütze auf und legte
ihm einen Schal um. Es sieht lustig aus, wenn Hühner „feingemacht“
werden. Das wagte ich freilich nur, wenn kein Erwachsener in der Nähe
war.

Ein besonders
kluges Hühnchen war mein Spielgefährte. Auf dem Osterfoto
„Tuck-Tuck“ und ich im Partnerlook.
Mein Vater fotografierte
sehr gern. Er suchte sich immer Motive aus, die uns Kinder zusammen
mit Blumen und Tieren zeigten. Zum Geburtstag, zu Ostern, zu Weihnachten,
zu Hochzeiten
und zu anderen Anlässen verschickte er an alle Verwandten und Bekannten
seine Karten. Wir Kinder waren nicht begeistert, wenn es hieß:
fünf Minuten lächeln und stillhalten! Auf der Osterkarte mußte
mein „Tuck-Tuck“ die liebevolle Kükenmutter spielen.
Sie sah mir zu, als wollte sie sagen: „Ich bin zu Höherem
berufen, als mich mit dem kleinen Volk herumzuärgern.“
Im Herbst suchte
ein kleiner Wanderzirkus für sich und seine Tiere ein Winterquartier.
Hinter unserem Garten war ein ehemaliger Sportplatz, der dem Zirkus
zur Verfügung gestellt wurde. Alle Nachbarn halfen der Zirkusfamilie.
Oft wunderte sich meine Mutter: „Wo ist denn schon wieder das Brot
geblieben, heute morgen war es doch noch da?“
Aus unserem und
den Kellern der Nachbarn holten wir gelbe Rüben und Gemüse,
das zur Überwinterung in Sand gelagert wurde. Mein Bruder sägte
ein Loch in unseren Gartenzaun, damit wir schnell zu den Tieren gelangen
konnten. Wir durften sie füttern, bürsten, mit ihnen spazierengehen
und sogar darauf reiten. Ich erzählte dem Herrn Zirkusdirektor,
daß ich eine besonders kluge Henne hätte und sie ihm unbedingt
zeigen müsse. Voller Stolz führten wir die Kunststücke
vor. Wenn ich ihr noch einiges beibrächte, könnte ich im Frühjahr
bei ihm auftreten, meinte er. Ich war fest entschlossen, einmal Frau
Zirkusdirektorin zu werden.
Der Frühling
kam und meine Tuck-Tuck war die Schönste, ja die allerschönste
Henne auf der ganzen Welt. Nachbars Tochter rüstete für ihre
Hochzeit. Der Bräutigam oder ein Verwandter sollte für die
Hochzeitssuppe ein Huhn schlachten. Am nächsten Tag lagen vor unserer
Tür „Tuck-Tucks“ Kopf, die Füße und zwei Federn!
Das war für mich ungeheuerlich, und ich habe lange getrauert.
Die Jahre vergingen,
den kleinen Hühnerstall gab es nicht mehr. Beide Söhne hatten
sich im Nachbardorf eine Hühnerfarm gekauft. Als der Krieg begann,
gab Mutter Beck alles auf und zog allein in das Anwesen. Mit aller Kraft
wollte sie den Söhnen, die jetzt Soldaten waren, die Existenz erhalten.
Ein Sohn fiel in Rußland, der zweite war vermißt. Frau Beck
hoffte lange, daß der verschollene Sohn wiederkommen würde.
Ihre drei Töchter fuhren täglich mit dem Fahrrad zur Mutter.
Sie wurde still und stiller. Als keine Aussicht auf eine Heimkehr mehr
bestand, starb sie.
Aus: „Zwischen
Kaiser und Hitler“. ZEITGUT Band 15.
[nach
oben]
Leseprobe
aus: Wo morgens der Hahn kräht, Band 1
[Berlin
– Kaltohmfeld nahe Worbis, Eichsfeld, Thüringen;
März 1940–Herbst 1943]
Plötzlich
habe ich zwei Schwestern (Auszug)
von Harry Banaszak
[Der kleine Harry
aus Berlin wird im März 1940 im Zuge der Kinder-Landverschickungen,
aufs Dorf ins thüringische Eichsfeld geschickt. Harry ist gerade
bei seiner neuen Familie angekommen … ]
Onkel Erich und ich betreten das Haus durch einen kleinen Vorbau mit
ein paar Stufen zur Diele, von hier führt eine gerade Holztreppe
zu den oberen Räumen. Gleich vor der Treppe rechts ist die Küche.
In der Küche steht eine Eckbank, davor der große Tisch, ein
paar Stühle und der Küchenschrank. Es ist eine große
Wohnküche. Im Küchenherd brennt Feuer, Wasser kocht in einem
Topf, neben dem Herd steht die große Kiste mit dem Feuerholz und
eine Bank mit zwei Zinkeimern voll Wasser. Brunnenwasser. Von der Küche
führt eine Tür ins Nebenzimmer. Überall sind Leute. Sie
sitzen, stehen, schauen mich an. Onkel Erich sagt: „Das ist jetzt
unser Junge, er heißt Harry.“
Zwei Mädchen, eines mit langen blonden Zöpfen, das andere
mit einer Schleife im Haar, kommen auf mich zu und sagen: „Ich
bin die Anni“ und „ich bin die Irma.“
Sie lachen mich an. Und plötzlich habe ich zwei Schwestern. Ich
spüre das genau. Die Frau mit dem Kopftuch ist die Mutter, für
mich Tante Lina.

Das sind Anni und Irma, sie sind von nun an meine beiden Schwestern.
Tante Lina sagt
nun zu mir: „Anni wird auch neun Jahre alt, so wie du, und Irma
kommt im nächsten Jahr zur Schule, sie ist fünf.“ Sie
zeigt auf die anderen: „Das sind Großvater Karl und Albert.
Otto ist gerade draußen und versorgt die Pferde und Carl –
noch ein Bruder von Onkel Erich – füttert die Schweine und
die Kühe. Frieda, die Schwägerin, die Frau vom jüngsten
Bruder Paul ist in ihrer Stube. Paul ist an der Front.“
Jetzt weiß ich Bescheid. Ich bin von einer großen Familie
aufgenommen worden. Am meisten gefällt mir, daß ich zwei
Schwestern habe. Tante Lina hat mich zur Begrüßung in den
Arm genommen, das überrascht mich. Ich kenne nur Küßchengeben
auf die Wange, ob bei der Begrüßung oder beim Abschied, und
das gute Händchen geben und den Diener machen. Ich merke gerade,
daß ich zum Dienermachen noch gar keine Gelegenheit hatte. Trotzdem
sind alle auch so sehr freundlich zu mir.
Zum Schlafen geht es ab nach oben. Im Schlafzimmer, mit einem Fenster
zum Hof, stehen zwei Ehebetten, ein Schrank, zwei Nachtschränke.
„Unser Zimmer mit Vater und Mutter“, erklärt Anni. Sie
zieht sich aus, schlüpft ins Nachthemd, Irma ebenfalls, und beide
hüpfen in das linke Bett vom Fenster. Ich zögere, warte.
„Na los“, sagt Tante Lina, „hier am Fußende bei
den Mädels ist dein Kopfkissen.“
Etwas fremdelnd lege ich mich dann doch mit unter das gemeinsame Federbett
zu Anni und Irma. Sie kichern und albern noch ein Weilchen herum, ich
aber bin nach diesem aufregenden und erlebnisreichen Tag sofort tief
eingeschlafen.
Das Krähen des Hahnes, lautes Kleinviehgegacker, Hundegebell und
eine Reihe mir unbekannter Geräusche wecken mich. Die hellsten
Sonnenstrahlen, die ich je gesehen habe, scheinen mir ins Gesicht. Die
Mädchen sind nicht mehr da. Sie sind schon unten. Ich höre
sie in der Küche lachen. Bestimmt frühstücken sie schon.
Schnell ziehe ich mich an. Zum Frühstück gibt es Bröckchen.
Bröckchen sind in Würfel geschnittenes Graubrot mit Malzkaffee
und frischer Milch übergossen und zwei Teelöffel Zucker darüber.
Wir essen die Bröckchen aus einer großen Tasse. Holzfeuer
prasselt unter der Herdplatte. Das Wasser im Topf kocht immer noch oder
schon wieder. Tante Lina schält Kartoffeln. Vom Küchenfenster
aus sehe ich den Misthaufen mitten im Hof, dahinter die Scheune mit
weitgeöffnetem Scheunentor. Und Hühner, den Hahn, der mich
vorhin so fröhlich weckte, eine Gruppe Gänse, ein paar Enten.
Alles schnattert und gackert durcheinander.

Tante Alwine und die ganze Ferkelei. Ein Foto aus den 30er Jahren.
„Vater ist
mit den Pferden und dem Wagen in Worbis“, sagt Anni, als ich nach
Onkel Erich frage. „Vater fährt täglich die Milch von
Kaltohmfeld und von Kirchohmfeld zur Molkerei.“
„Und wer macht den Bauernhof ?“ frage ich, denn daß
auf dem Feld gearbeitet werden muß, um zu ernten, weiß ich
schon aus dem Lesebuch der dritten Klasse.
„Um die Landwirtschaft kümmern sich vorwiegend Mutter und
Großvater, Carl, Otto und Albert helfen dabei. Vater arbeitet
am Nachmittag nach dem Milchfahren mit den Pferden auf dem Feld“,
sagt Anni. „Viel Arbeit für Max und den Braunen. Aber manchmal
läßt Großvater auch die beiden Kühe anspannen.
Die sind eine gute Hilfe.“
Wir Kinder gehen
ins Dorf. Die Mädchen wollen mir die Schule zeigen.
„Das da, das
gelbe Fachwerkhaus neben der Kirche ist unsere Schule. Sie ist 1836
gebaut worden und jetzt 104 Jahre alt. Wir haben nur einen Klassenraum
und einen Lehrer für alle Schuljahre“, klärt mich Anni
auf, und sie sagt: „Aber es macht trotzdem Spaß, ich mag
die Schule. Du auch?“
„Das wird schon die dritte Schule sein, die ich seit meiner Einschulung
besuche. Meine Lehrer waren immer sehr streng, vorige Woche vor den
Osterferien bin in die vierte Klasse gekommen, mit vier Zweien und vier
Dreien.“
Mit dieser Antwort sind die Mädchen zufrieden. Über Schule
wird nicht mehr gesprochen. Jetzt sind Ferien. (...)
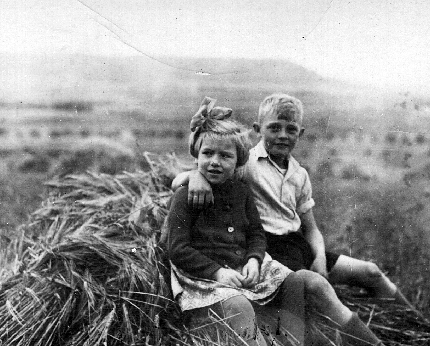
Irma und
ich während der Getreideernte 1940.
[nach
oben]
Leseprobe
aus: Wo morgens der Hahn kräht, Band 2
[Kleinobringen
bei Weimar, Thüringen;
Anfang der 50er Jahre / um 1930]
Saure Gurken
vom Feld
von Hildegard Kupko
Mein Onkel Adolf
war weithin bekannt für seine Lausbübereien. Der „Schwede“
– so wurde er genannt, weil am 2. Februar 1897 geboren und an diesem
Tag Gustav Adolf in alten Kalendern stand – war ein typischer Wassermann
und ein richtiger Sausewind. Immer zu Scherzen aufgelegt, bei der Arbeit
ein Lied auf den Lippen, und pfeifen konnte er schrill ganz aus dem
Effeff. Im Ersten Weltkrieg war er bei den Sanitätern gewesen,
und nachdem er den ohne Verletzung überstanden hatte, lernte er
Dachdecker.
Seine Braut hatte Onkel Adolf aus der Rhön mitgebracht, und sie
heirateten Anfang der 20er Jahre. Sieben Kinder schenkte sie ihm, zwei
starben als Babys, der Älteste fiel im Zweiten Weltkrieg in Rußland.
Ihre Heimat war Kleinobringen, ein Dorf mit 50 Wohnhäusern hinter
dem Ettersberg, von Weimar aus gesehen. Auch ich wohnte in meinen ersten
sechs Lebensjahren dort, bevor meine Eltern wegen der Arbeit 1926 nach
Weimar zogen.
Eines Abends juckte dem Onkel wohl wieder das Fell, er hatte Durst und
wollte gern auf Kosten anderer einen trinken. Er ging in die Schenke
und erzählte beiläufig, daß er nochmal aufs Krautland
müßte, um nach den Gurken zu sehen. Das „Krautland“
war ein uneingezäuntes, von einem Acker begrenztes Stück Land,
auf dem die Leute Gemüse anbauten. Es lag an der Rassel, einem
kleinen Bächlein vor dem Dorfe.
„Was, heute abend nochmal aufs Krautland – warum denn das?“,
fragten die Männer.
„Na, ich mache da ein Experiment, und wenn es gelingt, dann habe
ich ausgesorgt. Ihr werdet staunen! Was gilt die Wette? – Eine
Flasche Schnaps!“
Das war sein Angebot.
Neugierig wie Schmidt’s Heppe bedrängten sie ihn nun, bis
er Einzelheiten von seinem Experiment preisgab. Er habe Gurkenkerne
zum Vorkeimen statt mit Wasser mit blankem Gewürzessig angesetzt,
die Pflanzen hätten sich gut entwickelt. Nach dem Vereinzeln im
Beet habe er sie weiterhin halb mit Essig und halb mit Wasser gegossen.
Nun sei es soweit, daß er die ersten größeren Gurken
ernten könne, und die wolle er heute abend noch probieren.
Keiner wollte das Ereignis verpassen, es war ja zu großartig,
geradezu „nationalpreisverdächtig“!
So machten sich die Kneipenbrüder gemeinsam auf den Weg zum Krautland,
Onkel Adolf ging schnell vorneweg und holte von daheim eine Taschenlampe.
Dort angekommen,
sichteten sie das Gurkenbeet und ernteten. Die Männer wischten
das Erdreich an der Hose ab und verzehrten scheibchenweise die größten
Gurken – und herrje, die waren ja sauer, wahrhaftig sauer!

Das
Foto zeigt Onkel Adolf und mich Ende der vierziger Jahr auf dem Krautland.
Der „Schwede“ hatte seine Flasche Schnaps gewonnen!
Einige Tage danach kam mein Onkel bei uns in Weimar vorbei und erzählte
wie immer das Neueste vom Dorf, auch den Jux mit den sauren Gurken.
Mutter und ich haben lauthals gelacht und fragten, wie er das denn angestellt
habe.
„Ihr wißt doch“, begann er mit spitzbübisch glitzernden
Äuglein, „daß ich im Krieg bei den Sanitätern war.
Ich habe mir ein paar Spritzen mit heimgenommen; denn man kann ja nie
wissen, ob man die im späteren Leben nicht mal braucht. Und nun
fiel mir dieser Spaß ein, zu dem sie mir nützlich sein sollten.
Ich zog in zwei Spritzen Essig auf und ging so bewaffnet am Nachmittag
aufs Krautland. Von bestimmten Pflanzen spritzte ich die größten
Gurken, die, schön durchgezogen, das gelungene Experiment vorgaukelten.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie begeistert meine Kumpane von
den sauren Gurken waren!“
„Und du hast ihnen später gesagt, wie es sich verhält?“
fragte meine Mutter.
„Ach wo, ich wollte ihnen doch nicht die Freude verderben. Sie
wollten zur Kreisleitung und dort die Geschichte erzählen. Am Ende
käme für mich, wenn schon nicht der Nationalpreis, so doch
ein ,Held der Arbeit' oder aber bestimmt eine saftige Prämie heraus,
meinten sie. Wenn es dann an der großen Glocke hängt, ist
immer noch Zeit, mit der Wahrheit herauszurücken“, endete
Onkel Adolf.
Wie die Sache ausgegangen ist, habe ich leider nie erfahren, denn die
Hereingelegten haben das gewiß nur ungern zugegeben, geschweige
denn weitererzählt.
Bei einer zweiten Geschichte, die sich bereits Ende der zwanziger, Anfang
der dreißiger Jahre zugetragen hatte, spielte Onkel Adolf mit
offenen Karten. Der Chef schickte ihn zu einem größeren Bauern
in Ramsla, etliche Kilometer von Weimar entfernt, dort solle er das
Haus mit einem Schieferdach neu eindecken. Wie damals üblich, hatte
der Auftraggeber für das Frühstück zu sorgen, was jedoch
nach Onkels Meinung bei diesem Bauern viel zu mager ausfiel. Das ärgerte
ihn so sehr, daß er beschloß, ihm einen Denkzettel zu verpassen.
In der Mittagspause saß Onkel Adolf also in einer Ecke bei seinen
Schiefertafeln und kritzelte mit einem großen Nagel immer wieder
Striche, Dreiecke und Rhomben in dieselben Kerben, sie sahen aus wie
Hieroglyphen. Dann bearbeitete er die Striche mit Spucke, so daß
sie nicht mehr weiß, sondern schön alt aussahen. Er nahm
dazu die größten, also schwersten Platten.
Als das Dach fast vollständig gedeckt und nur noch die größten,
die Eckplatten, übrig waren, sagte er zu dem Bauern: „Ich
weeß nich, ich weeß nich, die Platten dort haben alle Zeichen,
ich denke schon gar, die haben Steinzeitmenschen gemalt. Gucken Sie
sich die nur mal an! Ich gebe Ihnen den guten Rat, die Platten nach
Weimar ins Museum für Urgeschichte zu bringen, Sie würden
sich gewiß um die Wissenschaft verdient machen.“
Der Bauer besah sich die Schieferplatten gründlich und von allen
Seiten – am Ende steht er vielleicht sogar in der Zeitung!
Also spannte er seine zwei Ochsen an den Leiterwagen, die Platten wurden
sorgfältig in mehrere Decken gehüllt und los ging’s,
den Ettersberg hinauf Richtung Weimar. Im Museum angekommen, wurde die
Fuhre untersucht und von Herrn Direktor Müller genauestens begutachtet.
Mit lächelnder Miene meinte der abschließend: „Guter
Mann, da sind Sie wohl einem echten Spaß auf den Leim gegangen.“
So zitierte der Blamierte wütend den Museumsdirektor, als er meinem
Onkel über den Ausgang der Geschichte berichtete.
„Ja, mein Guter“, hat der gesagt, „wenn das Frühstück
ein bißchen üppiger ausgefallen wäre, dann hätten
Sie sich diesen Weg ersparen können.“
Seinem Nachwuchs
gegenüber verstand mein Onkel allerdings weniger Spaß. Denn
er selbst hat seine Kinder der Reihe nach vermöbelt, wenn sie dummes
Zeug gemacht haben. So war das eben in den zwanziger und dreißiger
Jahren dieses Jahrhunderts. Im Alter von 89 Jahren starb Onkel Adolf
1986 in einem Altersheim. Seine Streiche aber hatten sich herumgesprochen
bis in den letzten Winkel.
Einmal kaufte ich Blumen in Schöndorf, bei der Gärtnerei Speck,
die heute noch besteht – ich wollte sie auf unsere Gräber
in Kleinobringen pflanzen.
„Wohin wollen Sie denn mit den Blumen?“, fragte Herr Speck,
„Sie sind doch keine Hiesige.“
„Nach Kleinobringen will ich.“
„Wen haben Sie denn da?“
„Beck’s Adolf, das ist mein Onkel.“
„Kenn’ ich nicht.“
„Alle nennen ihn den Schweden“, erklärte ich.
Darauf verzog sich Herrn Specks Gesicht zu einem Schmunzeln: „Ach
der, den kennt doch jeder hier ...“
[nach
oben]
Leseprobe
aus: Wo morgens der Hahn kräht, Band 2
[Neuburg/Kammel,
Bayern; 1953]
Der elektrische
Weidezaun
von Georg
Hörmann
„Büable,
morga nachmittag brauscht nit Küah hüata, denn bis dau na
han i mein elektrischa Zau fertig“, rief mir mein Onkel, freudig
erregt entgegen, als ich mittags, von der Schule kommend, an seinem
Bauernhof vorbeilief.
Das war mit gerade recht, so konnte ich mit meinen Freunden am Kammelwehr
zum Baden gehen. Mein Onkel hatte eine kleine Landwirtschaft, und in
den Sommermonaten hütete ich seine Kühe gegen ein willkommenes
Trinkgeld öfters auf der Weide.
Es war in den 50er Jahren, als in meiner Heimat die ersten elektrischen
Weidezäune aufkamen. Zu einer solchen Anlage gehörten spezielle
Batterien, das entsprechende Gerät für die Umwandlung des
Batteriestroms in deutliche spürbare Stromschläge, Draht für
die Stromleitung um die Wiese und Pfähle oder eiserne Pflöcke
mit isolierten Drahthaltern. Natürlich war das alles nicht ganz
billig, so daß die Anschaffung für einen sparsamen schwäbischen
Bauern mit einigen inneren Widerständen verbunden war.
Mein Onkel, der bekannt für seine Basteleien war, hatte sich bei
der BayWa*) die neue Erfindung angeschaut und nach kurzem Überlegen
entschlossen, den Elektrozaun selbst nachzubauen. „Dös wär
ja no schöner, wenn i dös net nabringa dät“, sagte
er zu seiner Frau, „onsra Wiesn isch ja glei henterm Stall, do
brauch i doch koi duira Batterie kaufa, wenn i da Strom glei aus der
Steckdos von der Melkkammer nemma ka.“
Gesagt, getan! In die Pfähle des alten Stacheldrahtzaunes drehte
er vorschriftsmäßig Stifte mit isolierten Haken und zog einen
dünnen Draht, diesen um die Stifte wickelnd, von Pfahl zu Pfahl
um die Wiese. Für die letzten 20 Meter von der Wiese über
den Hof bis zur Melkkammer verwendete er eine isolierte Leitung, weil
ja diese, auf dem Boden liegend, sonst den Strom ins Erdreich abgeleitet
hätte. Er klemmte die Drahtenden in einen Stecker und drückte
ihn in die Steckdose. Der Weidedraht stand unter Strom!
Da er sich schon dachte, daß der Haushaltsstrom etwas stärker
sein könnte als der offizielle Batteriestrom, versäumte er
nicht, an der Seite zum Nachbargrundstück noch ein Schild mit der
Aufschrift
„Vorsicht – Elektrozaun – Lebensgefahr!“
an einen Pfahl zu hängen.
„Rosa, laß die Küah raus, dr Zau isch fertig!“,
rief er seiner Frau im Stall zu.
Diese öffnete die Tür und schnell eilten die hungrigen Kühe
nach der abendlichen Melkzeit der Wiese zu. Der Bauer schloß die
Stangen zum Wieseneingang und blickte stolz und erwartungsvoll auf sein
Werk.
Inzwischen erreichte die erste Kuh den Zaun. Sie streckte den Kopf unter
dem Elektrodraht zu den saftigen Grasbüscheln der Nachbarwiese
und berührte mit dem Nacken den geladenen Draht. Wie vom Blitz
getroffen fiel sie um, wobei sich der Draht im Gehörn verfing.
Eine zweite Kuh, erstaunt über die im Gras liegende Genossin, schnupperte
neugierig an dieser, berührte sie kurz mit ihrem Maul und wurde
schlagartig, wild mit den ausgestreckten Beinen zuckend, umgeworfen.
Der Bauer starrte zunächst wie gelähmt auf die Geschehnisse,
sprang dann auf die Wiese, um die regungslos am Boden liegenden Kühe
vom Zaun wegzuziehen. Er packte den Kopf der zweiten Kuh, der auf dem
Bauch der ersten lag, und – stürzte augenblicklich ebenfalls
zu Boden, wo er bewußtlos liegenblieb.
Inzwischen war auch seine Frau, die ihrem Mann vergeblich vor dieser
Elektrobastelei gewarnt hatte, aus dem Stall gekommen und sah das Unglück.
Schnell entschlossen zog sie, die Ursache erkennend, den Stecker der
elektrischen Leitung aus der Dose und näherte sich den auf der
Wiese liegenden Geschöpfen. Da schlug der Bauer langsam wieder
seine Augen auf. Allmählich erholte er sich von seiner Bewußtlosigkeit,
blickte um sich und sah das Ergebnis seiner Sparsamkeit: zwei tote Kühe!
Zu seiner Frau aber sagte er: „Rosa, i glaub, meine Gommistiefel,
dia du mir zum Namenstag gschenkt hast, hand mir’s Leba grettat.“
Wenn man den Wert einer Kuh in der damaligen Zeit bedenkt – das
Fleisch konnte nur noch für einen Spottpreis auf der Freibank verkauft
werden – hatte sich das Sprichwort wieder einmal bewahrheitet:
„Jeder Sparer hat seinen Zehrer.“ Die Bauernbuben vom Dorf
aber dichteten:
Salomon der Weise
spricht:
Kühe hüten mag ich nicht!
Darum muß der Starkstrom her,
und gescheh’n ist das Malheur:
Ja, die Kuh lag schon am Boden,
er muß den Metzger Gottfried holen.
Damit war bei meinem
Onkel die moderne Technik vorerst gestoppt und ich konnte als Hütebub
wieder ein paar Mark verdienen.
Aus: „Schlüssel-Kinder“,
Reihe ZEITGUT, Band 6.
[nach
oben]
Leseprobe
aus: Wo morgens der Hahn kräht, Band 2
[Seehausen
und Podelwitz bei Leipzig, Sachsen,
damals DDR;
Ende der 60er Jahre]
Ein tierischer Hochzeitstag
von Bärbel Böhme
Gewöhnlich
verbringt man seinen Hochzeitstag zu zweit oder mit den Kindern in gemütlicher
Runde. Von besonderen Ereignissen wird erzählt und angestoßen
auf weitere harmonische Ehejahre. Bei uns verlief ein 17. Dezember -
nämlich unser Hochzeitstag - Ende der 60er Jahre ganz anders.
Wie zu DDR-Zeiten auf dem Dorf üblich, hielten viele Einwohner
Schweine, Hühner, Kaninchen und andere Haustiere, um den Speisezettel
zu bereichern und die Haushaltskasse aufzufüllen. So grunzte auch
bei uns eine Jungsau im Stall, die ausgerechnet an diesem Tag Hochzeit
machen wollte und sollte. Der Wunschbräutigam, ein stattlicher
Zuchteber, wohnte etwa vier Kilometer entfernt im Nachbardorf. Mit viel
Mühe verfrachteten wir also die Sau auf einem sogenannten Disco-Hänger,
einem kleinen Autoanhänger, der mit Preßplatten aus Pappe
rundum verkleidet war. Der Hänger sollte von unserem braven Trabi
gezogen werden. Los ging es also über die Verbindungsstraße
von Seehausen nach Podelwitz. Ein Schlagloch immer breiter und tiefer
als das vorherige, Schneeregen und Dunkelheit. Links am Weg eine lange
Hecke und rechts freies Feld. Der Hänger hüpfte brav hinter
dem Trabi her. Plötzlich ein Knirschen und Krachen!
Nach dem Aussteigen blickten wir in ein ebenso verdutzt dreinschauendes
Schweinegesicht. Die Pappe hatte nicht standgehalten und das Schwein
steckte seinen Kopf laut grunzend aus dem klaffenden Loch. Mir wurde
übel vor Angst bei der Vorstellung, das Tier könnte sich vollends
aus dem Hänger befreien, und wir müßten es auf dem matschigen
Feld verfolgen. Eine Horrorvorstellung!
Mein Mann sicherte die Öffnung notdürftig, und nach kurzer
Zeit erreichten wir ohne weitere Zwischenfälle den Hof, wo sich
der Eber befand. Die Hochzeit fand statt, und unsere Sau wurde in einem
geliehenen richtigen Schweinetransportkasten wieder zurückkutschiert.
Das Ergebnis waren zehn quicklebendige, rosige Ferkelchen. Aber das
Drama ging weiter: Unsere Sau war eine miserable Mutter. Sie schleuderte
ihre Kinder mit der Schnauze durch den Stall und griff jeden, der sich
ihr näherte, mit lautem Grunzen an. So wurden die Ferkel in einem
großen Korb in den Nachbarstall bugsiert und ihr nur zum Säugen
angelegt. Sobald ihrer Meinung nach die Zeremonie beendet war, war artistisches
Können gefragt. Mein Mann mußte sich und die Ferkel mit einem
Sprung über die Mauer schnell in Sicherheit bringen. Es waren turbulente
Wochen, bis die Ferkel selber schnell genug durch ein in die Trennwand
gestemmtes Loch vor ihrer Mutter flüchten konnten.

Mit einem "Disco"-Anhänger
versehen, diente unser Trabi auch zum Transport der Sau zur Schweinehochzeit.
 [nach
oben] [nach
oben]
|