|
Autor
 Oswald
Döpke, geboren 1923 in Eldagsen bei Hannover. 1940–42
Studium an der Braunschweigischen Staatsmusikschule; 1942–45 Soldat;
Verwundung, Gefangenschaft; 1946–48 Schauspieler, 1949–62
Chefdramaturg, Regisseur und ab 1953 Leiter der Hörspiel- und TV-Spielabteilung
von Radio Bremen; 1963–87 Leit. Regisseur im ZDF; Gastprofessor
Mozarteum Salzburg; Regis-seur mehrerer hundert Hörspiele u. Fernsehfilme
und von fünfzig Theaterin-szenierungen (u.a. Münchner Kammerspiele,
Thalia-Theater Hamburg), Autor von Hör- und TV-Spielen, Theaterstücken;
1994 Veröffentlichung von Briefen Ingeborg Bachmanns in der Kulturzeitschrift
»du«; Auszeichnungen u.a. Prix Italia, Kriegsblindenpreis,
1. Preis »Goldenes Prag«, »Taube« von Monte
Carlo, »Silberne Maske« (beste Inszenierung der Spielzeit,
Thalia-Theater); Oswald-Döpke-Archiv Akademie der Künste,
Berlin. Oswald
Döpke, geboren 1923 in Eldagsen bei Hannover. 1940–42
Studium an der Braunschweigischen Staatsmusikschule; 1942–45 Soldat;
Verwundung, Gefangenschaft; 1946–48 Schauspieler, 1949–62
Chefdramaturg, Regisseur und ab 1953 Leiter der Hörspiel- und TV-Spielabteilung
von Radio Bremen; 1963–87 Leit. Regisseur im ZDF; Gastprofessor
Mozarteum Salzburg; Regis-seur mehrerer hundert Hörspiele u. Fernsehfilme
und von fünfzig Theaterin-szenierungen (u.a. Münchner Kammerspiele,
Thalia-Theater Hamburg), Autor von Hör- und TV-Spielen, Theaterstücken;
1994 Veröffentlichung von Briefen Ingeborg Bachmanns in der Kulturzeitschrift
»du«; Auszeichnungen u.a. Prix Italia, Kriegsblindenpreis,
1. Preis »Goldenes Prag«, »Taube« von Monte
Carlo, »Silberne Maske« (beste Inszenierung der Spielzeit,
Thalia-Theater); Oswald-Döpke-Archiv Akademie der Künste,
Berlin.
Oswald Döpke ist verheiratet, hat zwei Kinder und drei Enkel. Er
lebt in München.
Leseproben aus »Ich war Kamerad Pferd«
Kamerad
Pferd I – Prolog 9
Kamerad Pferd III 29
Von Zuhause nach Zuhause
I 51
Ulfilas – Requiem für
ein Pferd 75
[zum
kompletten Inhaltsverzeichnis]
[nach
oben]
[Zeitgut-Startseite]
Kamerad
Pferd I - Prolog
Frankreich, Juli 1942
»Wenn Sie die Oberlippe, Sie können auch Nase dazu sagen,
durch diese Schlaufe ziehen und den Holzgriff um seine Achse drehen
– sehen Sie: so wie ich das jetzt mache! –, bleibt das Tier
wie erstarrt stehen. Schauen Sie sich das an! Der enorme Schmerz, den
die »Nasenbremse«‚ so heißt das Gerät, in
diesem besonders empfindlichen Körperteil verursacht, ermöglicht
Ihnen, selbst komplizierte Operationen durchzuführen, ohne daß
Sie zu weiteren Anästhesiemitteln greifen müssen. Dieser Schmerz
überdeckt den der meisten therapeutischen Eingriffe. Sollte das
Pferd aber trotzdem versuchen, auszubrechen, können Sie zusätzlich
auch noch Ohrenbremsen einsetzen. Sie brauchen die Schlaufe dann nur
– so wie ich das am Maul demonstriert habe – über das
Ohr zu ziehen, das Ohr ist ähnlich empfindlich, und das Pferd rührt
sich nicht mehr von der Stelle. Im Notstand – denn Sie haben ja
nicht immer einen Operationssaal zur Verfügung – können
Sie mit dieser Art Narkose sogar Kolikoperationen machen. Kapiert? Nein?
Gut: Ich zeige es Ihnen noch einmal.«
Die Augen des Grauschimmels traten aus den Höhlen. Er zitterte.
Seine Flanken gingen wie ein Blasebalg. Der mächtige Leib war aufs
äußerste angespannt. Er schweißte stark. Ich sah entsetzt
auf den etwa 25 Zentimeter langen Holzgriff mit dem kurzen Strick, der,
durch zwei Löcher im Abstand von zehn Zentimetern geführt,
eine Schlaufe bildete, in der nun die weiche, warme Oberlippe des Tieres
steckte, um gut 75 Grad grotesk verdreht.
»Und jetzt kommen Sie einmal her! Einer nach dem anderen! Beweisen
Sie mir, daß Sie aufgepaßt haben!«
›Nein!‹ dachte ich. ›Nein, das kann ich nicht! Das werde
ich nie können!‹
Ich trat an das Pferd heran.
»Unser Sänger!« lachte eine Stimme, als ich wieder
zu mir kam.
»Wer kann singen?«
So hatte es heute morgen auf dem Bahnhof von Montreuil-sur-Mer angefangen.
Nein, wir hatten uns nicht verhört: Ein Offizier – seine Uniform
war grün paspeliert – stand vor den Neuankömmlingen aus
der Heimat, die zur Verstärkung der Besatzungsarmee nach Frankreich
verlegt worden waren, und fragte tatsächlich: Wer kann singen?
»Der hier!« Karl stieß mich an und zeigte auf mich.
»Treten Sie mal vor!« sagte der Grünpaspelierte. Seine
Stimme klang freundlich und gar nicht militärisch. Als ich mich
nicht rührte: »Nun kommen Sie schon, genieren Sie sich nicht!«
Ich machte zwei Schritte und sah mich um. Karl grinste. (»Hör
bloß auf, ich bin nicht so leicht zu rühren«, hatte
er im Waggon gesagt, wenn ich mit meiner ausgebildeten Gesangsstimme
renommierte.) Als ich vor ihm stand, spitzte der
Grünpaspelierte die Lippen und sang: Do-re-mi-fa-sol. Er hatte
einen hübschen, kleinen, etwas nasalen Tenor. ›Österreicher‹,
dachte ich.
»Jetzt Sie!«
Ich räusperte mich, dann sang ich die Tonleiter nach. »Ein
Bariton!« Er schien begeistert. »Ein Bariton! Den wir so
dringend brauchen!«
Er schlug mir anerkennend auf die Schulter. Wo war ich hier?
»Jetzt fehlt nur noch ein Baß!«
Aber einen Baß fand er an diesem Tag nicht mehr.
[nach
oben]
[Zeitgut-Startseite]
Kamerad
Pferd III
Rußland, Januar 1943
Im Januar 1943 waren wir nach Rußland verlegt worden. Stalingrad
war gefallen. War das der Anfang vom Ende?
Die Veterinärkompanie lag im Mittelabschnitt, in der Nähe
von Roslawl.
Wir hatten über 600 Patienten. In Frankreich waren es höchstens
300 gewesen. Und hier hatten wir auch noch mit Krankheiten zu tun, die
niemand kannte. Eine dieser neuen Krankheiten befiel nur Kaltblüter.
Sie verschonte die russischen Panjepferde, die anscheinend gegen die
Erreger immun waren. Das brachte uns auf die Spur. Aber es dauerte Wochen,
und viele Patienten verendeten, bis wir herausfanden, daß diese
Krankheit durch Blutkörperparasiten verursacht und von Zecken übertragen
wurde. Endlich hatte man auch einen Impfstoff entwickelt, der aber nur
wirksam war, wenn er unmittelbar nach dem Zeckenbefall gespritzt wurde.
Es schien aussichtslos, unsere Patienten ständig nach Zecken abzusuchen.
Bei mehreren hundert Pferden eine unlösbare Aufgabe. Die Krankheit
hieß Piroplasmose.
Ein ähnlich unlösbares Problem stellte die Milbenpest dar.
Grab- und Saugmilben fraßen die Tiere kahl. Rappe und Schimmel
waren nicht mehr zu unterscheiden. Es herrschte Chaos: Welches Pferd
gehörte welcher Einheit? Einzige Hilfe boten die Hufbrandnummern
im linken Hinterhuf; aber die waren oft nicht rechtzeitig erneuert worden
und bereits ausgewachsen.
Da die Fronten zum Stehen gekommen waren, von gelegentlichen Einbrüchen
in die »deutsche Abwehrfront« abgesehen, gab es nur mehr
wenige verwundete Pferde.
Doch das »Kurhotel Isenberg« florierte auch hier. Starb
ein vordem gesundes Tier, lud das Feldtelefon die Stabsoffiziere zum
Mahl. Ein Pferdeschnitzel kann eine Delikatesse sein. Vor allem der
Sauerbraten. Hier das Rezept: Drei Tage lang in einer Marinade ziehen
lassen, dreimal täglich wenden, dann gut trocknen, mit einer Sauce
aus süßer Sahne, Johannisbeergelee, Rosinen, Korinthen und
einem Schuß Rotwein abschmecken und in Butter und Schmalz fünf
Minuten lang bei großer Hitze von allen Seiten anbraten. Eine
unbeschreibliche Köstlichkeit. Das konnte die Heimat nicht bieten.
Deshalb machten viele Frontoffiziere, bevor sie zum Urlaub in die
Heimat fuhren, bei uns Station. Zum Auftanken, bevor zu Hause die Bomben
fallen, sagten sie. Als Mitbringsel für die Lieben daheim nahmen
sie ein Stück von unserem berühmten Bärenschinken mit,
getrocknetes Pferdefleisch. Und auf dem Weg zurück zur Front legten
sie bei uns noch einmal eine Pause ein. In diesem Jahr wurden wir so
etwas wie ein Erholungsheim im Niemandsland. Irgendwo »da vorn«
lagen die Russen, irgendwo »da hinten« lauerten die Partisanen,
und »daheim« nahm der Bombenkrieg auf die deutschen Städte
zu. ...
[nach
oben]
[Zeitgut-Startseite]
Von
Zuhause nach Zuhause II
Oktober 1943
Mutter brachte mich zum Bahnhof nach Wülfinghausen. Das waren etwa
fünf Kilometer. Wir hatten uns während der letzten Viertelstunde
an der Hand gehalten und nicht gesprochen.
Mutter versuchte, tapfer zu sein und nicht zu weinen. Ihre Fingernägel
hatten sich in meine Handflächen gegraben. »Es ist nicht
so schlimm da draußen«, sagte ich, »die Veterinärkompanie
liegt hinter der Front. Ich fühle mich da fast zu Hause.«
»Zu Hause?« sagte Mutter entsetzt.
»Ja, ich weiß, es klingt komisch, aber so geht es vielen:
Die Kompanie ist so etwas wie ihr Zuhause.« Und ich dachte: ›Es
wäre schlimm, wenn ich zurückkäme und sie wäre nicht
mehr da.‹
Wo war
die 321. Infanterie-Division?
Wo die 321. Infanterie-Division war, war die Veterinärkompanie.
Und wo die Veterinärkompanie war, war ich zu Hause. Seit drei Tagen,
seit ich von zu Hause abgefahren war, hatte ich jeden im Zug gefragt,
keiner wußte es. Vor zwei Wochen noch lag sie südwestlich
von Smolensk. Aber der Zug war gestern von Minsk aus in Richtung Bobruisk
abgebogen, irgendwo in der Nähe von Gomel war nun Endstation. Wir
waren also viel weiter südlich als bei der Abreise.
Seit zwei
Stunden kam und endete Zug auf Zug. Antreten, abzählen, Namen nennen,
Dienstgrad, Truppenteil, aufrücken, anschließen, Schnauze
halten, Pioniere rechts raus, Artilleristen nach links, abzählen,
nachrücken ... Und ständig die Suche nach vertrauten Gesichtern,
das Horchen auf bekannte Namen, Truppenteile, Divisionen.
Einige hatten Glück: Neidisch sah man, daß sich zwei gefunden
hatten, zwei aus derselben Einheit, und die nun alles versuchten, zusammenzubleiben,
sich nicht wieder zu verlieren, in der Hoffnung, den alten Haufen wiederzufinden.
Den alten Haufen wiederfinden! Das war die Sehnsucht aller hier. Den
alten Haufen: die vertraute Gemeinschaft, eine Zufallsgemeinschaft von
Menschen, die nichts anderes miteinander verband als gemeinsame Monate
im Dreck, im Schnee, »in der verdammten Scheiße«,
gemeinsamer Hunger, gemeinsame Angst, aber auch diese irrationale Hoffnung,
gemeinsam sei die Chance zu überleben größer –
eine trügerische Hoffnung, das wußten alle, aber die Vertrautheit
der Gesichter, der Stimmen, der Schicksale, soweit man sie kannte, schien
die Ängste des einzelnen erträglicher zu machen. Da war nichts
mehr von einem gemeinsamen Siegeswillen, und wenn es den jemals gegeben
haben sollte, so hatte ich nicht viel davon bemerkt.
Wo war die 321. Infanterie-Division? Wo war die Veterinärkompanie?
Plötzlich verstand ich, daß Heinz Brand, der mit mir auf
Urlaub fahren sollte, darum gebeten hatte, auf den Urlaub verzichten
und bei der Kompanie bleiben zu dürfen.
Gleich
nach der Ankunft der Züge hatte man uns nach Waffengattungen zusammengestellt.
Aber als ständig neue Züge auf den wenigen Gleisen neben dem
Dorfplatz in dem dreckigen Kaff hielten und die Ankommenden eine kilometerlange
Schlange bildeten, wurden sie, sowie sie aus den Waggons kletterten,
zu Kompanien formiert, Infanteristen neben Artilleristen, Panzerfahrer
neben denen aus den Versorgungseinheiten, Rückkehrer neben solchen,
die auf dem Weg in den Urlaub abgefangen und sofort wieder zurücktransportiert
worden waren, Leichtverletzte, die auf Sanitätsfahrzeuge warteten,
neben Versprengten aufgeriebener Einheiten ...
Die Fronten waren auf der ganzen Linie zusammengebrochen, und die Löcher
mußten gestopft werden.
Plötzlich
fuhr ich zusammen: Da hatte einer »321.« gesagt. Ganz leise.
Ganz nah.
»Jemand hier von der 321.?« fragte ich.
»Mensch, Kamerad Pferd!« Ein alter Obergefreiter, wenige
Meter entfernt, starrte mich an. Er war gerade angekommen und ordnete
sich neben mir ein. »Gott sei Dank, ich bin nicht mehr allein
auf der Welt!«
Ja, verrückt, aber es stimmte, ohne den eigenen Haufen fühlte
man sich allein auf der Welt, allein zwischen fünf-, sechstausend
anderen.
»Siehst du die Sonnenblumen, drüben auf der gegenüberliegenden
Seite?« frage er. »Das wär’ doch was?!«
Als ich den kleinen Vorgarten mit den hohen Sonnenblumen entdeckte,
gut 200 Meter entfernt, wußte ich sofort, was er meinte. Wenn
es uns gelingen würde, in dem allgemeinen Durcheinander
von Aufrücken, Neuformieren, neuem Abzählen, Weiterrücken
zu diesem Garten zu gelangen, hatten wir vielleicht eine Chance, denn
schon begannen Lastwagen vorzufahren und die ersten Kolonnen abzutransportieren.
Wohin die Reise ging, war allen klar. Es wurde still, kaum einer sagte
etwas. Die gelegentlichen Ansätze von Galgenhumor erstickten immer
gleich wieder im Schweigen, das nur vom Geräusch der Wagen, dem
Klappern von Waffen, Ausrüstung und Befehlsgeschrei unterbrochen
wurde.
...
[nach
oben]
[Zeitgut-Startseite]
Ulfilas
– Requiem für ein Pferd
Frankreich, 6. Juni 1944
Es ist jetzt fünf nach zehn Uhr morgens.
Das Sperrfeuer liegt hinter uns, vor uns fallen seit einer Viertelstunde
kaum noch Bomben; die Flugzeuge drehen ab, zurück zur Insel, nachdem
sie die Lastensegler ausgeklinkt haben. Das Feuer der Flak holt viele
herunter; die leichten Kisten platzen wie Spielzeugmodelle. In Trauben
hängen die Fallschirmjäger in der Luft, ein leichtes Ziel
für die Karabiner der Infanterie. Über Bayeux liegt dichter
Rauch. Oberleutnant P. läßt halten und hinter einer Hecke
Deckung suchen. Der »Bocage Normand«, diesem von unzähligen
Hecken durchzogenen Wiesenland, verdanken wir, daß wir bislang
keine Verluste haben. Ich binde das Pferd an einen Ast, es zittert seit
Stunden und bäumt sich bei jedem nahen Einschlag auf.
Oberleutnant P. sieht mich an: »Sie reiten sofort zurück
und holen meine Kartentasche, ich habe sie auf dem Kamin im kleinen
Salon vergessen. Beeilen Sie sich! Treffpunkt Caumont-l’Eventé.
Viel Glück!«
Soll das ein Scherz sein? Vor einer Viertelstunde hat er gesagt: »Daß
wir da rausgekommen sind, aus diesem Inferno, ist ein Wunder. Ich war
zwei Jahre in Rußland, mitten in der Scheiße, aber so etwas
habe ich noch nicht erlebt.« Ich sehe P. an. »Na los!«
sagt er. »Haben Sie mich nicht verstanden? Reiten Sie!«
Es ist jetzt 10 Uhr 15. Um 7 Uhr 30 kam der Befehl, uns von Arromanche
abzusetzen, auf eine rückwärtige Kampflinie, wie es hieß.
Vor uns, hinter uns, über uns: der Weltuntergang.
Zuerst in Richtung Bayeux, dann weiter auf St. Lô zu. Wir sind
gelaufen, geklettert, gekrochen, einzeln und in kleinen Gruppen, jede
Bodenwelle nutzend, die Hecken boten einigen Schutz, aber das Pferd
konnte nicht kriechen, und nur wenige Hecken sind hoch genug: Es bot
ein markantes Ziel.
»Wollen wir das Pferd nicht zurücklassen?« hatte ich
gefragt.
»Sind Sie verrückt? Sie sind hier Meldereiter«, sagte
P., »und ohne Pferd kann ich Sie überhaupt nicht brauchen.
Sie können nicht mal schießen ohne die verdammte Brille.
Haben Sie denn keine Ersatzbrille?«
»Nein, leider auch kaputt.
»Sie Salonsoldat«, sagte P., ...

Oswald Döpke, 1944, mit Pferd
[nach
oben]
[Zeitgut-Startseite]
Inhalt »Ich
war Kamerad Pferd«
Kamerad
Pferd I – Prolog 9
Truppenbetreuung 15
Kamerad Pferd II 21
Lieschen 25
Kamerad Pferd III 29
Maria und Josef 33
Partisanenjagd 39
Fricke 41
Kamerad Pferd IV 45
Steinpilze 49
Von Zuhause nach Zuhause
I 51
Von Zuhause nach Zuhause II 57
Ein guter Freund 63
Der Kopf 69
Kamerad Pferd V 71
Ulfilas – Requiem für
ein Pferd 75
War er verrückt? 81
Kamerad Pferd VI 83
Kamerad Pferd VII 85
Auf der Heide blüht 89
Kamerad Pferd VIII 91
Epilog 103
Nachwort 105
|

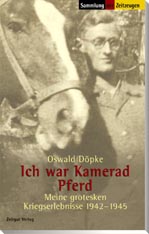 Oswald
Döpke
Oswald
Döpke Oswald
Döpke, geboren 1923 in Eldagsen bei Hannover. 1940–42
Studium an der Braunschweigischen Staatsmusikschule; 1942–45 Soldat;
Verwundung, Gefangenschaft; 1946–48 Schauspieler, 1949–62
Chefdramaturg, Regisseur und ab 1953 Leiter der Hörspiel- und TV-Spielabteilung
von Radio Bremen; 1963–87 Leit. Regisseur im ZDF; Gastprofessor
Mozarteum Salzburg; Regis-seur mehrerer hundert Hörspiele u. Fernsehfilme
und von fünfzig Theaterin-szenierungen (u.a. Münchner Kammerspiele,
Thalia-Theater Hamburg), Autor von Hör- und TV-Spielen, Theaterstücken;
1994 Veröffentlichung von Briefen Ingeborg Bachmanns in der Kulturzeitschrift
»du«; Auszeichnungen u.a. Prix Italia, Kriegsblindenpreis,
1. Preis »Goldenes Prag«, »Taube« von Monte
Carlo, »Silberne Maske« (beste Inszenierung der Spielzeit,
Thalia-Theater); Oswald-Döpke-Archiv Akademie der Künste,
Berlin.
Oswald
Döpke, geboren 1923 in Eldagsen bei Hannover. 1940–42
Studium an der Braunschweigischen Staatsmusikschule; 1942–45 Soldat;
Verwundung, Gefangenschaft; 1946–48 Schauspieler, 1949–62
Chefdramaturg, Regisseur und ab 1953 Leiter der Hörspiel- und TV-Spielabteilung
von Radio Bremen; 1963–87 Leit. Regisseur im ZDF; Gastprofessor
Mozarteum Salzburg; Regis-seur mehrerer hundert Hörspiele u. Fernsehfilme
und von fünfzig Theaterin-szenierungen (u.a. Münchner Kammerspiele,
Thalia-Theater Hamburg), Autor von Hör- und TV-Spielen, Theaterstücken;
1994 Veröffentlichung von Briefen Ingeborg Bachmanns in der Kulturzeitschrift
»du«; Auszeichnungen u.a. Prix Italia, Kriegsblindenpreis,
1. Preis »Goldenes Prag«, »Taube« von Monte
Carlo, »Silberne Maske« (beste Inszenierung der Spielzeit,
Thalia-Theater); Oswald-Döpke-Archiv Akademie der Künste,
Berlin.