
Unvergessene Weihnachten. Band 14
31 besinnliche und heitere Zeitzeugen-Erinnerungen, 1924-2019
192 Seiten mit vielen Abbildungen, Ortsregister, Zeitgut Verlag, Berlin.
Klappenbroschur
ISBN: 978-3-86614-280-0, EURO 10,90
Cover (CMYK) »
31 besinnliche und heitere Zeitzeugen-Erinnerungen, 1924-2019
192 Seiten mit vielen Abbildungen, Ortsregister, Zeitgut Verlag, Berlin.
Klappenbroschur
ISBN: 978-3-86614-280-0, EURO 10,90
Cover (CMYK) »
Weitere Weihnachtsgeschichten aus den Bänden 1-14 der Reihe "Unvergessene Weihnachten" finden Sie hier: Weitere Abdrucktexte »


Das Foto zeigt Jutta Kretschmer (jüngste) und ihre Geschwister am Heiligabend 1949. Foto aus der Geschichte "Ein etwas anderer Weihnachtsabend".
Unvergessene Weihnachten. Band 14
Lese- und Downloadbereich
Pressetext 2.936 Zeichen (PDF) »
Pressetext 2.936 Zeichen (Word) »
Ist eine Geschichte aus Ihrem Postleitzahlgebiet dabei?
Hier finden Sie eine Liste »
Unvergessene Weihnachten. Band 14
31 besinnliche und heitere Zeitzeugen-Erinnerungen
192 Seiten mit vielen Abbildungen,
Zeitgut Verlag, Berlin. www.zeitgut.com
Klappenbroschur ISBN: 978-3-86614-280-0, EURO 10,90
Für technische Probleme oder Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Lydia Beier, Öffentlichkeitsarbeit
Zeitgut Verlag GmbH, Berlin
E-Mail: lydia.beier@zeitgut.com
Tel. 030 - 70 20 93 14
Pressetext 2.936 Zeichen (Word) »
Ist eine Geschichte aus Ihrem Postleitzahlgebiet dabei?
Hier finden Sie eine Liste »
Unvergessene Weihnachten. Band 14
31 besinnliche und heitere Zeitzeugen-Erinnerungen
192 Seiten mit vielen Abbildungen,
Zeitgut Verlag, Berlin. www.zeitgut.com
Klappenbroschur ISBN: 978-3-86614-280-0, EURO 10,90
Für technische Probleme oder Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Lydia Beier, Öffentlichkeitsarbeit
Zeitgut Verlag GmbH, Berlin
E-Mail: lydia.beier@zeitgut.com
Tel. 030 - 70 20 93 14
Sechs kostenfreie Abdrucktexte
Das Nikolaus-Gen (4.701 Zeichen), 3 Bilder PDF-Datei »
Die Weihnachtswurst (2.657 Zeichen) PDF-Datei »
Kalter Hund (3.940 Zeichen) PDF-Datei »
Eine schöne Bescherung (6.026 Zeichen) 1 Bild PDF-Datei »
Weihnachten an der Berliner Mauer oder Engel mit Gewehr (5.055 Zeichen) 2 Bilder PDF-Datei »
Eine wahre Geschichte (3.664 Zeichen) PDF-Datei »
Alle Texte können Sie downloaden und kostenfrei bis zum 15. Dezember veröffentlichen. Die Fotos senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu. (E-Mail an Lydia.beier@zeitgut.com) Wir erwarten von Ihnen lediglich den Abdruck des Quellen-Hinweises mit den bibliografischen Daten am Ende des Textes sowie den Abdruck eines minimal 30 Millimeter breiten Buchcovers.
Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine unserer Weihnachtsgeschichten veröffentlichen möchten, bitten wir Sie um einen Buchtipp vor dem 15. Dezember. Beim Buchtipp wenigstens die oben genannten bibliographische Daten sowie die Abbildung des Buchcovers zu veröffentlichen.
Bitte schicken Sie uns in jedem Fall ein Beleg.
Die Weihnachtswurst (2.657 Zeichen) PDF-Datei »
Kalter Hund (3.940 Zeichen) PDF-Datei »
Eine schöne Bescherung (6.026 Zeichen) 1 Bild PDF-Datei »
Weihnachten an der Berliner Mauer oder Engel mit Gewehr (5.055 Zeichen) 2 Bilder PDF-Datei »
Eine wahre Geschichte (3.664 Zeichen) PDF-Datei »
Alle Texte können Sie downloaden und kostenfrei bis zum 15. Dezember veröffentlichen. Die Fotos senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu. (E-Mail an Lydia.beier@zeitgut.com) Wir erwarten von Ihnen lediglich den Abdruck des Quellen-Hinweises mit den bibliografischen Daten am Ende des Textes sowie den Abdruck eines minimal 30 Millimeter breiten Buchcovers.
Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine unserer Weihnachtsgeschichten veröffentlichen möchten, bitten wir Sie um einen Buchtipp vor dem 15. Dezember. Beim Buchtipp wenigstens die oben genannten bibliographische Daten sowie die Abbildung des Buchcovers zu veröffentlichen.
Bitte schicken Sie uns in jedem Fall ein Beleg.
Das Nikolaus-Gen
Rosemarie Mispagel
Ockenheim, Rheinhessen – Rüsselsheim-Haßloch, Hessen;
Anfang der 1920er Jahre bis heute
Es geschah am Abend des 5. Dezember, Anfang der 1920er Jahre in Ockenheim, einem kleinen Weinort in Rheinhessen. Der kleine Fritz war mit seinem Hund Alli alleine zu Hause. Plötzlich erscholl Lärm im Hausflur und eine vermummte Gestalt mit einem großen Sack polterte in die Stube. Flugs verschwand Fritz unter dem Tisch und legte schutzsuchend den Arm um seinen vierbeinigen Freund. In dem Fremden hatte Fritz den Nikolaus erkannt. Dieser verlangte lautstark, der kleine Bub solle ein Gedicht oder ein Gebet aufsagen. Er drohte ihm mit der Rute und machte Anstalten, davon Gebrauch zu machen.
Fritz linste zwischen den Fransen der Tischdecke hindurch und sah den Nikolaus näherkommen. Furchtsam-mutig klang es in rheinhessischem Idiom wenig schmeichelhaft unter dem Tisch hervor: „Die Mamme is in de Kerch un unser Bawettche is bei’s Reckerts. Hau bloß ab, du K..., du v..., sunscht schick ich dir unsern Alli no!“
Doch Alli zeigte wenig Neigung, den Eindringling zu vertreiben. Sein ausgeprägter Geruchssinn hatte ihm längst verraten, daß der Nikolaus niemand anders war als „unser Bawettche“, die große Schwester von Fritz. Die beiden Geschwister trennten 18 Jahre, doch Barbara, genannt Bawettche und Fritz, den Nachkömmling der Familie, verband lebenslang eine innige Zuneigung.
Dies galt ebenfalls für mich, Rosemarie, die 1949 als Tochter von Fritz geboren wurde und ihre Tante Bawettche genauso mochte wie schon ihr Vater. Eines Tages im Herbst erschien auch bei der kleinen Rosemarie der Nikolaus. Merkwürdigerweise trug er die Eisenbahnerkappe ihres Vaters, was sie schon etwas verwunderte. Es war nur ein kurzer Besuch – vielleicht als Einstimmung auf den Nikolausabend?
Bis dahin konnte oder wollte Tante Bawettche offenbar nicht mehr warten. Das Nikolaus-Gen machte sich bemerkbar.
Als viel angenehmer erlebte ich übrigens die Bescherung durch das Christkind an Heiligabend. In einem langen weissen Kleid, das Gesicht hinter einem Tüllschleier verborgen, sprach es mit hoher Stimme liebevoll zu mir. Ich dürfte höchstens drei Jahre alt gewesen sein, aber ein Schimmer der Erinnerung an diese freundliche Gestalt blieb haften. Ja, und wer war wohl das Christkind gewesen?
Tante Bawettche natürlich. Dies wurde mir allerdings erst später bewußt.
Rosemarie Mispagel
Ockenheim, Rheinhessen – Rüsselsheim-Haßloch, Hessen;
Anfang der 1920er Jahre bis heute
Es geschah am Abend des 5. Dezember, Anfang der 1920er Jahre in Ockenheim, einem kleinen Weinort in Rheinhessen. Der kleine Fritz war mit seinem Hund Alli alleine zu Hause. Plötzlich erscholl Lärm im Hausflur und eine vermummte Gestalt mit einem großen Sack polterte in die Stube. Flugs verschwand Fritz unter dem Tisch und legte schutzsuchend den Arm um seinen vierbeinigen Freund. In dem Fremden hatte Fritz den Nikolaus erkannt. Dieser verlangte lautstark, der kleine Bub solle ein Gedicht oder ein Gebet aufsagen. Er drohte ihm mit der Rute und machte Anstalten, davon Gebrauch zu machen.
Fritz linste zwischen den Fransen der Tischdecke hindurch und sah den Nikolaus näherkommen. Furchtsam-mutig klang es in rheinhessischem Idiom wenig schmeichelhaft unter dem Tisch hervor: „Die Mamme is in de Kerch un unser Bawettche is bei’s Reckerts. Hau bloß ab, du K..., du v..., sunscht schick ich dir unsern Alli no!“
Doch Alli zeigte wenig Neigung, den Eindringling zu vertreiben. Sein ausgeprägter Geruchssinn hatte ihm längst verraten, daß der Nikolaus niemand anders war als „unser Bawettche“, die große Schwester von Fritz. Die beiden Geschwister trennten 18 Jahre, doch Barbara, genannt Bawettche und Fritz, den Nachkömmling der Familie, verband lebenslang eine innige Zuneigung.
Dies galt ebenfalls für mich, Rosemarie, die 1949 als Tochter von Fritz geboren wurde und ihre Tante Bawettche genauso mochte wie schon ihr Vater. Eines Tages im Herbst erschien auch bei der kleinen Rosemarie der Nikolaus. Merkwürdigerweise trug er die Eisenbahnerkappe ihres Vaters, was sie schon etwas verwunderte. Es war nur ein kurzer Besuch – vielleicht als Einstimmung auf den Nikolausabend?
Bis dahin konnte oder wollte Tante Bawettche offenbar nicht mehr warten. Das Nikolaus-Gen machte sich bemerkbar.
Als viel angenehmer erlebte ich übrigens die Bescherung durch das Christkind an Heiligabend. In einem langen weissen Kleid, das Gesicht hinter einem Tüllschleier verborgen, sprach es mit hoher Stimme liebevoll zu mir. Ich dürfte höchstens drei Jahre alt gewesen sein, aber ein Schimmer der Erinnerung an diese freundliche Gestalt blieb haften. Ja, und wer war wohl das Christkind gewesen?
Tante Bawettche natürlich. Dies wurde mir allerdings erst später bewußt.
 Wieder kam der
Abend vor Nikolaus. Ich war etwa vier Jahre alt, als plötzlich jemand die
Treppe zu unserer Wohnung heraufpolterte. Die Tür öffnete sich und eine
mächtige Gestalt trat herein, mit einem gepolsterten Kaffeewärmer auf dem
Haupt!
Wieder kam der
Abend vor Nikolaus. Ich war etwa vier Jahre alt, als plötzlich jemand die
Treppe zu unserer Wohnung heraufpolterte. Die Tür öffnete sich und eine
mächtige Gestalt trat herein, mit einem gepolsterten Kaffeewärmer auf dem
Haupt! Sie rasselte mit Ketten und trug einen gewaltigen Sack auf dem Rücken. Daraus ragten zwei Stiefel, so, als steckte jemand kopfüber in dem Jutesack.
Das von einer
Maske verdeckte Gesicht des Unholds erschreckte mich derart, daß ich auf dem
Arm meiner Mutter zu weinen begann und vor Angst schlotterte. Ob mir dieser
unheimliche Nikolaus Geschenke brachte oder nur mit der Rute drohte, weiß ich
nicht mehr. Der Schreck über jenen Gesellen packte mich mit solcher Macht, daß
ich in der Nacht zu fiebern begann. Daraufhin untersagte meine Mutter dem
wahrhaft nicht heiligen Nikolaus für die Zukunft weitere Besuche bei uns. Und
wer verbarg sich unter der Maske?
Nicht Tante Bawettche, sondern deren Schwägerin Tante Barbara, die ebenso gerne den Nikolaus verkörperte. Besonders die Frauen der Familie schienen das Nikolaus-Gen in sich zu tragen.
Nicht Tante Bawettche, sondern deren Schwägerin Tante Barbara, die ebenso gerne den Nikolaus verkörperte. Besonders die Frauen der Familie schienen das Nikolaus-Gen in sich zu tragen.

Aber so ganz
konnte Tante Barbara nicht auf den Auftritt bei uns zu Hause verzichten.
Mittlerweile dürfte ich elf oder zwölf Jahre gewesen sein, als es am Abend des
5. Dezember klingelte. Vor der Tür stand der Heilige mit Bischofsstab und
Mitra, er strahlte Würde und Ruhe aus. Ihm zugesellt war jedoch ein wilder
Bursche, der als Knecht Ruprecht mit der Rute fuchtelte und auf mich zustürmte.
Nein, das ließ ich mir nicht gefallen!
Kurzerhand zog ich den Bart des Begleiters herunter. Zum Vorschein kam das Gesicht meiner Cousine Erna, die ihre Mutter Barbara bei der Nikolaustour zu den Verwandten begleitete. Mit der unerwarteten Demaskierung des Knecht Ruprechts hatten die beiden Besucher wohl nicht gerechnet und verließen umgehend das Haus, allerdings mit ziemlich betretenen Mienen. Fortan blieben mir Heimsuchungen durch die Nikoläuse der Familie erspart.
Ich wurde vom Nikolaus-Gen anscheinend verschont. Obwohl – so ganz korrekt ist das doch nicht: An jedem 5. Dezember, wenn es dunkelt, klopft auch bei meiner Familie eine Gestalt heftig an die Rolläden, daß Mann und Tochter erschrocken zusammenfahren. Sie verschwindet unerkannt in der Nacht, hinterläßt jedoch kleine Geschenke und Süßigkeiten. Eines sei verraten: Sie ist weiblich.
Kurzerhand zog ich den Bart des Begleiters herunter. Zum Vorschein kam das Gesicht meiner Cousine Erna, die ihre Mutter Barbara bei der Nikolaustour zu den Verwandten begleitete. Mit der unerwarteten Demaskierung des Knecht Ruprechts hatten die beiden Besucher wohl nicht gerechnet und verließen umgehend das Haus, allerdings mit ziemlich betretenen Mienen. Fortan blieben mir Heimsuchungen durch die Nikoläuse der Familie erspart.
Ich wurde vom Nikolaus-Gen anscheinend verschont. Obwohl – so ganz korrekt ist das doch nicht: An jedem 5. Dezember, wenn es dunkelt, klopft auch bei meiner Familie eine Gestalt heftig an die Rolläden, daß Mann und Tochter erschrocken zusammenfahren. Sie verschwindet unerkannt in der Nacht, hinterläßt jedoch kleine Geschenke und Süßigkeiten. Eines sei verraten: Sie ist weiblich.
 Die erste Nikolaus-Generation: Der kleine Fritz und
seine ältere Schwester Barbara, Bawettche genannt (Foto im oberen Teil), Anfang der 1920er Jahre.
Die erste Nikolaus-Generation: Der kleine Fritz und
seine ältere Schwester Barbara, Bawettche genannt (Foto im oberen Teil), Anfang der 1920er Jahre.
Die Weihnachtswurst
Anna Körn
Untermaßfeld, Kreis Meiningen, Thüringen, 1946 – 1960 / bis 2005
Im hungrigen Jahr 1946 erzählte uns eine Nachbarin, daß einst zu Friedenszeiten der Hund ihrer Bekannten am Heiligabend einen Ringel Fleischwurst um den Hals gehangen bekommen habe, damit auch er merken sollte, daß heute ein besonderer Tag ist. Ich – damals 8½ Jahre alt – sagte hinterher zu meiner Mutter, daß ich gern „denen“ ihr Hund sein würde. Und meine Mutter antwortete: „Ich auch.“
Im darauf folgenden Jahr 1947 erinnerte ich mich wieder an den Hund mit dem großen Ringel Fleischwurst um den Hals, denn es war ein großer Hund. Auch 1948 träumte ich von diesem Ringel, obwohl ich wußte, mein Weihnachtstraum konnte aufgrund der allgemeinen Ernährungslage nicht in Erfüllung gehen.
Aber zu Weihnachten 1949 ging mein Wunsch in Erfüllung: Ich bekam ein Ringelchen Fleischwurst. Zwar war es nicht viel größer als eine Bockwurst, aber die Notjahre hatten mich Bescheidenheit gelehrt. Ich war glücklich!
Ich beschloß, meine Kostbarkeit erst zu essen, wenn wir aus der Mitternachtsmette heimkamen, damit ich die Vorfreude richtig auskosten konnte. Und so geschah es dann auch. Für Vater und Mutter schnitt ich ebenfalls eine Kostprobe ab, die bei meinem Vater Begehrlichkeit nach mehr auslöste. Aber Mama hatte nur diesen einen Ringel gekauft. Den Hinweis meines Vaters, daß ich Brot zur Wurst essen sollte, lehnte ich mit der Begründung ab, daß der Hund auch kein Brot brauchte.
Im folgenden Jahr war mein Ringel deshalb schon wesentlich größer und ich konnte freigiebiger sein. Und schließlich war er später so groß, daß wir alle eine zusätzliche Nachtmahlzeit hatten. Wir aßen den Ringel gleich kalt, denn das Feuer im Küchenherd war nach der Mette längst ausgegangen. Und wer hatte schon Lust zu warten, bis der Ringel heiß ist?
Diese Wurstnachtmahlzeit gehörte so nach und nach zu unserem Weihnachten. Das blieb so, bis ich mein Elternhaus verließ. Selber habe ich nie mehr einen Ringel Fleischwurst gekauft, denn in der Familie meines Mannes war es Brauch, daß man nach der Mette Sauerkraut aß, in welches pro Person eine Polnische (Wurst) und ein Stückchen Schinkenspeck hineingekocht wurden. Dazu wurde Brot gereicht. Das Sauerkraut wurde vor dem Kirchgang angekocht, es köchelte auf dem ausgehenden Feuer weiter und war noch schön heiß, wenn wir aus der Christmette nach Hause kamen. Diesen schönen Brauch habe ich auch in unsere junge Familie übernommen. Unsere Kinder wuchsen damit auf und kannten es nicht anders. Als es keinen Mitternachtsgottesdienst gab, wurde das Sauerkraut unser Abendessen, welches sich gut schon mittags nebenbei vorbereiten ließ.
Kalter Hund
Rosemarie Schreuer
Berlin; 1947
Weihnachten 1947 in Berlin. Süßigkeiten, gar Schokolade gab es nicht zu kaufen. Jedenfalls nicht in normalen Läden. Nur auf dem „Schwarzen Markt“. Dort hatte meine Mutter Kakao, Kokosfett und Leibnitzkekse erstanden und aus diesen Zutaten einen sogenannten Kalten Hund gezaubert. Dieses Gebäck schmeckte am besten, wenn es längere Zeit lagerte. Sie wollte uns damit am Heiligen Abend überraschen. Im Wohnzimmer stand ein altes Büfett, dessen schier unergründliches Inneres mehr als einen halben Meter tief war und bis knapp über den Boden reichte. Wer Geschirr herausholen wollte, mußte sich also tief bücken oder sogar hinknien. Ein ideales Versteck für den Kalten Hund, fand Mutter, und verstaute ihn weit hinten in einer der Ecken an der Rückwand.
Der Zufall wollte es, daß meine ältere Schwester eine Suppenterrine holen sollte und dabei die Köstlichkeit entdeckte. Vorsichtig brach sie einige Bröckchen ab und steckte sie in den Mund. Gerade als ihr weit vorgebeugter Oberkörper wieder aus dem Büfett auftauchte, kam ich ins Zimmer und merkte sofort, daß sie etwas naschte.
„Was kaust du?“, fragte ich sie.
„Nichts“, lautete ihre nicht sehr überzeugende Antwort. Aber ich war schon auf den Knien und suchte zwischen dem Geschirr. Nicht lange, dann roch ich es, und schon hatte auch ich ein paar Krümel im Mund. Einfach köstlich!
Aber auch ich wurde entdeckt, denn als ich wieder zum Vorschein kam, stand unsere jüngste Schwester hinter mir und fragte mich, was ich da im Büffett gemacht hätte. Doch bevor ich antworten konnte, war sie, genauso neugierig wie wir zwei Älteren zuvor, ebenfalls im Büfett verschwunden.
„Das ist lecker!“, hörten wir sie schmatzen. An den Beinen zog ich sie wieder heraus.
„Sei still, das ist eine Weihnachtsüberraschung! Du darfst zu keinem davon sprechen“, schärften wir ihr ein.
Nach einigen Tagen, ich war gerade alleine im Wohnzimmer, konnte ich der Versuchung nicht widerstehen und wollte schnell einmal nach dem Kalten Hund sehen. Nein, nahm ich mir vor, nicht naschen, aber wenigstens den herrlichen Duft riechen. Aber was entdeckte ich da?
Der Kuchen war sehr viel kleiner geworden!
Sogar ein Messer war dort deponiert!
Stillschweigend nahm ich das zur Kenntnis. Es blieb unser Geheimnis. Überhaupt sprach keine über unsere Entdeckung. Aber Tag für Tag säbelte eine Kinderhand ein weiteres Stückchen ab, und am Heiligen Abend war nur noch ein trauriges Restchen in der Kastenform übrig.
Heiligabend. Mit schlechtem Gewissen spielten wir drei Schwestern im Wohnzimmer „Mensch ärgere Dich nicht“. Nebenan im Erkerzimmer wurde der Baum geschmückt. Leise Musik, das Rascheln von Papier, Klirren von Gläsern oder ein zartes Klingeln waren zu hören und erhöhten die Spannung. Aber die war in diesem Jahr bei uns drei Schwestern nicht nur freudig, es mischte sich auch ängstliche Sorge in unsere Erwartungen. Bald würde unser Frevel am Kalten Hund offenbar – was dann?
Noch flüsterten Vater und Mutter leise im Weihnachtszimmer, das Schlüsselloch war verhängt. Erst zur Bescherung, wenn die Kerzen brannten, durften wir es betreten.
Jetzt hörten wir die Tür knarren, Schritte näherten sich, und beschwingt trat unsere Mutter ein, lächelte uns zu – und ging in Richtung Büfett. Meine ältere Schwester mußte plötzlich nötig aufs Klo. Ich rannte hinterher und drängelte mich auch hinein. Schon polterte unsere kleine Schwester an die Tür und zwängte sich zwischen uns.
„Was ist denn mit euch los?“, rief unsere Mutter erstaunt.
Vorsichtshalber verschlossen wir die Tür und hielten lauschend unsere Köpfe dagegen.
Dann kam ein Schrei.
„Ist etwas passiert?“, fragte laut unser Vater.
„Ja“, kam die Antwort, „Mäuse!“
„Waaas?“, hörten wir Vater, „etwa zweibeinige Mäuse?“
„Ja, drei zweibeinige Mäuse!“
Stille. Ein Klopfen an der Badezimmertür schreckte uns auf. Und dann die Erleichterung.
„Kommt schon heraus“, rief unsere Mutter, „wir teilen uns eben den Rest vom Kalten Hund!“
Eine schöne Bescherung
Christa Weniger

Meine Flüchtlingsfamilie
Weihnachten 1954 in Westdeutschland. Das Mädchen in der Mitte bin ich.
Tempelhof-Schöneberg,
Westberlin; 1952
Findet mich der Weihnachtsmann überhaupt im Lager? Woher konnte er denn wissen, wo sich die zu beschenkenden Kinder gerade aufhielten?
Dieses Problem bedrückte mich Siebenjährige seit einigen Tagen. Genau seit dem Zeitpunkt, als ich begriff, daß ich nie mehr in mein kleines Dorf an der Elbe zurückkehren würde. Voriges Jahr hatte der Weihnachtsmann noch Karin, die große Puppe aus Pappmaché, für mich gebracht. Als es zu spät war, stellte ich fest, daß sie nicht mitgenommen wurde. Ich drängte meine große Schwester, mit mir nach Ferbitz zu fahren und sie zu holen. Die Puppe würde stumm in ihrem Wagen liegen und auf mich warten, war ich mir sicher.
Und erst meine Freundin Heidi! Sie war sicher ebenso von unserer Trennung überrascht und traurig, wie ich es war. Hätten sie statt meiner Puppe lieber meinen Tornister zurückgelassen! Der war, obwohl erst drei Monate alt, völlig überflüssig während der nächsten Monate in den verschiedenen Flüchtlingslagern.
Die brennendere Frage waren zwei Tage vor dem Heiligen Abend jedoch die Geschenke. Meine Mutter beruhigte mich und sagte, daß ich bestimmt auch an diesem Weihnachtsfest Gaben erhalten würde, nur halt kleinere. Man müsse da schon bescheiden sein, weil der Weihnachtsmann ja alle Kinder des Lagers beschenken wolle. Aber es kam ganz anders.
In diesem Jahr kam zum ersten Mal das Christkind. Es beschenkte mich überaus reichlich – so viel habe ich noch nie zuvor und auch später nie wieder bekommen – und zwar schon einen Tag vor dem Heiligen Abend 1952. Gerade, als ich mit meiner Familie im Lager an der General-Pape-Straße in Westberlin eintraf und wir uns in der Verwaltung registrieren lassen und auf die Zuweisung von Schlafplätzen warten wollten, kamen drei Schülerinnen den Gang entlang. Sie waren gut gekleidet und bestimmt doppelt so alt wie ich. Die drei Jugendlichen suchten ein Mädchen und einen Jungen aus dem Lager, die sie zu einer Weihnachtsfeier und Bescherung in ihr nahegelegenes Gymnasium einladen wollten. Die Rote-Kreuz-Schwester drehte sich zu uns um und sagte: „Hier haben wir ja schon ein Kind in dem entsprechenden Alter!“
So wurde ich zufällig zu einer Hauptperson. Ebenso der Junge, der gerade über den Flur der ehemaligen Kaserne rannte. Er war auch etwa sieben Jahre alt. Wir wurden am nächsten Nachmittag von den Schülerinnen abgeholt und in eine Schulklasse geführt, aus der fast alle Tische und Stühle ausgeräumt waren. Ein bis zur Zimmerdecke reichender Weihnachtsbaum war im hinteren Teil des Klassenraumes aufgestellt. Als wir das Zimmer betraten, strahlte er in hellem Kerzenschein und war geschmückt mit Lametta und Strohsternen. Wir staunten.
Unsere Blicke blieben auf den vielen, bunten Päckchen haften, die unter dem Weihnachtsbaum lagen. Wir ahnten, daß diese Päckchen für uns sein würden, zumindest hofften wir es. Bevor es in diesem Punkt Gewißheit gab, wurde Kakao getrunken und Blechkuchen gegessen.
Danach führten einige Schüler ein Kasperletheater für ihre beiden Gäste auf. An den Spielverlauf kann ich mich kaum erinnern, nur, daß es an verschiedenen Stellen donnerte. Das laute Geräusch riß mich aus meiner Tagträumerei, während der ich oft zu den Geschenken hinüberschaute und sich meine Gedanken mit dem möglichen Inhalt beschäftigten. Ich fragte mich, ob das große, knallrote Paket für mich oder für den Jungen war.
Endlich war es so weit! Wir durften die Gaben auspacken. Was da zum Vorschein kam, konnte zuvor keinesfalls erahnt werden und übertraf die kühnsten Erwartungen!
Ich hatte keinen Blick für den Jungen aus dem Lager. Mein ganzes Interesse nahmen meine Geschenke in Anspruch. Nach und nach kam eine Zelluloidpuppe in einer blauen Wiege, die mit Blümchen bemalt war, zum Vorschein, rotkarierte Kissen lagen darin und sie hatte einen Himmel aus leichtem Stoff mit Rüschen. So etwas kannte ich noch nicht. Es sah traumhaft aus und ließ die Erinnerung an die zurückgelassene Pappmachepuppé fast vergessen.
Eine weitere Puppe war etwas kleiner, hatte einen bräunlichen Teint, krumme Beine und war aus Porzellan. Sie trug einen Strampelanzug. Ich bekam noch einige mittelgroße Puppen und ein winziges Gummipüppchen in einem blaugrauen Sportkinderwagen aus Blech. Mehrere Gesellschaftsspiele und Kleidungsstücke für mein Alter konnte ich noch auspacken. An einen weißen Schal und einen gemusterten Pullover kann ich mich erinnern. Vor lauter Aufregung hatte ich rote Wangen. Insgeheim wünschte ich mir, daß von nun an immer das Christkind kommen möge.
Als wir wieder ins Lager zurückgebracht wurden, bekam jeder von uns ein kleines Tannenbäumchen, das in einem Blumentopf steckte und mit Kerzen, Lametta und Strohsternen geschmückt war. Das Bäumchen wurde auf den einzigen Tisch unserer Kasernenstube gestellt und verbreitete Weihnachtsstimmung für alle der rund siebzig dort Einquartierten.
In diesem Jahr erlebte ich sogar zweimal eine Weihnachtsbescherung. Für die Flüchtlingskinder aller Berliner Lager richteten die alliierten Besatzer ebenfalls eine Weihnachtsfeier aus. Wir wurden mit mattgrünen Mannschaftsbussen zu einem riesengroßen Saal gefahren. Dort saßen an langen Reihen weiß eingedeckter Tische sehr viele Kinder und warteten auf Kakao und naschten Plätzchen. Die Tischreihen waren mit Tannengrün, Plätzchen, Äpfeln und Apfelsinen geschmückt. Manche Kinder sagten Gedichte auf, während sie auf der großen Bühne standen, wo sie ihre bunten Tüten, die mit süßen Leckereien gefüllt waren, in Empfang nahmen. Aber es bekamen alle Kinder die gleichen Geschenke – gleichwohl, ob sie Gedichte vortrugen oder nicht. Meine Anspannung löste sich, als ich meine bunte Tüte und ein Kinderbuch in den Händen hielt.
Ich war selig. Zwei Bescherungen anläßlich eines Weihnachtsfestes!
So konnte es im „goldenen Westen“ weitergehen. Ich würde den Wechsel vom Weihnachtsmann zum Christkind bestimmt gut verkraften. Er war sowieso viel strenger. Künftig würde ich innig und mit aller Kraft meines Herzens an das geheimnisvolle Christkind glauben!
Findet mich der Weihnachtsmann überhaupt im Lager? Woher konnte er denn wissen, wo sich die zu beschenkenden Kinder gerade aufhielten?
Dieses Problem bedrückte mich Siebenjährige seit einigen Tagen. Genau seit dem Zeitpunkt, als ich begriff, daß ich nie mehr in mein kleines Dorf an der Elbe zurückkehren würde. Voriges Jahr hatte der Weihnachtsmann noch Karin, die große Puppe aus Pappmaché, für mich gebracht. Als es zu spät war, stellte ich fest, daß sie nicht mitgenommen wurde. Ich drängte meine große Schwester, mit mir nach Ferbitz zu fahren und sie zu holen. Die Puppe würde stumm in ihrem Wagen liegen und auf mich warten, war ich mir sicher.
Und erst meine Freundin Heidi! Sie war sicher ebenso von unserer Trennung überrascht und traurig, wie ich es war. Hätten sie statt meiner Puppe lieber meinen Tornister zurückgelassen! Der war, obwohl erst drei Monate alt, völlig überflüssig während der nächsten Monate in den verschiedenen Flüchtlingslagern.
Die brennendere Frage waren zwei Tage vor dem Heiligen Abend jedoch die Geschenke. Meine Mutter beruhigte mich und sagte, daß ich bestimmt auch an diesem Weihnachtsfest Gaben erhalten würde, nur halt kleinere. Man müsse da schon bescheiden sein, weil der Weihnachtsmann ja alle Kinder des Lagers beschenken wolle. Aber es kam ganz anders.
In diesem Jahr kam zum ersten Mal das Christkind. Es beschenkte mich überaus reichlich – so viel habe ich noch nie zuvor und auch später nie wieder bekommen – und zwar schon einen Tag vor dem Heiligen Abend 1952. Gerade, als ich mit meiner Familie im Lager an der General-Pape-Straße in Westberlin eintraf und wir uns in der Verwaltung registrieren lassen und auf die Zuweisung von Schlafplätzen warten wollten, kamen drei Schülerinnen den Gang entlang. Sie waren gut gekleidet und bestimmt doppelt so alt wie ich. Die drei Jugendlichen suchten ein Mädchen und einen Jungen aus dem Lager, die sie zu einer Weihnachtsfeier und Bescherung in ihr nahegelegenes Gymnasium einladen wollten. Die Rote-Kreuz-Schwester drehte sich zu uns um und sagte: „Hier haben wir ja schon ein Kind in dem entsprechenden Alter!“
So wurde ich zufällig zu einer Hauptperson. Ebenso der Junge, der gerade über den Flur der ehemaligen Kaserne rannte. Er war auch etwa sieben Jahre alt. Wir wurden am nächsten Nachmittag von den Schülerinnen abgeholt und in eine Schulklasse geführt, aus der fast alle Tische und Stühle ausgeräumt waren. Ein bis zur Zimmerdecke reichender Weihnachtsbaum war im hinteren Teil des Klassenraumes aufgestellt. Als wir das Zimmer betraten, strahlte er in hellem Kerzenschein und war geschmückt mit Lametta und Strohsternen. Wir staunten.
Unsere Blicke blieben auf den vielen, bunten Päckchen haften, die unter dem Weihnachtsbaum lagen. Wir ahnten, daß diese Päckchen für uns sein würden, zumindest hofften wir es. Bevor es in diesem Punkt Gewißheit gab, wurde Kakao getrunken und Blechkuchen gegessen.
Danach führten einige Schüler ein Kasperletheater für ihre beiden Gäste auf. An den Spielverlauf kann ich mich kaum erinnern, nur, daß es an verschiedenen Stellen donnerte. Das laute Geräusch riß mich aus meiner Tagträumerei, während der ich oft zu den Geschenken hinüberschaute und sich meine Gedanken mit dem möglichen Inhalt beschäftigten. Ich fragte mich, ob das große, knallrote Paket für mich oder für den Jungen war.
Endlich war es so weit! Wir durften die Gaben auspacken. Was da zum Vorschein kam, konnte zuvor keinesfalls erahnt werden und übertraf die kühnsten Erwartungen!
Ich hatte keinen Blick für den Jungen aus dem Lager. Mein ganzes Interesse nahmen meine Geschenke in Anspruch. Nach und nach kam eine Zelluloidpuppe in einer blauen Wiege, die mit Blümchen bemalt war, zum Vorschein, rotkarierte Kissen lagen darin und sie hatte einen Himmel aus leichtem Stoff mit Rüschen. So etwas kannte ich noch nicht. Es sah traumhaft aus und ließ die Erinnerung an die zurückgelassene Pappmachepuppé fast vergessen.
Eine weitere Puppe war etwas kleiner, hatte einen bräunlichen Teint, krumme Beine und war aus Porzellan. Sie trug einen Strampelanzug. Ich bekam noch einige mittelgroße Puppen und ein winziges Gummipüppchen in einem blaugrauen Sportkinderwagen aus Blech. Mehrere Gesellschaftsspiele und Kleidungsstücke für mein Alter konnte ich noch auspacken. An einen weißen Schal und einen gemusterten Pullover kann ich mich erinnern. Vor lauter Aufregung hatte ich rote Wangen. Insgeheim wünschte ich mir, daß von nun an immer das Christkind kommen möge.
Als wir wieder ins Lager zurückgebracht wurden, bekam jeder von uns ein kleines Tannenbäumchen, das in einem Blumentopf steckte und mit Kerzen, Lametta und Strohsternen geschmückt war. Das Bäumchen wurde auf den einzigen Tisch unserer Kasernenstube gestellt und verbreitete Weihnachtsstimmung für alle der rund siebzig dort Einquartierten.
In diesem Jahr erlebte ich sogar zweimal eine Weihnachtsbescherung. Für die Flüchtlingskinder aller Berliner Lager richteten die alliierten Besatzer ebenfalls eine Weihnachtsfeier aus. Wir wurden mit mattgrünen Mannschaftsbussen zu einem riesengroßen Saal gefahren. Dort saßen an langen Reihen weiß eingedeckter Tische sehr viele Kinder und warteten auf Kakao und naschten Plätzchen. Die Tischreihen waren mit Tannengrün, Plätzchen, Äpfeln und Apfelsinen geschmückt. Manche Kinder sagten Gedichte auf, während sie auf der großen Bühne standen, wo sie ihre bunten Tüten, die mit süßen Leckereien gefüllt waren, in Empfang nahmen. Aber es bekamen alle Kinder die gleichen Geschenke – gleichwohl, ob sie Gedichte vortrugen oder nicht. Meine Anspannung löste sich, als ich meine bunte Tüte und ein Kinderbuch in den Händen hielt.
Ich war selig. Zwei Bescherungen anläßlich eines Weihnachtsfestes!
So konnte es im „goldenen Westen“ weitergehen. Ich würde den Wechsel vom Weihnachtsmann zum Christkind bestimmt gut verkraften. Er war sowieso viel strenger. Künftig würde ich innig und mit aller Kraft meines Herzens an das geheimnisvolle Christkind glauben!
Weihnachten an der Berliner Mauer oder Engel mit Gewehr
Dagmar Göstel

Leider haben meine Eltern kein Datum vermerkt. Das ist mein Vater Klaus Göstel mit meiner Schwester Manuela, daneben meine Mutter Waltraud Göstel mit mir. Das muss Weihnachten 1963 oder 1964 gewesen sein. (Dieses Foto ist nicht im Buch abgebildet)
Berlin-Charlottenburg –
Berlin-Weißensee; 25. Dezember 1964
Die Gefühle rund um das Weihnachtsfest im Berlin meiner Kindheit waren geprägt von der Teilung der Stadt in West und Ost. Die 1961 gebaute Berliner Mauer bedeutete nicht nur einen Riß quer durch Berlin, sondern auch mitten durch unsere Familie. Meine Eltern, meine jüngere Schwester Manuela und ich lebten im Westteil, unsere Großeltern und unsere Lieblingstante im Ostteil der Stadt. Da machte sich bei aller weihnachtlichen Vorfreude gerade in der Adventszeit zugleich immer eine gewisse Traurigkeit über die Trennung breit. So sicher Lametta unseren Weihnachtsbaum schmückte, so sicher gehörte der erste Weihnachtsfeiertag meinen Großeltern und meiner Tante „drüben“. Das bedeutete sehr frühes Aufstehen an jedem 25. Dezember, dann stundenlanges Warten an der Grenze. Die „Vopos“ beäugten uns kritisch – oder kam es uns nur so vor, weil meine Eltern immer verbotene Dinge dabei hatten?
Wurst und Fleisch für Omas Kochkünste, West-Zeitungen für Opa, eine Schallplatte für meine Tante – nach menschlichem Ermessen zwar alles sicher versteckt und gut getarnt in Tüten und Taschen, aber man wußte ja nie ...
Der Trick bestand darin, die Tüten und Taschen sofort bereitwillig und geöffnet dem jeweiligen Kontrolleur unter die Nase zu halten, noch bevor er uns dazu aufforderte. Diese „freiwillige Offenheit“ wurde meistens mit nur oberflächlicher Taschenkontrolle belohnt, die nie in die Tiefe ging. Ich erinnere mich, wie mein Vater einmal, sehr zum Vergnügen von uns Kindern, eine Fleischwurst in der Innentasche seiner Anzugjacke versteckte. Puuuuh, war diese Hürde genommen, konnten wir schon bald Oma, Opa und unsere Tante in ihrer ofengeheizten Stube in Weißensee in die Arme schließen und bei Kerzenlicht, Dresdner Stollen und Omas heißgeliebtem Rosinenkuchen für ein paar Stunden so tun, als gäbe es keine trennende Mauer ...
Die Gefühle rund um das Weihnachtsfest im Berlin meiner Kindheit waren geprägt von der Teilung der Stadt in West und Ost. Die 1961 gebaute Berliner Mauer bedeutete nicht nur einen Riß quer durch Berlin, sondern auch mitten durch unsere Familie. Meine Eltern, meine jüngere Schwester Manuela und ich lebten im Westteil, unsere Großeltern und unsere Lieblingstante im Ostteil der Stadt. Da machte sich bei aller weihnachtlichen Vorfreude gerade in der Adventszeit zugleich immer eine gewisse Traurigkeit über die Trennung breit. So sicher Lametta unseren Weihnachtsbaum schmückte, so sicher gehörte der erste Weihnachtsfeiertag meinen Großeltern und meiner Tante „drüben“. Das bedeutete sehr frühes Aufstehen an jedem 25. Dezember, dann stundenlanges Warten an der Grenze. Die „Vopos“ beäugten uns kritisch – oder kam es uns nur so vor, weil meine Eltern immer verbotene Dinge dabei hatten?
Wurst und Fleisch für Omas Kochkünste, West-Zeitungen für Opa, eine Schallplatte für meine Tante – nach menschlichem Ermessen zwar alles sicher versteckt und gut getarnt in Tüten und Taschen, aber man wußte ja nie ...
Der Trick bestand darin, die Tüten und Taschen sofort bereitwillig und geöffnet dem jeweiligen Kontrolleur unter die Nase zu halten, noch bevor er uns dazu aufforderte. Diese „freiwillige Offenheit“ wurde meistens mit nur oberflächlicher Taschenkontrolle belohnt, die nie in die Tiefe ging. Ich erinnere mich, wie mein Vater einmal, sehr zum Vergnügen von uns Kindern, eine Fleischwurst in der Innentasche seiner Anzugjacke versteckte. Puuuuh, war diese Hürde genommen, konnten wir schon bald Oma, Opa und unsere Tante in ihrer ofengeheizten Stube in Weißensee in die Arme schließen und bei Kerzenlicht, Dresdner Stollen und Omas heißgeliebtem Rosinenkuchen für ein paar Stunden so tun, als gäbe es keine trennende Mauer ...
 Am Abend dann, alle Jahre
wieder, das Ganze rückwärts: Ausgestattet mit Geschenken meiner Großeltern,
führte der Heimweg zurück zur Grenze. Da passierte zu Weihnachten 1964 am
Grenzübergang Bornholmer Straße die Fast-Katastrophe: Meine Mutter reichte
unsere Ausweise dem Grenzsoldaten. Der guckte, stutzte, guckte wieder,
blätterte wild in den Ausweisen herum und schnauzte schließlich: „Sie sind
heute Morgen mit nur einem Kind in die DDR eingereist, also reist jetzt auch
nur eines wieder aus!“
Am Abend dann, alle Jahre
wieder, das Ganze rückwärts: Ausgestattet mit Geschenken meiner Großeltern,
führte der Heimweg zurück zur Grenze. Da passierte zu Weihnachten 1964 am
Grenzübergang Bornholmer Straße die Fast-Katastrophe: Meine Mutter reichte
unsere Ausweise dem Grenzsoldaten. Der guckte, stutzte, guckte wieder,
blätterte wild in den Ausweisen herum und schnauzte schließlich: „Sie sind
heute Morgen mit nur einem Kind in die DDR eingereist, also reist jetzt auch
nur eines wieder aus!“
Meine Mutter war eine zierliche
Frau, aber sie wurde in diesem Moment – zumindest stimmlich – zur Riesin. Ich
habe ihre Antwort in schönstem Berliner Dialekt noch heute, über fünf
Jahrzehnte später, im Ohr: „Sie, junger Mann, wir sind mit zwee Mädels
anjekommen und nehmen ooch beede wieder mit zurück – und wenn ick hier steh’,
bis der letzte Schnee jetaut is’!“
Ungerührt rief man uns aus der Warteschlange und ließ uns abseits stehen. Es war fast stockdunkel, ein paar Grenzlaternen gaben kaum Licht, vielmehr tauchten sie die Szenerie in Unheimlichkeit. Wir waren allein, standen ohne Ausweise mitten in der Grenzanlage. Es gab kein Vor und kein Zurück. Wir warteten. Minuten. Eine Stunde.
Die Angst kroch ganz langsam überallhin – und die winterliche Eiseskälte hinterher. Bald kämpfte meine Mutter mit den Tränen, was sie zwar zu verbergen suchte, aber ihr Kinn gehorchte ihr nicht, es zitterte verdächtig. Noch heute höre ich meinen Vater beruhigend auf sie einreden, aber der flatterige Schatten seiner Hand, als er an seiner Zigarette zog, verriet auch ihn. Kindern entgeht so etwas nicht!
Meine kleine Schwester war sechs und ich war acht Jahre alt. Die Eltern hatten also Angst, das bedeutete echte Gefahr.
Plötzlich, wie aus dem Nichts, trat ein paar Meter weiter ein junger Grenzsoldat aus dem Dunkel seines Wachhäuschens. In Zeitlupe kam er auf uns zu, ein Gewehr auf dem Rücken, und umrundete uns ein ums andere Mal. Dabei ging er immer ganz nah an meine Eltern heran und flüsterte Ihnen unaufhörlich zu: „Haben Sie keine Angst, es wird ihnen nichts passieren, Sie werden ganz bestimmt beide Kinder wieder mitnehmen.“
Das entspannte unsere Lage kolossal, Mutters Kinn zitterte nicht mehr, während es für den Soldaten sicher sehr ungemütlich geworden wäre, hätte man ihn dabei erwischt, uns zu trösten und überhaupt mit uns zu sprechen.
Nach einer Ewigkeit winkte man uns heran, drückte meinem Vater die Papiere in die Hand und entließ uns alle vier tatsächlich mit einem „Frohe Weihnachten noch!“ in die Freiheit. Keine Erklärung, keine Entschuldigung, aber das war jetzt auch egal. Wir wollten nur noch weg.
Als wir dann endlich in einem geheizten Berliner Bus den Heimweg in Richtung Charlottenburg antraten und meine Eltern meine Schwester und mich wortlos an sich drückten, sagte meine kleine Schwester: „Der Mann mit dem Gewehr kam mir vor wie ein Engel.“
Naja, „Engel“ war sicher etwas übertrieben, aber dieser junge Grenzsoldat gab dem Ganzen – zumindest für uns an diesem Weihnachtstag – ein menschlicheres Gesicht und so wurde er zu unserem ganz persönlichen Weihnachtsengel.
Ungerührt rief man uns aus der Warteschlange und ließ uns abseits stehen. Es war fast stockdunkel, ein paar Grenzlaternen gaben kaum Licht, vielmehr tauchten sie die Szenerie in Unheimlichkeit. Wir waren allein, standen ohne Ausweise mitten in der Grenzanlage. Es gab kein Vor und kein Zurück. Wir warteten. Minuten. Eine Stunde.
Die Angst kroch ganz langsam überallhin – und die winterliche Eiseskälte hinterher. Bald kämpfte meine Mutter mit den Tränen, was sie zwar zu verbergen suchte, aber ihr Kinn gehorchte ihr nicht, es zitterte verdächtig. Noch heute höre ich meinen Vater beruhigend auf sie einreden, aber der flatterige Schatten seiner Hand, als er an seiner Zigarette zog, verriet auch ihn. Kindern entgeht so etwas nicht!
Meine kleine Schwester war sechs und ich war acht Jahre alt. Die Eltern hatten also Angst, das bedeutete echte Gefahr.
Plötzlich, wie aus dem Nichts, trat ein paar Meter weiter ein junger Grenzsoldat aus dem Dunkel seines Wachhäuschens. In Zeitlupe kam er auf uns zu, ein Gewehr auf dem Rücken, und umrundete uns ein ums andere Mal. Dabei ging er immer ganz nah an meine Eltern heran und flüsterte Ihnen unaufhörlich zu: „Haben Sie keine Angst, es wird ihnen nichts passieren, Sie werden ganz bestimmt beide Kinder wieder mitnehmen.“
Das entspannte unsere Lage kolossal, Mutters Kinn zitterte nicht mehr, während es für den Soldaten sicher sehr ungemütlich geworden wäre, hätte man ihn dabei erwischt, uns zu trösten und überhaupt mit uns zu sprechen.
Nach einer Ewigkeit winkte man uns heran, drückte meinem Vater die Papiere in die Hand und entließ uns alle vier tatsächlich mit einem „Frohe Weihnachten noch!“ in die Freiheit. Keine Erklärung, keine Entschuldigung, aber das war jetzt auch egal. Wir wollten nur noch weg.
Als wir dann endlich in einem geheizten Berliner Bus den Heimweg in Richtung Charlottenburg antraten und meine Eltern meine Schwester und mich wortlos an sich drückten, sagte meine kleine Schwester: „Der Mann mit dem Gewehr kam mir vor wie ein Engel.“
Naja, „Engel“ war sicher etwas übertrieben, aber dieser junge Grenzsoldat gab dem Ganzen – zumindest für uns an diesem Weihnachtstag – ein menschlicheres Gesicht und so wurde er zu unserem ganz persönlichen Weihnachtsengel.
 Wie sehr freuten sich die
Großeltern in Ostberlin, wenn ihre Kinder und Enkel sie zu Weihnachten
besuchten, denn in der ersten Zeit nach dem Mauerbau waren regelmäßige Besuche
nicht möglich.
Wie sehr freuten sich die
Großeltern in Ostberlin, wenn ihre Kinder und Enkel sie zu Weihnachten
besuchten, denn in der ersten Zeit nach dem Mauerbau waren regelmäßige Besuche
nicht möglich.
 Meine Patentante Inge Seek (leider nur seitlich) nach der weihnachtlichen Bescherung ca 1960. Ich stehe links, meine Schwester am Klnderwagen vor unserer Tante.
Meine Patentante Inge Seek (leider nur seitlich) nach der weihnachtlichen Bescherung ca 1960. Ich stehe links, meine Schwester am Klnderwagen vor unserer Tante.
Eine wahre Geschichte
Jutta Valentini-Sass
Ein Dorf in Unterfranken; 1960er Jahre
Der 24. Dezember begann mit herrlichem Sonnenschein. Es war trocken, kalt und klar. Es klirrte vor Kälte. Der Bauer schaute sich auf seinem Hof um. Alles war sauber, die Tiere versorgt und zufrieden. Er hatte Zeit. Aus der Küche duftete es weihnachtlich herüber, und ein wohliges Gefühl breitete sich in ihm aus.
„Ich fahre nochmal in den Wald!“, rief er seiner Frau zu, die mit hochrotem Kopf am Herd werkelte.
Es hatte geschneit, der Weg lag weiß und unberührt vor ihm, die Bäume, wie von Engelshand, leicht bezuckert. So schön war der vorweihnachtliche Tag schon lange nicht mehr. Er fühlte sich in die Kindheit zurück versetzt und fuhr langsam zu seinem Wald. Am Waldrand stellte er das Auto ab und machte sich zu Fuß auf in die verschneite weiße Pracht. Alles war wie verzaubert. So schritt er dahin, ganz in seine Kindheitsträume versunken ...
Doch da, er bog um eine Kurve – ein Auto, allein, verlassen beim näheren Hinsehen. Stirnrunzelnd ging er tiefer in den Wald hinein, suchte Deckung, das Auto immer in Sichtweite. Lange stand er und lauschte in die Stille. Ab und zu knackte ein Ast oder es fiel etwas Schnee von den Bäumen. Gut, daß er sich so warm angezogen hatte. Da, er hörte Stimmen und tatsächlich näherten sich ein Mann und eine Frau. Sie stapften auf das Auto zu. Zwischen sich trugen sie eine herrliche Tanne. Unserem Beobachter stockte der Atem – diese Tanne, sein ganzer Stolz – nun eine Leiche!
Unmut und Trauer zugleich stiegen in ihm hoch. Als die beiden den Baum verladen wollten, löste er sich aus seinem Versteck und ging energischen Schrittes auf die Räuber zu. Diese ließen vor Schreck den Baum fallen. Die Frau wurde blaß, der Mann bekam einen puterroten Kopf.
Der Bauer hatte sich wieder gefaßt und sagte mit ruhiger Stimme: „Das ist mein Wald und mein Baum. Ich könnte Sie anzeigen, denn ich habe Ihre Autonummer. Aber weil heute Heiliger Abend ist, verzichte ich darauf, wenn Sie mir drei Strophen eines Weihnachtsliedes vorsingen – und dann können Sie diese Tanne als Weihnachtsbaum behalten.“
Die beiden überraschten „Waldfrevler“ erholten sich von ihrem Schrecken und gingen alle bekannten Weihnachtslieder durch. Sie fingen an zu streiten. Nichts paßte, das eine war zu kindlich, von dem anderen konnten sie nur eine Strophe, beim nächsten waren sie sich in der Melodie nicht sicher. Endlich einigten sie sich auf „O du fröhliche“ und sangen tatsächlich, etwas zittrig und jämmerlich, alle drei Strophen. Der Bauer gab ihnen die Hand, dankte für das Lied und wünschte ihnen „Fröhliche Weihnachten!“
Im Sommer danach, Erntezeit! Wer denkt da noch an Weihnachtserlebnisse?
Der Mähdrescher lief auf Hochtouren, Gewitter waren angesagt. Peng! Aus! Die alte Maschine gab mitten im Feld ihren Geist auf. Der herbeigerufene Mechaniker meinte, eine Reparatur lohne sich nicht mehr. Ein neuer Mähdrescher mußte her und zwar sofort. Der Bauer eilte zu seiner Bank, er brauchte ein Darlehen zu möglichst tragbaren Konditionen. Seine Hausbank konnte keine günstige Lösung bieten. Schnell zu einer zweiten und dritten Bank! Vielleicht hat er dort mehr Glück?
Aber die Entscheidung ist dem Chef vorbehalten. Der Landwirt wird zum Direktor geführt. Der Bauer, schwitzend, niedergedrückt, den Hut in der Hand, klopft an und tritt ein. O Schreck – hinter dem Schreibtisch erhebt sich der „Sänger aus dem Weihnachtswald“!
Beide stehen wie versteinert. Aber dann löst sich die Spannung. Ein gegenseitiges Wiedererkennen!
Frohes Gelächter erfüllt den Raum. Das Darlehen wurde genehmigt!
PS. Ich hätte den Bauern den Schlager singen lassen: „Wer soll das bezahlen?“
Weitere Weihnachtsgeschichten aus den Bänden 1-13 der Reihe "Unvergessene Weihnachten" finden Sie hier: Weitere Abdrucktexte »
 Unvergessene Weihnachten Band 1
Unvergessene Weihnachten Band 1 Unvergessene Weihnachten Band 2
Unvergessene Weihnachten Band 2 Unvergessene Weihnachten Band 3
Unvergessene Weihnachten Band 3 Unvergessene Weihnachten Band 4
Unvergessene Weihnachten Band 4 Unvergessene Weihnachten Band 5
Unvergessene Weihnachten Band 5 Unvergessene Weihnachten Band 6
Unvergessene Weihnachten Band 6 Unvergessene Weihnachten. Band 7
Unvergessene Weihnachten. Band 7 Unvergessene Weihnachten. Band 8
Unvergessene Weihnachten. Band 8 Unvergessene Weihnachten. Band 9
Unvergessene Weihnachten. Band 9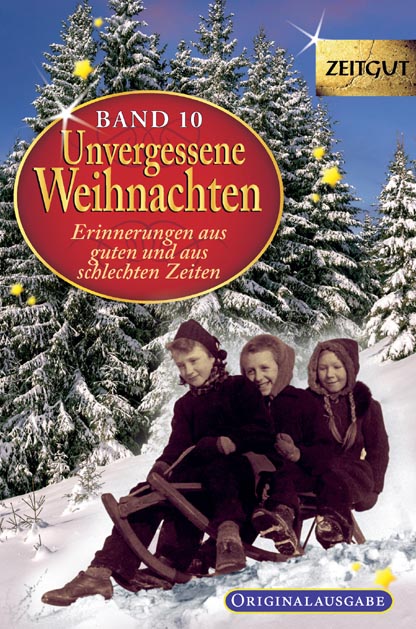 Unvergessene Weihnachten. Band 10
Unvergessene Weihnachten. Band 10 Unvergessene Weihnachten. Band 11
Unvergessene Weihnachten. Band 11 Unvergessene Weihnachten. Band 12
Unvergessene Weihnachten. Band 12
 Unvergessene Weihnachten. Band 13
Unvergessene Weihnachten. Band 13