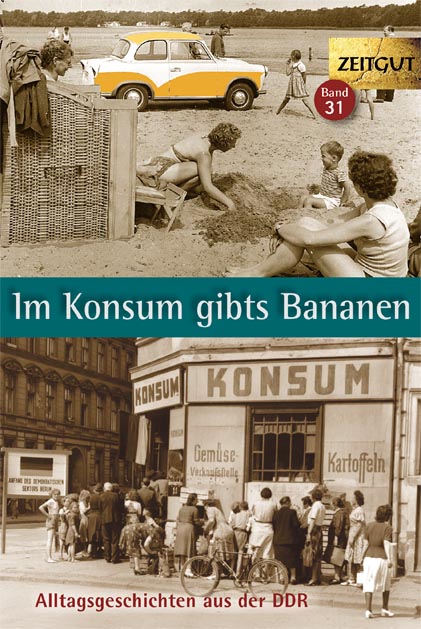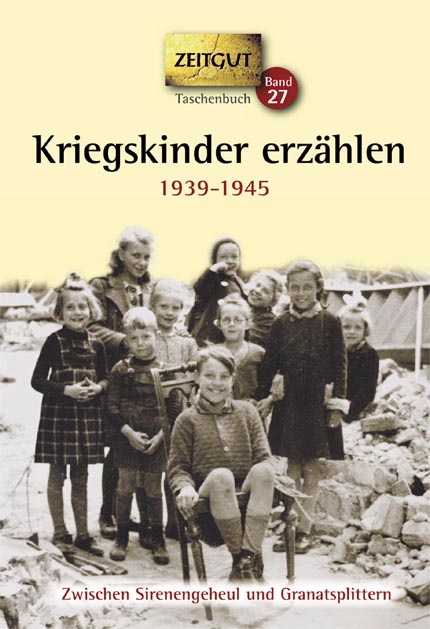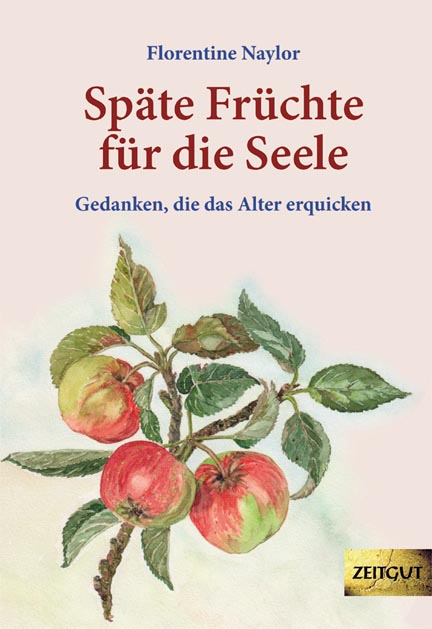Leseprobe aus den Buch:

Meine kleine Schwester bewundert meine Schultüte

In Begleitung meiner Mutter mache ich mich 1933 das erste Mal auf den Weg zur Schule (rechts) in Schmolz (heute Smolec).
Foto: aus dem Privatbesitz des Verfassers.
Doktorjunge
von Hans-Heinrich Vogt // Schmolz bei Breslau, 1933-1936
Im Fotoalbum meiner Eltern gibt es ein Bild von einemkleinen Jungen, der an der Hand seiner Mutter, die Schultüte im Arm,zuversichtlich den Weg ins Leben antritt, den Weg in die erste Klasse derdörflichen Volksschule in Schmolz bei Breslau. Dieser Junge war ich.
Bald zeigte sich, wie dornenvoll dieser Weg sein sollte. DerGrund lag in einer Erziehungsmaxime meiner Eltern. Sie hatten uns Kindern inden frühen Lebensjahren eine sorgenfreie, ungehinderte Entfaltung sichernwollen. Das Haus, in dem wir wohnten, lag inmitten eines riesigen, völligverwilderten Grundstückes, dessen Grenzen zugleich die Grenzen unsererErfahrungswelt wurden: Über die hohen Zäune hinaus blieb uns die Umgebung verschlossen.
Das beengte uns keineswegs. Wir lebten in einer ArtDornröschenwelt, isoliert vom Dorf, aber glücklich in dieser Abgeschiedenheit.Hatten wir doch alles, was man sich als Kind wünschte: Weite Wiesen mit hohemGras, in dem man sich verstecken konnte, Hecken aus Holunderbüschen, unterdenen es stets geheimnisvoll dunkel war und wo es stets abenteuerlich nachModer roch, mächtige Pappeln und Eichen, Obstbäume, verschlungene Wege – kurz,ein Wunderland für Kinder, ganz für uns allein, für meine Schwester und mich.
Was unsere Eltern nicht bedacht hatten: Diese Isolationbrachte uns zwar das Glück unbeschwerter Jahre, aber der Übergang ins rauheLeben der Schulzeit war grausam. An jenem Tage, als ich das Klassenzimmer derVolksschule betrat, begann ein Martyrium. Die verschworene Gemeinschaft derkumpelhaften Dorfjugend, aufgewachsen in Dialekt und Denkweise einer mir fernenWelt, fiel über mich, den „Doktorjungen“, mitleidlos her und drangsalierte denAußenseiter. Es gibt nichts Gefühlloseres als Kinder, die andere Kinderpeinigen. Wer nicht gelernt hat, sich zu wehren, ist hoffnungslos verloren –und ich war es. Dieses Anstarren, das Zupfen an der Jacke, das Spotten, diezotenhaften Anspielungen, all das werde ich nie vergessen.
Wir Erwachsenen würden diese Lehrzeit als nützlichbezeichnen: Setz dich durch, werde ein Mann! Ich wurde es, aber nach wievielLehrgeld! Lange Zeit hatte ich keine Freunde in der Klasse, keinenGleichaltrigen, niemanden, dem ich mich hätte anvertrauen können.
Es muß wohl in der zweiten oder dritten Klasse derVolksschule gewesen sein, als mir eine Chance geboten wurde, die ich nutzte.Damals war es üblich, daß die Horde der Dorfjugend sich in wildenFußballspielen austobte. Man ging „botzen“. Am Waldrand lag eine Lichtung, auf derman in Gruppen Mannschaften bildete und bei ruppigem Geraufe auf Tore schoß,die die Jungen aus Holzlatten gebastelt hatten.
Natürlich durfte ich nicht mitspielen. Ich gehörte ja nichtdazu, war kein Rauhbein. Nie hatte man mich aufgefordert, mitzutun. Dabeifehlte es mir keineswegs an Können. In unserer Oase der Isolation hatten meineSchwester und ich eine beachtliche Fertigkeit im Umgang mit dem Ball erworben,konnten dribbeln, täuschen, flanken, auf Tore schießen. In der Schule war ichkein schlechter Sportler, aber hier ging es um die Clique, von der ichausgeschlossen war.
Ich saß also am Waldrand und schaute zu. Das werde ich nichtvergessen: Plötzlich wies der Wotzig Paule, der größte und stärkste Flegel derBande, ihr Häuptling, mit dem Finger auf mich und brüllte: „Na, Doktorjunge,zeig uns mal, daß du botzen kannst!“
Ich weiß bis heute nicht, ob er mich provozieren, michlächerlich machen wollte, oder ob ich von ihm eine Chance bekam, aus welchenGründen auch immer. Nur eines weiß ich: Das war mein „Auftritt“. Und, ichspielte Fußball mit allen Raffinessen, die mir zu Gebote standen, trickste,sprintete, schoß. Nach wenigen Minuten fiel mein erstes Tor.
Die Burschen ließen sich nicht anmerken, was sie dachten.Ich hab’s an diesem Tag auch nicht erfahren. Als ich nach Hause kam, schlugmeine Mutter die Hände über dem Kopf zusammen: So schmutzig, so verschwitzthatte sie ihren Filius lange nicht gesehen, sie fragte aber nicht weiter.
Den Lohn meines Einsatzes empfing ich am nächsten Morgen ineiner Geste, die man heute wohl als Goodwill bezeichnen würde. Vor der Tür desKlassenzimmers traf ich mit Wotzig Paule zusammen. Er stieß mir fast sanft dieFaust in die Seite und grunzte: „Heil Botzer!“
Diesen Ausdruck muß man aus der Zeit heraus verstehen, diemit der Floskel „Heil“ den Namen „Hitler“ verband. Diesen Namen durch einenanderen, persönlicheren zu ersetzen, bedeutete Akzeptanz – und genau das wolltePaule ausdrücken: Mit „Heil Botzer!“ war ich aufgenommen in die Clique, warnicht mehr der Außenseiter, der „Doktorjunge“, sondern Fußballspieler, dessenLeistungen man noch darüber hinaus anzuerkennen bereit war.
Ich hatte den Makel, mit dem meine Eltern mich unwissentlichund unbeabsichtigt belastet hatten, durch eigene Fähigkeit abgestreift.
aus dem Buch "Unvergessene Schulzeit" zum Shop »
Textdatei für die Presse Word » oder PDF »
Im Fotoalbum meiner Eltern gibt es ein Bild von einemkleinen Jungen, der an der Hand seiner Mutter, die Schultüte im Arm,zuversichtlich den Weg ins Leben antritt, den Weg in die erste Klasse derdörflichen Volksschule in Schmolz bei Breslau. Dieser Junge war ich.
Bald zeigte sich, wie dornenvoll dieser Weg sein sollte. DerGrund lag in einer Erziehungsmaxime meiner Eltern. Sie hatten uns Kindern inden frühen Lebensjahren eine sorgenfreie, ungehinderte Entfaltung sichernwollen. Das Haus, in dem wir wohnten, lag inmitten eines riesigen, völligverwilderten Grundstückes, dessen Grenzen zugleich die Grenzen unsererErfahrungswelt wurden: Über die hohen Zäune hinaus blieb uns die Umgebung verschlossen.
Das beengte uns keineswegs. Wir lebten in einer ArtDornröschenwelt, isoliert vom Dorf, aber glücklich in dieser Abgeschiedenheit.Hatten wir doch alles, was man sich als Kind wünschte: Weite Wiesen mit hohemGras, in dem man sich verstecken konnte, Hecken aus Holunderbüschen, unterdenen es stets geheimnisvoll dunkel war und wo es stets abenteuerlich nachModer roch, mächtige Pappeln und Eichen, Obstbäume, verschlungene Wege – kurz,ein Wunderland für Kinder, ganz für uns allein, für meine Schwester und mich.
Was unsere Eltern nicht bedacht hatten: Diese Isolationbrachte uns zwar das Glück unbeschwerter Jahre, aber der Übergang ins rauheLeben der Schulzeit war grausam. An jenem Tage, als ich das Klassenzimmer derVolksschule betrat, begann ein Martyrium. Die verschworene Gemeinschaft derkumpelhaften Dorfjugend, aufgewachsen in Dialekt und Denkweise einer mir fernenWelt, fiel über mich, den „Doktorjungen“, mitleidlos her und drangsalierte denAußenseiter. Es gibt nichts Gefühlloseres als Kinder, die andere Kinderpeinigen. Wer nicht gelernt hat, sich zu wehren, ist hoffnungslos verloren –und ich war es. Dieses Anstarren, das Zupfen an der Jacke, das Spotten, diezotenhaften Anspielungen, all das werde ich nie vergessen.
Wir Erwachsenen würden diese Lehrzeit als nützlichbezeichnen: Setz dich durch, werde ein Mann! Ich wurde es, aber nach wievielLehrgeld! Lange Zeit hatte ich keine Freunde in der Klasse, keinenGleichaltrigen, niemanden, dem ich mich hätte anvertrauen können.
Es muß wohl in der zweiten oder dritten Klasse derVolksschule gewesen sein, als mir eine Chance geboten wurde, die ich nutzte.Damals war es üblich, daß die Horde der Dorfjugend sich in wildenFußballspielen austobte. Man ging „botzen“. Am Waldrand lag eine Lichtung, auf derman in Gruppen Mannschaften bildete und bei ruppigem Geraufe auf Tore schoß,die die Jungen aus Holzlatten gebastelt hatten.
Natürlich durfte ich nicht mitspielen. Ich gehörte ja nichtdazu, war kein Rauhbein. Nie hatte man mich aufgefordert, mitzutun. Dabeifehlte es mir keineswegs an Können. In unserer Oase der Isolation hatten meineSchwester und ich eine beachtliche Fertigkeit im Umgang mit dem Ball erworben,konnten dribbeln, täuschen, flanken, auf Tore schießen. In der Schule war ichkein schlechter Sportler, aber hier ging es um die Clique, von der ichausgeschlossen war.
Ich saß also am Waldrand und schaute zu. Das werde ich nichtvergessen: Plötzlich wies der Wotzig Paule, der größte und stärkste Flegel derBande, ihr Häuptling, mit dem Finger auf mich und brüllte: „Na, Doktorjunge,zeig uns mal, daß du botzen kannst!“
Ich weiß bis heute nicht, ob er mich provozieren, michlächerlich machen wollte, oder ob ich von ihm eine Chance bekam, aus welchenGründen auch immer. Nur eines weiß ich: Das war mein „Auftritt“. Und, ichspielte Fußball mit allen Raffinessen, die mir zu Gebote standen, trickste,sprintete, schoß. Nach wenigen Minuten fiel mein erstes Tor.
Die Burschen ließen sich nicht anmerken, was sie dachten.Ich hab’s an diesem Tag auch nicht erfahren. Als ich nach Hause kam, schlugmeine Mutter die Hände über dem Kopf zusammen: So schmutzig, so verschwitzthatte sie ihren Filius lange nicht gesehen, sie fragte aber nicht weiter.
Den Lohn meines Einsatzes empfing ich am nächsten Morgen ineiner Geste, die man heute wohl als Goodwill bezeichnen würde. Vor der Tür desKlassenzimmers traf ich mit Wotzig Paule zusammen. Er stieß mir fast sanft dieFaust in die Seite und grunzte: „Heil Botzer!“
Diesen Ausdruck muß man aus der Zeit heraus verstehen, diemit der Floskel „Heil“ den Namen „Hitler“ verband. Diesen Namen durch einenanderen, persönlicheren zu ersetzen, bedeutete Akzeptanz – und genau das wolltePaule ausdrücken: Mit „Heil Botzer!“ war ich aufgenommen in die Clique, warnicht mehr der Außenseiter, der „Doktorjunge“, sondern Fußballspieler, dessenLeistungen man noch darüber hinaus anzuerkennen bereit war.
Ich hatte den Makel, mit dem meine Eltern mich unwissentlichund unbeabsichtigt belastet hatten, durch eigene Fähigkeit abgestreift.
aus dem Buch "Unvergessene Schulzeit" zum Shop »
Textdatei für die Presse Word » oder PDF »
Buchtipps

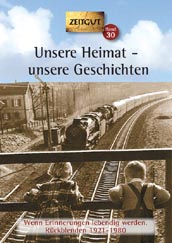 Band 30. Unsere Heimat - unsere Geschichten. Wenn Erinnerungen lebendig werden. Rückblenden 1921 bis 1980
Band 30. Unsere Heimat - unsere Geschichten. Wenn Erinnerungen lebendig werden. Rückblenden 1921 bis 1980Zum Shop »
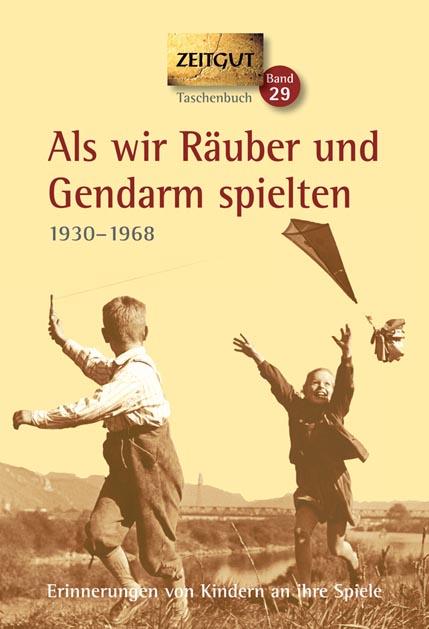 Band 29. Als wir Räuber und Gendarm spielten. Erinnerungen von Kindern an ihre Spiele. 1930-1968
Band 29. Als wir Räuber und Gendarm spielten. Erinnerungen von Kindern an ihre Spiele. 1930-1968Zum Shop »
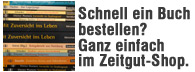
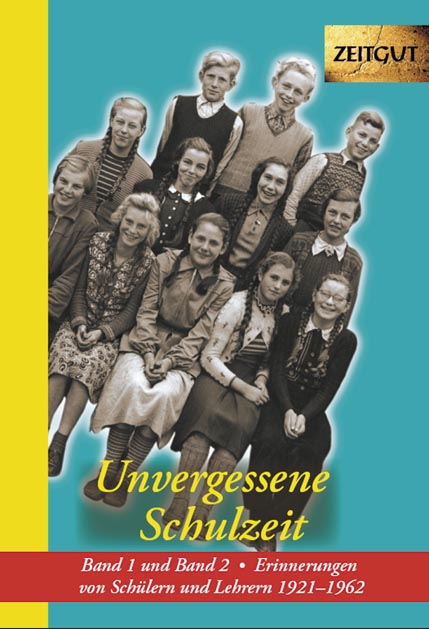 Unvergessene Schulzeit
Unvergessene Schulzeit