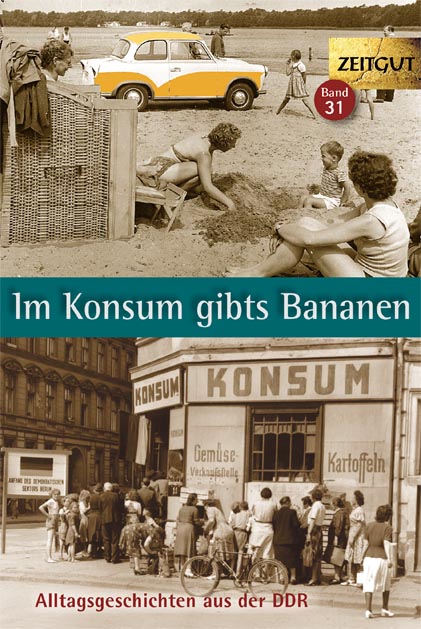Unvergessene Weihnachten. Band 14
31 besinnliche und heitere Zeitzeugen-Erinnerungen, 1924-2019
192 Seiten mit vielen Abbildungen, Ortsregister, Zeitgut Verlag, Berlin.
Klappenbroschur
ISBN: 978-3-86614-280-0, EURO 10,90
zum Shop »
31 besinnliche und heitere Zeitzeugen-Erinnerungen, 1924-2019
192 Seiten mit vielen Abbildungen, Ortsregister, Zeitgut Verlag, Berlin.
Klappenbroschur
ISBN: 978-3-86614-280-0, EURO 10,90
zum Shop »
Weihnachten an der Berliner Mauer
oder Engel mit Gewehr
Eine Geschichte von Dagmar Göstel

Leider haben meine Eltern kein Datum vermerkt. Das ist mein Vater Klaus Göstel mit meiner Schwester Manuela, daneben meine Mutter Waltraud Göstel mit mir. Das muss Weihnachten 1963 oder 1964 gewesen sein. (Dieses Foto ist nicht im Buch abgebildet)
Berlin-Charlottenburg –
Berlin-Weißensee; 25. Dezember 1964
Die Gefühle rund um das Weihnachtsfest im Berlin meiner Kindheit waren geprägt von der Teilung der Stadt in West und Ost. Die 1961 gebaute Berliner Mauer bedeutete nicht nur einen Riß quer durch Berlin, sondern auch mitten durch unsere Familie. Meine Eltern, meine jüngere Schwester Manuela und ich lebten im Westteil, unsere Großeltern und unsere Lieblingstante im Ostteil der Stadt. Da machte sich bei aller weihnachtlichen Vorfreude gerade in der Adventszeit zugleich immer eine gewisse Traurigkeit über die Trennung breit. So sicher Lametta unseren Weihnachtsbaum schmückte, so sicher gehörte der erste Weihnachtsfeiertag meinen Großeltern und meiner Tante „drüben“. Das bedeutete sehr frühes Aufstehen an jedem 25. Dezember, dann stundenlanges Warten an der Grenze. Die „Vopos“ beäugten uns kritisch – oder kam es uns nur so vor, weil meine Eltern immer verbotene Dinge dabei hatten?
Wurst und Fleisch für Omas Kochkünste, West-Zeitungen für Opa, eine Schallplatte für meine Tante – nach menschlichem Ermessen zwar alles sicher versteckt und gut getarnt in Tüten und Taschen, aber man wußte ja nie ...
Der Trick bestand darin, die Tüten und Taschen sofort bereitwillig und geöffnet dem jeweiligen Kontrolleur unter die Nase zu halten, noch bevor er uns dazu aufforderte. Diese „freiwillige Offenheit“ wurde meistens mit nur oberflächlicher Taschenkontrolle belohnt, die nie in die Tiefe ging. Ich erinnere mich, wie mein Vater einmal, sehr zum Vergnügen von uns Kindern, eine Fleischwurst in der Innentasche seiner Anzugjacke versteckte. Puuuuh, war diese Hürde genommen, konnten wir schon bald Oma, Opa und unsere Tante in ihrer ofengeheizten Stube in Weißensee in die Arme schließen und bei Kerzenlicht, Dresdner Stollen und Omas heißgeliebtem Rosinenkuchen für ein paar Stunden so tun, als gäbe es keine trennende Mauer ...
Die Gefühle rund um das Weihnachtsfest im Berlin meiner Kindheit waren geprägt von der Teilung der Stadt in West und Ost. Die 1961 gebaute Berliner Mauer bedeutete nicht nur einen Riß quer durch Berlin, sondern auch mitten durch unsere Familie. Meine Eltern, meine jüngere Schwester Manuela und ich lebten im Westteil, unsere Großeltern und unsere Lieblingstante im Ostteil der Stadt. Da machte sich bei aller weihnachtlichen Vorfreude gerade in der Adventszeit zugleich immer eine gewisse Traurigkeit über die Trennung breit. So sicher Lametta unseren Weihnachtsbaum schmückte, so sicher gehörte der erste Weihnachtsfeiertag meinen Großeltern und meiner Tante „drüben“. Das bedeutete sehr frühes Aufstehen an jedem 25. Dezember, dann stundenlanges Warten an der Grenze. Die „Vopos“ beäugten uns kritisch – oder kam es uns nur so vor, weil meine Eltern immer verbotene Dinge dabei hatten?
Wurst und Fleisch für Omas Kochkünste, West-Zeitungen für Opa, eine Schallplatte für meine Tante – nach menschlichem Ermessen zwar alles sicher versteckt und gut getarnt in Tüten und Taschen, aber man wußte ja nie ...
Der Trick bestand darin, die Tüten und Taschen sofort bereitwillig und geöffnet dem jeweiligen Kontrolleur unter die Nase zu halten, noch bevor er uns dazu aufforderte. Diese „freiwillige Offenheit“ wurde meistens mit nur oberflächlicher Taschenkontrolle belohnt, die nie in die Tiefe ging. Ich erinnere mich, wie mein Vater einmal, sehr zum Vergnügen von uns Kindern, eine Fleischwurst in der Innentasche seiner Anzugjacke versteckte. Puuuuh, war diese Hürde genommen, konnten wir schon bald Oma, Opa und unsere Tante in ihrer ofengeheizten Stube in Weißensee in die Arme schließen und bei Kerzenlicht, Dresdner Stollen und Omas heißgeliebtem Rosinenkuchen für ein paar Stunden so tun, als gäbe es keine trennende Mauer ...
 Am Abend dann, alle Jahre
wieder, das Ganze rückwärts: Ausgestattet mit Geschenken meiner Großeltern,
führte der Heimweg zurück zur Grenze. Da passierte zu Weihnachten 1964 am
Grenzübergang Bornholmer Straße die Fast-Katastrophe: Meine Mutter reichte
unsere Ausweise dem Grenzsoldaten. Der guckte, stutzte, guckte wieder,
blätterte wild in den Ausweisen herum und schnauzte schließlich: „Sie sind
heute Morgen mit nur einem Kind in die DDR eingereist, also reist jetzt auch
nur eines wieder aus!“
Am Abend dann, alle Jahre
wieder, das Ganze rückwärts: Ausgestattet mit Geschenken meiner Großeltern,
führte der Heimweg zurück zur Grenze. Da passierte zu Weihnachten 1964 am
Grenzübergang Bornholmer Straße die Fast-Katastrophe: Meine Mutter reichte
unsere Ausweise dem Grenzsoldaten. Der guckte, stutzte, guckte wieder,
blätterte wild in den Ausweisen herum und schnauzte schließlich: „Sie sind
heute Morgen mit nur einem Kind in die DDR eingereist, also reist jetzt auch
nur eines wieder aus!“
Meine Mutter war eine zierliche
Frau, aber sie wurde in diesem Moment – zumindest stimmlich – zur Riesin. Ich
habe ihre Antwort in schönstem Berliner Dialekt noch heute, über fünf
Jahrzehnte später, im Ohr: „Sie, junger Mann, wir sind mit zwee Mädels
anjekommen und nehmen ooch beede wieder mit zurück – und wenn ick hier steh’,
bis der letzte Schnee jetaut is’!“
Ungerührt rief man uns aus der Warteschlange und ließ uns abseits stehen. Es war fast stockdunkel, ein paar Grenzlaternen gaben kaum Licht, vielmehr tauchten sie die Szenerie in Unheimlichkeit. Wir waren allein, standen ohne Ausweise mitten in der Grenzanlage. Es gab kein Vor und kein Zurück. Wir warteten. Minuten. Eine Stunde.
Die Angst kroch ganz langsam überallhin – und die winterliche Eiseskälte hinterher. Bald kämpfte meine Mutter mit den Tränen, was sie zwar zu verbergen suchte, aber ihr Kinn gehorchte ihr nicht, es zitterte verdächtig. Noch heute höre ich meinen Vater beruhigend auf sie einreden, aber der flatterige Schatten seiner Hand, als er an seiner Zigarette zog, verriet auch ihn. Kindern entgeht so etwas nicht!
Meine kleine Schwester war sechs und ich war acht Jahre alt. Die Eltern hatten also Angst, das bedeutete echte Gefahr.
Plötzlich, wie aus dem Nichts, trat ein paar Meter weiter ein junger Grenzsoldat aus dem Dunkel seines Wachhäuschens. In Zeitlupe kam er auf uns zu, ein Gewehr auf dem Rücken, und umrundete uns ein ums andere Mal. Dabei ging er immer ganz nah an meine Eltern heran und flüsterte Ihnen unaufhörlich zu: „Haben Sie keine Angst, es wird ihnen nichts passieren, Sie werden ganz bestimmt beide Kinder wieder mitnehmen.“
Das entspannte unsere Lage kolossal, Mutters Kinn zitterte nicht mehr, während es für den Soldaten sicher sehr ungemütlich geworden wäre, hätte man ihn dabei erwischt, uns zu trösten und überhaupt mit uns zu sprechen.
Nach einer Ewigkeit winkte man uns heran, drückte meinem Vater die Papiere in die Hand und entließ uns alle vier tatsächlich mit einem „Frohe Weihnachten noch!“ in die Freiheit. Keine Erklärung, keine Entschuldigung, aber das war jetzt auch egal. Wir wollten nur noch weg.
Als wir dann endlich in einem geheizten Berliner Bus den Heimweg in Richtung Charlottenburg antraten und meine Eltern meine Schwester und mich wortlos an sich drückten, sagte meine kleine Schwester: „Der Mann mit dem Gewehr kam mir vor wie ein Engel.“
Naja, „Engel“ war sicher etwas übertrieben, aber dieser junge Grenzsoldat gab dem Ganzen – zumindest für uns an diesem Weihnachtstag – ein menschlicheres Gesicht und so wurde er zu unserem ganz persönlichen Weihnachtsengel.
Ungerührt rief man uns aus der Warteschlange und ließ uns abseits stehen. Es war fast stockdunkel, ein paar Grenzlaternen gaben kaum Licht, vielmehr tauchten sie die Szenerie in Unheimlichkeit. Wir waren allein, standen ohne Ausweise mitten in der Grenzanlage. Es gab kein Vor und kein Zurück. Wir warteten. Minuten. Eine Stunde.
Die Angst kroch ganz langsam überallhin – und die winterliche Eiseskälte hinterher. Bald kämpfte meine Mutter mit den Tränen, was sie zwar zu verbergen suchte, aber ihr Kinn gehorchte ihr nicht, es zitterte verdächtig. Noch heute höre ich meinen Vater beruhigend auf sie einreden, aber der flatterige Schatten seiner Hand, als er an seiner Zigarette zog, verriet auch ihn. Kindern entgeht so etwas nicht!
Meine kleine Schwester war sechs und ich war acht Jahre alt. Die Eltern hatten also Angst, das bedeutete echte Gefahr.
Plötzlich, wie aus dem Nichts, trat ein paar Meter weiter ein junger Grenzsoldat aus dem Dunkel seines Wachhäuschens. In Zeitlupe kam er auf uns zu, ein Gewehr auf dem Rücken, und umrundete uns ein ums andere Mal. Dabei ging er immer ganz nah an meine Eltern heran und flüsterte Ihnen unaufhörlich zu: „Haben Sie keine Angst, es wird ihnen nichts passieren, Sie werden ganz bestimmt beide Kinder wieder mitnehmen.“
Das entspannte unsere Lage kolossal, Mutters Kinn zitterte nicht mehr, während es für den Soldaten sicher sehr ungemütlich geworden wäre, hätte man ihn dabei erwischt, uns zu trösten und überhaupt mit uns zu sprechen.
Nach einer Ewigkeit winkte man uns heran, drückte meinem Vater die Papiere in die Hand und entließ uns alle vier tatsächlich mit einem „Frohe Weihnachten noch!“ in die Freiheit. Keine Erklärung, keine Entschuldigung, aber das war jetzt auch egal. Wir wollten nur noch weg.
Als wir dann endlich in einem geheizten Berliner Bus den Heimweg in Richtung Charlottenburg antraten und meine Eltern meine Schwester und mich wortlos an sich drückten, sagte meine kleine Schwester: „Der Mann mit dem Gewehr kam mir vor wie ein Engel.“
Naja, „Engel“ war sicher etwas übertrieben, aber dieser junge Grenzsoldat gab dem Ganzen – zumindest für uns an diesem Weihnachtstag – ein menschlicheres Gesicht und so wurde er zu unserem ganz persönlichen Weihnachtsengel.
 Wie sehr freuten sich die
Großeltern in Ostberlin, wenn ihre Kinder und Enkel sie zu Weihnachten
besuchten, denn in der ersten Zeit nach dem Mauerbau waren regelmäßige Besuche
nicht möglich.
Wie sehr freuten sich die
Großeltern in Ostberlin, wenn ihre Kinder und Enkel sie zu Weihnachten
besuchten, denn in der ersten Zeit nach dem Mauerbau waren regelmäßige Besuche
nicht möglich.
 Meine Patentante Inge Seek (leider nur seitlich) nach der weihnachtlichen Bescherung ca 1960. Ich stehe links, meine Schwester am Klnderwagen vor unserer Tante.
Meine Patentante Inge Seek (leider nur seitlich) nach der weihnachtlichen Bescherung ca 1960. Ich stehe links, meine Schwester am Klnderwagen vor unserer Tante.
Buchtipps

 Band 30. Unsere Heimat - unsere Geschichten. Wenn Erinnerungen lebendig werden. Rückblenden 1921 bis 1980
Band 30. Unsere Heimat - unsere Geschichten. Wenn Erinnerungen lebendig werden. Rückblenden 1921 bis 1980Zum Shop »
 Band 29. Als wir Räuber und Gendarm spielten. Erinnerungen von Kindern an ihre Spiele. 1930-1968
Band 29. Als wir Räuber und Gendarm spielten. Erinnerungen von Kindern an ihre Spiele. 1930-1968Zum Shop »