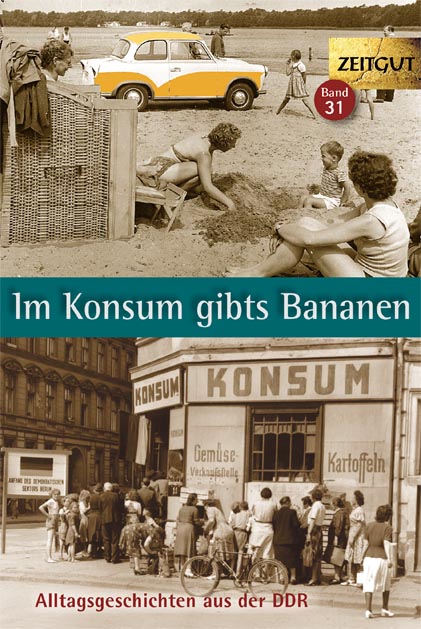Der Lagerjunge. Leseprobe

Sommerausflug 1956 mit Blick ins Wiesenttal. Reinhard Tischer links, sein Bruder Rudi und Reinhard Kluge. (Foto auf Seite 80)
Alltägliche Nöte (Seite 42, etwa 1949)
Alle zwei Wochen wurde gebadet - es gab nur eine große Zinkwanne für die ganze Lagerbagage. Das Häuschen mit den Plumpsklos war etwa zehn mal fünf Meter groß und der Länge nach geteilt. In der Mitte befanden sich je sechs Kloschüsseln ohne Wasserspülung. An jedem Türchen war ein Schloss angebracht, doch schon nach Wochen waren die Schlösser kaputt oder mit Gewalt herausgerissen. Klopapier gab es nicht. Wir schnitten alte Zeitungen in handgroße Stücke und drückten sie an einen Nagel. Geputzt wurden die Toiletten selten oder gar nicht, denn keiner war zuständig oder wollte die Verantwortung übernehmen. Die hygienischen Verhältnisse waren fürchterlich, im Sommer stank es abscheulich. Alle paar Monate wurde die Grube von einem Bauern aus dem Dorf mit einer Stielkelle von Hand ausgeschöpft.
Überall fehlte es an Sauberkeit. Dass unter solchen Umständen keine Krankheiten ausbrachen, grenzt an ein Wunder! Die Mehlwürmer krabbelten an den Wänden, an der Decke und am Boden entlang. Am schlimmsten aber waren die Wanzen. Sie piesackten jeden, hauptsächlich in der Nacht. Alle paar Monate kam der Kammerjäger, dann mussten wir in aller Frühe die Zimmer verlassen, Türen und Fenster wurden zugeklebt und die Zimmer voll Gas gepumpt. Erst abends durften wir unsere armseligen Behausungen wieder betreten. Die Freude, nachts schlafen zu können, dauerte jedoch nur ein paar Wochen, dann war eine neue Generation von Plagegeistern geschlüpft, und es ging wieder los.
In dieser Zeit mussten wir alle ums Überleben kämpfen, Hunger und Not gehörten zum Alltag. Die Lagerverpflegung reichte bei weitem nicht aus. Grauenvoll war die sogenannte Kartoffelsuppe – sie bestand mehr aus Schalen als aus Kartoffeln. Die Großküche im Lager hatte auch nicht viel zu bieten, es fehlte an Nachschub. Aber da die meisten Bewohner mehr oder weniger aus bäuerlichen Familien stammten, bauten sie Kaninchen-, Gänse- oder Entenställe und stellten in jedem kleinsten Eck Verhaue auf. Wir hielten uns ein halbes Dutzend Gänse, die im Spätherbst gestopft wurden: Kartoffeln und Getreide wurden gekocht, mit Kleie vermischt und dann mit der Hand zu kleinen Würstchen gedreht. Schnabel auf, Würstchen rein, mit dem Kochlöffelstiel nachgeholfen und dann einen Schluck Wasser hinterher. Die Quälerei wiederholte sich mehrere Male. Weihnachten war jedoch auf diese Weise gerettet.
Kaum waren die Felder in der Umgebung abgeerntet, ging die Ährenlese los. Nur die schnellsten machten hier das Rennen. Mähdrescher gab es damals noch nicht. Wir sammelten immer eine große Handvoll Ähren mit Halmen und banden sie zu „Puppen“. Zwanzig bis fünfundzwanzig davon brachten wir Kinder am Tag zusammen. Sie kamen alle in einen Sack und wurden in die Schnörleinsmühle gebracht, wo der Müller uns etliche Pfund Mehl dafür gab. Er war auch Besitzer eines Sägewerkes, dort durften wir mit einer Art Spaten die Rinde von den Stämmen schälen und kostenlos als Brennmaterial mit nach Hause nehmen.
Für uns Kinder war das „Kartoffelstoppeln“ eine richtige Knochenarbeit. Zuvor mussten wir den Bauern um Erlaubnis fragen, doch wie freuten wir uns, wenn wir ein kleines Säckchen Kartoffeln zusammenbrachten! Sogleich lieferten wir die Erdäpfel in der Lagerküche ab. Sie wurden geschält und gerieben, und am nächsten Tag gab es dann Kartoffelpuffer mit Zucker oder Salz, die wir „Plotzgen“ nannten.
Tage vorher machten wir schon aus, wann wir in die Blaubeeren gehen würden. Brot, Quark, gekochte Eier und einige Kannen voll Tee wurden eingepackt, und in aller Frühe zog die Karawane los, Kinder wie Erwachsene, mit Eimern und Töpfen bewaffnet. Einmal kamen wir auf dem Heimweg in ein Gewitter. Es fing fürchterlich an zu regnen, und wir waren mitten im Gelände ohne Möglichkeit zum Unterstellen. Unsere Wassereimer waren voll mit Beeren, die der Regen ärgerlicherweise zum Teil wegspülte.
Ein Teil des Obstes wurde zu Hause eingeweckt. Gläser gab es dafür nicht, deshalb wurden die Beeren kurzerhand in Bierflaschen abgefüllt. Später in den Regalen fingen sie oftmals an zu gären und explodierten förmlich. Man kann sich das Ergebnis vorstellen.
Unsere Mutter war mit den neuen Lebensumständen einigermaßen zufrieden. Es gab in Mistelbach eine evangelische Kirche, eine Eisenbahnverbindung nach Bayreuth und eine Schule. Nur mit dem fränkischen Dialekt kam sie nicht so recht klar.
Wir brauchten nicht mehr auf dem Fußboden zu schlafen, sondern bekamen roh gezimmerte zweistöckige Bettgestelle. So richtig ruhig wurde es aber nie im Saal. Bis weit nach Mitternacht herrschte ein ständiges Kommen und Gehen, den ganzen Tag war fortwährend Kindergeschrei zu hören. Die einen lachten, die anderen schimpften, wieder andere weinten, und manche hatten Schmerzen. Es wurde gehustet, geschnäuzt und gefurzt. Reibereien, Sticheleien, Liebeleien, Hass und Wut gab es täglich. Einer schaute auf den anderen, man ging sich auf die Nerven. Gleich nebenan wurden Kinder gezeugt, drei Betten weiter wurde gestorben. Das größte Problem, glaube ich, war der Neid. Wertsachen, Süßigkeiten und dergleichen wurden vor neugierigen Blicken versteckt. Bloß nichts sehen lassen!
Unsere Mutter bewies in allen Lebenslagen großes Gottvertrauen. Sie hatte stets ein Sprichwort bei der Hand. Oftmals sagte sie mit erhobenem Zeigefinger zu uns Kindern: „Spare in der Zeit, so hast du in der Not!“ Kaum zu glauben, aber wir haben damals wirklich noch gespart: Ein paar wenige Scheine von Mutters bescheidener Rente wie auch von Mamas Kriegerwitwenrente verschwanden in der wohlgehüteten braunen Ledertasche, die mit einem zusätzlichen Hosengürtel gesichert war. ...
Kinderspiele (S. 92)
Unsere Spiele waren einfach und doch aufregend und unterhaltsam. Gummi- und Lederbälle gab es nicht, also mussten wir unsere Fußbälle selbst anfertigen. Wir bastelten sie aus alten Lumpen und Stoffresten, die wir mit einer Schnur fest umwickelten. Wenn zehn oder zwölf Lagerrabauken damit eine Stunde lang spielten, fielen die Bälle allerdings auseinander, deshalb war dieses Vergnügen nur von kurzer Dauer.
Ein anderes Spiel war das sogenannte Kreiseltreiben. Dabei wurde ein zylinderförmiges Holzstück, der Kreisel, mit den Fingern in der Luft gedreht und anschließend auf den Boden fallen gelassen. Mit einer selbstgebauten Peitsche wurde er ständig in Bewegung gehalten.
Ein weiterer beliebter Zeitvertreib war das Murmelspiel. Wir nannten es „Schussern“. Dabei wurde ein faustgroßes Loch in die Erde gedrückt, und zwei Spieler versuchten, aus etwa zwei Metern Entfernung die Murmeln per Zeigefinger in das vorgefertigte Loch zu schieben. Unsere ersten Murmeln bestanden aus Lehmkugeln, die wir selbst herstellten und in der Sonne trockneten; später konnte man Murmeln auch kaufen. Sieger war derjenige, der die meisten Kugeln in das Loch befördert hatte.
In Vergessenheit geraten ist heute das Reifentreiben. Dabei wurde eine alte Felge mit einem Stecken vorangetrieben. Auch leere Zwirnrollen warfen wir nicht einfach weg, sie wurden links und rechts mit einem Messer eingekerbt und so zu Rädern. Auf der Außenseite eines Rades schlugen wir zwei kleine Nägel diagonal ein. Ein dünner Gummiring wurde durch die Rolle gezogen und um die Nägel gewickelt. Auf der anderen Seite zogen wir ein zehn Zentimeter langes Hölzchen durch und drehten so lange, bis Spannung spürbar wurde. Die kleinen Gefährte bewegten sich langsam vorwärts. Wir nannten sie Panzerspähwagen, und wer den schnellsten hatte, war der Sieger.
Auch unsere Drachen bauten wir selbst. Im Herbst, wenn der Wind über die Stoppelfelder wehte, war die Zeit gekommen. Der erste Weg führte zum Schreiner. Je länger die Leisten, desto größer wurde der Drachen. In der Form eines Kreuzes wurden sie in der Mitte kräftig zusammengebunden. Die vier Enden wurden vorher eingekerbt und ringsherum für die Stabilität des Kopfes mit einer kräftigen Schnur gespannt. Schwieriger war das Besorgen von festem Papier: Zeitungspapier war nur für den Schwanz zu gebrauchen, und unser Kaufmann Bayerlein hatte kein Packpapier im Sonderangebot. Da war guter Rat teuer!
Die Lösung waren die Care-Pakete – genauer gesagt das Papier, mit denen sie umwickelt waren. Für unsere Drachen hatte es die richtige Stärke und Festigkeit. Wir legten das fertige Kreuz auf das Papier und schnitten es entlang der rundum gespannten Schnur mit Überstand ab. Eine Handvoll Weizenmehl wurde in einer Tasse mit etwas lauwarmem Wasser angerührt, das Papier damit tüchtig eingestrichen und über die Schnur geklebt. Mit Wasserfarben malten wir Augen, Mund und Nase auf, und links und rechts an die Querleisten hängten wir zwei bunte Papierbommeln, das waren die Ohren. Am schwierigsten war die Waage: Die musste genau ausbalanciert werden, das heißt, der Winkel, mit dem der Drachen im Wind stand, musste gut ausgemessen werden. Dies schafften nur die erfahrensten Burschen.
Als Nächstes kam der Schwanz an die Reihe, der ebenfalls nicht leicht zu basteln war. Halbe Seiten Zeitungspapier wurden zu einer Fliege gedreht und so nacheinander zu einem Schwanz gebunden. Es musste eine feste Schnur sein, damit er sich in der Luft nicht zusammenrollte. Länge und Gewicht des Schwanzes waren das A und O: War er zu kurz oder zu leicht, kippte der Drachen vornüber, war er zu lang und zu schwer, stieg der Drachen nicht auf.
Das größte Problem war, die Drachenschnur zu organisieren. Nylonschnur gab es noch nicht, der Zwirn aus Mamas Nähkästchen war zu schwach, Paketschnur war zu dick und zu schwer. Doch irgendwie wurde auch das gemeistert. Flog der Drachen dann endlich am Himmel, war die Freude groß. Je höher er stieg, umso größer war das Ansehen des Besitzers. Wir durchbohrten alte Briefcouverts in der Mitte und beförderten sie auf der Schnur mit Windkraft nach oben: Der Drachen bekam Post.
Ein überaus beliebtes Spiel für uns Jungen war das Seifenkistenfahren. Doch bevor so ein Vehikel fahrbereit war, musste es erst gebaut werden. Uns standen nur die einfachsten Mittel zur Verfügung, und um sie zu beschaffen, mussten wir das halbe Dorf durchsuchen. Da war wieder „Keupeln” angesagt! Als Erstes brauchten wir für unser Fahrgestell ein anderthalb Meter langes, gerades Brett. Ein alter, nicht mehr brauchbarer Kinderwagen wurde ausgeschlachtet. Wichtig davon waren für uns nur die zwei Achsen und die vier Räder.
Die Hinterachse war relativ leicht zu montieren. In der Lenkachse vorne jedoch musste ein Loch in die Mitte gebohrt werden, und kein Handwerker im Lager hatte damals eine Bohrmaschine. ...
Alle zwei Wochen wurde gebadet - es gab nur eine große Zinkwanne für die ganze Lagerbagage. Das Häuschen mit den Plumpsklos war etwa zehn mal fünf Meter groß und der Länge nach geteilt. In der Mitte befanden sich je sechs Kloschüsseln ohne Wasserspülung. An jedem Türchen war ein Schloss angebracht, doch schon nach Wochen waren die Schlösser kaputt oder mit Gewalt herausgerissen. Klopapier gab es nicht. Wir schnitten alte Zeitungen in handgroße Stücke und drückten sie an einen Nagel. Geputzt wurden die Toiletten selten oder gar nicht, denn keiner war zuständig oder wollte die Verantwortung übernehmen. Die hygienischen Verhältnisse waren fürchterlich, im Sommer stank es abscheulich. Alle paar Monate wurde die Grube von einem Bauern aus dem Dorf mit einer Stielkelle von Hand ausgeschöpft.
Überall fehlte es an Sauberkeit. Dass unter solchen Umständen keine Krankheiten ausbrachen, grenzt an ein Wunder! Die Mehlwürmer krabbelten an den Wänden, an der Decke und am Boden entlang. Am schlimmsten aber waren die Wanzen. Sie piesackten jeden, hauptsächlich in der Nacht. Alle paar Monate kam der Kammerjäger, dann mussten wir in aller Frühe die Zimmer verlassen, Türen und Fenster wurden zugeklebt und die Zimmer voll Gas gepumpt. Erst abends durften wir unsere armseligen Behausungen wieder betreten. Die Freude, nachts schlafen zu können, dauerte jedoch nur ein paar Wochen, dann war eine neue Generation von Plagegeistern geschlüpft, und es ging wieder los.
In dieser Zeit mussten wir alle ums Überleben kämpfen, Hunger und Not gehörten zum Alltag. Die Lagerverpflegung reichte bei weitem nicht aus. Grauenvoll war die sogenannte Kartoffelsuppe – sie bestand mehr aus Schalen als aus Kartoffeln. Die Großküche im Lager hatte auch nicht viel zu bieten, es fehlte an Nachschub. Aber da die meisten Bewohner mehr oder weniger aus bäuerlichen Familien stammten, bauten sie Kaninchen-, Gänse- oder Entenställe und stellten in jedem kleinsten Eck Verhaue auf. Wir hielten uns ein halbes Dutzend Gänse, die im Spätherbst gestopft wurden: Kartoffeln und Getreide wurden gekocht, mit Kleie vermischt und dann mit der Hand zu kleinen Würstchen gedreht. Schnabel auf, Würstchen rein, mit dem Kochlöffelstiel nachgeholfen und dann einen Schluck Wasser hinterher. Die Quälerei wiederholte sich mehrere Male. Weihnachten war jedoch auf diese Weise gerettet.
Kaum waren die Felder in der Umgebung abgeerntet, ging die Ährenlese los. Nur die schnellsten machten hier das Rennen. Mähdrescher gab es damals noch nicht. Wir sammelten immer eine große Handvoll Ähren mit Halmen und banden sie zu „Puppen“. Zwanzig bis fünfundzwanzig davon brachten wir Kinder am Tag zusammen. Sie kamen alle in einen Sack und wurden in die Schnörleinsmühle gebracht, wo der Müller uns etliche Pfund Mehl dafür gab. Er war auch Besitzer eines Sägewerkes, dort durften wir mit einer Art Spaten die Rinde von den Stämmen schälen und kostenlos als Brennmaterial mit nach Hause nehmen.
Für uns Kinder war das „Kartoffelstoppeln“ eine richtige Knochenarbeit. Zuvor mussten wir den Bauern um Erlaubnis fragen, doch wie freuten wir uns, wenn wir ein kleines Säckchen Kartoffeln zusammenbrachten! Sogleich lieferten wir die Erdäpfel in der Lagerküche ab. Sie wurden geschält und gerieben, und am nächsten Tag gab es dann Kartoffelpuffer mit Zucker oder Salz, die wir „Plotzgen“ nannten.
Tage vorher machten wir schon aus, wann wir in die Blaubeeren gehen würden. Brot, Quark, gekochte Eier und einige Kannen voll Tee wurden eingepackt, und in aller Frühe zog die Karawane los, Kinder wie Erwachsene, mit Eimern und Töpfen bewaffnet. Einmal kamen wir auf dem Heimweg in ein Gewitter. Es fing fürchterlich an zu regnen, und wir waren mitten im Gelände ohne Möglichkeit zum Unterstellen. Unsere Wassereimer waren voll mit Beeren, die der Regen ärgerlicherweise zum Teil wegspülte.
Ein Teil des Obstes wurde zu Hause eingeweckt. Gläser gab es dafür nicht, deshalb wurden die Beeren kurzerhand in Bierflaschen abgefüllt. Später in den Regalen fingen sie oftmals an zu gären und explodierten förmlich. Man kann sich das Ergebnis vorstellen.
Unsere Mutter war mit den neuen Lebensumständen einigermaßen zufrieden. Es gab in Mistelbach eine evangelische Kirche, eine Eisenbahnverbindung nach Bayreuth und eine Schule. Nur mit dem fränkischen Dialekt kam sie nicht so recht klar.
Wir brauchten nicht mehr auf dem Fußboden zu schlafen, sondern bekamen roh gezimmerte zweistöckige Bettgestelle. So richtig ruhig wurde es aber nie im Saal. Bis weit nach Mitternacht herrschte ein ständiges Kommen und Gehen, den ganzen Tag war fortwährend Kindergeschrei zu hören. Die einen lachten, die anderen schimpften, wieder andere weinten, und manche hatten Schmerzen. Es wurde gehustet, geschnäuzt und gefurzt. Reibereien, Sticheleien, Liebeleien, Hass und Wut gab es täglich. Einer schaute auf den anderen, man ging sich auf die Nerven. Gleich nebenan wurden Kinder gezeugt, drei Betten weiter wurde gestorben. Das größte Problem, glaube ich, war der Neid. Wertsachen, Süßigkeiten und dergleichen wurden vor neugierigen Blicken versteckt. Bloß nichts sehen lassen!
Unsere Mutter bewies in allen Lebenslagen großes Gottvertrauen. Sie hatte stets ein Sprichwort bei der Hand. Oftmals sagte sie mit erhobenem Zeigefinger zu uns Kindern: „Spare in der Zeit, so hast du in der Not!“ Kaum zu glauben, aber wir haben damals wirklich noch gespart: Ein paar wenige Scheine von Mutters bescheidener Rente wie auch von Mamas Kriegerwitwenrente verschwanden in der wohlgehüteten braunen Ledertasche, die mit einem zusätzlichen Hosengürtel gesichert war. ...
Kinderspiele (S. 92)
Unsere Spiele waren einfach und doch aufregend und unterhaltsam. Gummi- und Lederbälle gab es nicht, also mussten wir unsere Fußbälle selbst anfertigen. Wir bastelten sie aus alten Lumpen und Stoffresten, die wir mit einer Schnur fest umwickelten. Wenn zehn oder zwölf Lagerrabauken damit eine Stunde lang spielten, fielen die Bälle allerdings auseinander, deshalb war dieses Vergnügen nur von kurzer Dauer.
Ein anderes Spiel war das sogenannte Kreiseltreiben. Dabei wurde ein zylinderförmiges Holzstück, der Kreisel, mit den Fingern in der Luft gedreht und anschließend auf den Boden fallen gelassen. Mit einer selbstgebauten Peitsche wurde er ständig in Bewegung gehalten.
Ein weiterer beliebter Zeitvertreib war das Murmelspiel. Wir nannten es „Schussern“. Dabei wurde ein faustgroßes Loch in die Erde gedrückt, und zwei Spieler versuchten, aus etwa zwei Metern Entfernung die Murmeln per Zeigefinger in das vorgefertigte Loch zu schieben. Unsere ersten Murmeln bestanden aus Lehmkugeln, die wir selbst herstellten und in der Sonne trockneten; später konnte man Murmeln auch kaufen. Sieger war derjenige, der die meisten Kugeln in das Loch befördert hatte.
In Vergessenheit geraten ist heute das Reifentreiben. Dabei wurde eine alte Felge mit einem Stecken vorangetrieben. Auch leere Zwirnrollen warfen wir nicht einfach weg, sie wurden links und rechts mit einem Messer eingekerbt und so zu Rädern. Auf der Außenseite eines Rades schlugen wir zwei kleine Nägel diagonal ein. Ein dünner Gummiring wurde durch die Rolle gezogen und um die Nägel gewickelt. Auf der anderen Seite zogen wir ein zehn Zentimeter langes Hölzchen durch und drehten so lange, bis Spannung spürbar wurde. Die kleinen Gefährte bewegten sich langsam vorwärts. Wir nannten sie Panzerspähwagen, und wer den schnellsten hatte, war der Sieger.
Auch unsere Drachen bauten wir selbst. Im Herbst, wenn der Wind über die Stoppelfelder wehte, war die Zeit gekommen. Der erste Weg führte zum Schreiner. Je länger die Leisten, desto größer wurde der Drachen. In der Form eines Kreuzes wurden sie in der Mitte kräftig zusammengebunden. Die vier Enden wurden vorher eingekerbt und ringsherum für die Stabilität des Kopfes mit einer kräftigen Schnur gespannt. Schwieriger war das Besorgen von festem Papier: Zeitungspapier war nur für den Schwanz zu gebrauchen, und unser Kaufmann Bayerlein hatte kein Packpapier im Sonderangebot. Da war guter Rat teuer!
Die Lösung waren die Care-Pakete – genauer gesagt das Papier, mit denen sie umwickelt waren. Für unsere Drachen hatte es die richtige Stärke und Festigkeit. Wir legten das fertige Kreuz auf das Papier und schnitten es entlang der rundum gespannten Schnur mit Überstand ab. Eine Handvoll Weizenmehl wurde in einer Tasse mit etwas lauwarmem Wasser angerührt, das Papier damit tüchtig eingestrichen und über die Schnur geklebt. Mit Wasserfarben malten wir Augen, Mund und Nase auf, und links und rechts an die Querleisten hängten wir zwei bunte Papierbommeln, das waren die Ohren. Am schwierigsten war die Waage: Die musste genau ausbalanciert werden, das heißt, der Winkel, mit dem der Drachen im Wind stand, musste gut ausgemessen werden. Dies schafften nur die erfahrensten Burschen.
Als Nächstes kam der Schwanz an die Reihe, der ebenfalls nicht leicht zu basteln war. Halbe Seiten Zeitungspapier wurden zu einer Fliege gedreht und so nacheinander zu einem Schwanz gebunden. Es musste eine feste Schnur sein, damit er sich in der Luft nicht zusammenrollte. Länge und Gewicht des Schwanzes waren das A und O: War er zu kurz oder zu leicht, kippte der Drachen vornüber, war er zu lang und zu schwer, stieg der Drachen nicht auf.
Das größte Problem war, die Drachenschnur zu organisieren. Nylonschnur gab es noch nicht, der Zwirn aus Mamas Nähkästchen war zu schwach, Paketschnur war zu dick und zu schwer. Doch irgendwie wurde auch das gemeistert. Flog der Drachen dann endlich am Himmel, war die Freude groß. Je höher er stieg, umso größer war das Ansehen des Besitzers. Wir durchbohrten alte Briefcouverts in der Mitte und beförderten sie auf der Schnur mit Windkraft nach oben: Der Drachen bekam Post.
Ein überaus beliebtes Spiel für uns Jungen war das Seifenkistenfahren. Doch bevor so ein Vehikel fahrbereit war, musste es erst gebaut werden. Uns standen nur die einfachsten Mittel zur Verfügung, und um sie zu beschaffen, mussten wir das halbe Dorf durchsuchen. Da war wieder „Keupeln” angesagt! Als Erstes brauchten wir für unser Fahrgestell ein anderthalb Meter langes, gerades Brett. Ein alter, nicht mehr brauchbarer Kinderwagen wurde ausgeschlachtet. Wichtig davon waren für uns nur die zwei Achsen und die vier Räder.
Die Hinterachse war relativ leicht zu montieren. In der Lenkachse vorne jedoch musste ein Loch in die Mitte gebohrt werden, und kein Handwerker im Lager hatte damals eine Bohrmaschine. ...
Buchtipps

 Band 30. Unsere Heimat - unsere Geschichten. Wenn Erinnerungen lebendig werden. Rückblenden 1921 bis 1980
Band 30. Unsere Heimat - unsere Geschichten. Wenn Erinnerungen lebendig werden. Rückblenden 1921 bis 1980Zum Shop »
 Band 29. Als wir Räuber und Gendarm spielten. Erinnerungen von Kindern an ihre Spiele. 1930-1968
Band 29. Als wir Räuber und Gendarm spielten. Erinnerungen von Kindern an ihre Spiele. 1930-1968Zum Shop »

 Reinhard Tischer
Reinhard Tischer