Buchcover und bibliografische Daten:
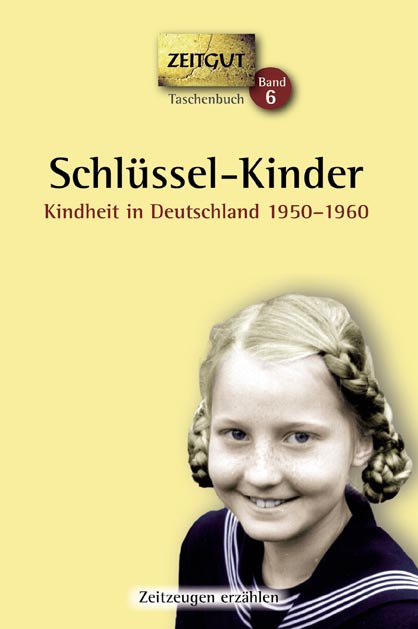
Schlüssel-Kinder
Kindheit in Deutschland
1950-1960
Erinnerungen von Zeitzeugen
336 Seiten mit Fotos
Zeitgut Verlag Berlin
Taschenbuch
ISBN 978-3-86614-156-8
zum Shop »
Kindheit in Deutschland
1950-1960
Erinnerungen von Zeitzeugen
336 Seiten mit Fotos
Zeitgut Verlag Berlin
Taschenbuch
ISBN 978-3-86614-156-8
zum Shop »

Halbstark und tüchtig
Jugend in Deutschland
1950-1960
Erinnerungen von Zeitzeugen
320 Seiten mit Fotos
Zeitgut Verlag Berlin
Taschenbuch
ISBN 978-3-86614-114-8
zum Shop »
Jugend in Deutschland
1950-1960
Erinnerungen von Zeitzeugen
320 Seiten mit Fotos
Zeitgut Verlag Berlin
Taschenbuch
ISBN 978-3-86614-114-8
zum Shop »
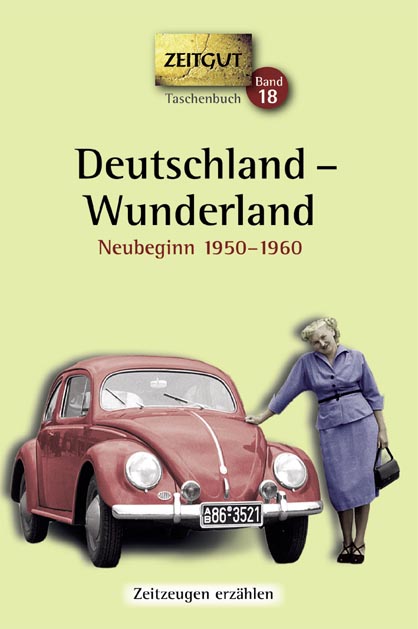
Halbstark und tüchtig
Neubeginn 1950-1960
Erinnerungen von Zeitzeugen
368 Seiten mit Fotos
Zeitgut Verlag Berlin
Taschenbuch
ISBN 978-3-86614-115-5
zum Shop »
Neubeginn 1950-1960
Erinnerungen von Zeitzeugen
368 Seiten mit Fotos
Zeitgut Verlag Berlin
Taschenbuch
ISBN 978-3-86614-115-5
zum Shop »
Ihre Fragen beantwortet gern:
Lydia Beier
Öffentlichkeitsarbeit
Zeitgut Verlag GmbH, Berlin
E-Mail: Lydia.beier@zeitgut.com
Tel. 030 - 70 20 93 14
Fax 030 - 70 20 93 22
Lydia Beier
Öffentlichkeitsarbeit
Zeitgut Verlag GmbH, Berlin
E-Mail: Lydia.beier@zeitgut.com
Tel. 030 - 70 20 93 14
Fax 030 - 70 20 93 22
Das Lebensgefühl der 50er Jahre - kostenfreie Abdrucktexte
Die schweren Jahre der
Nachkriegszeit gehen zu Ende, der wirtschaftliche Aufschwung wird vor allem im
Westen spürbar. Es darf wieder geträumt werden: von einem eigenen Fernseher,
einem Auto oder sogar von einer kleinen Reise. Die unterschiedlich geprägten
Erinnerungen von Zeitzeugen aus dem Ost- und aus dem Westteil des Landes
zeichnen ein vielschichtiges Bild des Alltags in den 50er Jahren.

Foto: Dorothea Voigtländer (links) mit Tante Kathi und Freundin 1952. Aus dem Buch "Schlüssel-Kinder" (siehe Geschichte "Der Fremde draußen vor der Tür")
Bei Veröffentlichung eines der folgenden Texte bitten wir Sie, mindestens die bibliographischen Daten zum Buch mit der Webadresse des Zeitgut Verlages www.zeitgut.com abzudrucken.
Beim Abdruck von Abbildungen zum Text ist als Quelle „Zeitgut Verlag/Name des Verfassers“ anzugeben.
Bitte senden Sie uns nach Veröffentlichung einen Beleg zu. Vielen Dank.
Diese Geschichten stellen wir kostenfrei zur Verfügung
Pressetext "Lebensgefühl der 50er Jahre", 1.370 Zeichen l PDF »
1. Der Fremde draußen vor der Türe, 5.461 Zeichen (siehe unten)
2. Aufklärung, 3.362 Zeichen (siehe unten)
3. Wie Elvis 5.156 Zeichen l Geschichte lesen » l PDF »
4. Der elektrische Weidezaun, 4.462 Zeichen (siehe unten)
5. Ferien mit 80 Mark in der Tasche l Geschichte lesen » l PDF »
6. Wir träumen nicht nur von Italien, 13.657 Zeichen
(schöne Fotos) l PDF »
7. 1951 - ein aufregendes Jahr, 6.017 Zeichen (siehe unten)
Die Fotos sende ich Ihnen auf Anfrage in Druckqualität zu.
E-Mail an lydia.beier@zeitgut.com
Der Fremde draußen vor der Türe
Geschichte aus "Schlüssel-Kinder"
 Dorothea Voigtländer März im 1954. "Wir Schlüssel-Kinder wurden nicht gerade
beneidet. Deshalb trug ich den Schlüssel unter dem Pullover. Weil ich so dünn
war, wurde ich von 1950 bis 1954 jedes Jahr in den Schulferien aufs Land
verschickt."
Dorothea Voigtländer März im 1954. "Wir Schlüssel-Kinder wurden nicht gerade
beneidet. Deshalb trug ich den Schlüssel unter dem Pullover. Weil ich so dünn
war, wurde ich von 1950 bis 1954 jedes Jahr in den Schulferien aufs Land
verschickt."Geschichte als PDF-Datei »
Dorothea F. Voigtländer
Bonn, Nordrhein-Westfalen; Februar 1950
Er weinte. Die Tränen liefen ihm langsam über das Gesicht, verfingen sich in den Bartstoppeln, und seine großen, braunen Augen blickten mich mit unendlicher Erleichterung an. „Du bist also die kleine Dorothea?“, fragte er, und wieder schluchzte er.
Dann fing auch ich an zu weinen, denn so etwas hatte ich noch nie gesehen: einen so jungen Mann, der weinte!
Er trug einen Rucksack und eine grüne Kappe auf seinen schwarzen, lockigen Haaren. Merkwürdigerweise hatte ich keine Angst. Dabei hatte ich das Verbot von Mutti mißachtet: „Die Haustüre bleibt fest verschlossen.“
Und so begann es: Es hatte geschellt. Hinter der Glastüre zeichnete sich die Silhouette eines großen Mannes ab, der nach Mutti fragte, der auch nach mir fragte. Das war komisch. Die Stimme kannte ich nicht. Nach langem Flehen und Betteln des Mannes zog ich den Haustürschlüssel mit der Kordel über den Kopf. Kalt lag der Schlüssel einige Sekunden in meiner Hand, unbeweglich stand ich da, fast wie gelähmt. Soll ich, oder doch lieber nicht?
Aber ich hatte keine Angst. Seltsam. Bisher hatte ich eigentlich immer Angst gehabt, hatte mich fest in die Wohnung eingeschlossen, bis Mutti von der Arbeit zurückgekommen war. Das war dann immer wie ein Fest. Doch diesmal hatte ich ihr Verbot mißachtet und stand weinend vor dem Mann, der immer noch draußen vor der Türe stand und mich anstarrte. Liebevoll, wie ich als realistisch denkendes Kriegs- und Nachkriegskind registrierte. Irgendwie kam er mir dann sogar bekannt vor.
Schließlich überwand ich meine Scheu und ich bat ihn höflich in die Wohnung: „Wollen Sie einen Kaffee? Ich habe noch welchen da. Geklaut natürlich.“ Ich tat großartig und selbstbewußt und erntete ein sanftes Lächeln.
Schwerfällig setzte sich der Mann auf den Küchenstuhl, streckte ein Bein vor und seufzte. Er hatte Schmerzen.
"Mein Bein, vom Krieg“, sagte er wie entschuldigend.
„Ich weiß“, sagte ich selbstbewußt, „aber seien Sie froh, daß Sie es noch haben, der Onkel Ludwig hat sein rechtes Bein verloren, von oben bis unten.“
„Was, der Ludwig hat auch überlebt?“, fragte der Mann und begann wieder zu weinen.
„Der Kaffee wird Sie schon wieder aufmuntern“, tröstete ich ihn.
„Du redest genau wie deine Mutter“, sagte der Mann und strich mir scheu über den Scheitel. „Und Deine Zöpfe sind schön dick und lang.“ Er wußte, wie man „jungen Damen“ von damals schmeichelte.
Tatsächlich waren meine Zöpfe mein ganzer Stolz, obwohl mein Haar zu kraus war, als daß sie lange ordentlich hielten. Mehrmals am Tag flocht ich meine Zöpfe, band bunte Schleifen hinein und fand mich natürlich schön!
Mit langsamen Schlucken trank der Mann seinen Kaffee. Schließlich konnte ich mit meinen sieben Jahren schon fast kochen. Das von Mutti vorbereitete Abendessen lag unter einem Tuch, von Fliegen geschützt, neben dem Gasherd. Punkt sechs Uhr mußte ich die Kartoffeln aufstellen. Und wenn sie gar waren, dann kam Mutti und brachte Roswitha mit, die tagsüber bei Tante Rosi war.
„Mutti kommt gleich mit Roswitha“, sagte ich dem Mann und stellte den Topf mit den geschälten Kartoffeln auf den Gasherd. Als ich mich umdrehte, hatte der Mann seinen Kopf in beide Hände auf den Küchentisch gestützt und weinte lautlos mit zuckenden Schultern.
„Also Roswitha heißt das zweite und ist ein Mädchen“, sagte er mit ganz leiser Stimme und starrte mit tränennassen Augen aus dem Fenster.
Der Ausblick war nicht der Schönste. Hier bäumte sich ein riesiger Trümmerhaufen, denn das Nachbarhaus war von den Bomben getroffen worden. Die erste Frühlingssonne schien in die Küche, die ich morgens noch geputzt hatte, damit sich Mutti heute abend freuen sollte.
Dann hörte ich ihre Schritte. Der Mann sprang wie elektrisiert von seinem Stuhl, stöhnte leise, als er sein verletzten Bein nachzog und blieb wie erstarrt stehen, als er das muntere Kinderplappern von Roswitha hörte, die gleich darauf in die Küche hineinhüpfte.
„Mutti, die Dorothea hat einen fremden Mann reingelassen! Auweia, das gibt Ärger“, freute sie sich schon.
Dann war es plötzlich ganz still. Mutti stand in der Küchentüre und war ganz weiß im Gesicht. Dann liefen der Mann und Mutti aufeinander zu und umarmten sich, küßten sich sogar.
Wir Kinder waren sprachlos.
„Daß ihr noch alle lebt und wohlauf seid“, sagte der Mann dann ganz zärtlich zu Mutti, die sich fest in seine Arme kuschelte. So hatte ich meine selbstbewußte und starke Mutter noch nie gesehen! Sie sah richtig schön aus und viel, viel jünger. Auch war sie heute überhaupt nicht müde, wie sonst, wenn sie um diese Zeit nach Haus kam.
So lernte ich im Februar 1950 meinen Vater kennen, der aus Krieg und russischer Kriegsgefangenschaft nach Hause kam. Fast sieben Jahre lang hatten wir nichts von ihm gehört. Er galt seit Juli 1943 als vermißt. Im Mai 1944 war meine Schwester Roswitha geboren worden. Irgendwie muß ich es gespürt haben, daß ich diesem „fremden Mann“ vertrauen konnte und ihm die Türe geöffnet hatte. Unsere Herzen hatte er ohnehin sofort erobert. Wer so nett zu Mutti war, der mußte gut sein!
Als Vati Christoph dann aus dem Bad kam, da verliebten sich seine Töchter in den schmucken, jungen Mann. Endlich waren wir eine richtige Familie.
Und abends wurde mit Oma, Opa, Onkel Hans und Tante Kathi mit Tränen und Lachen gefeiert. Die anderen Verwandten versuchten wir telefonisch zu erreichen: „Christoph lebt und ist heil wieder da“, so tönte es den ganzen Abend.
Bonn, Nordrhein-Westfalen; Februar 1950
Er weinte. Die Tränen liefen ihm langsam über das Gesicht, verfingen sich in den Bartstoppeln, und seine großen, braunen Augen blickten mich mit unendlicher Erleichterung an. „Du bist also die kleine Dorothea?“, fragte er, und wieder schluchzte er.
Dann fing auch ich an zu weinen, denn so etwas hatte ich noch nie gesehen: einen so jungen Mann, der weinte!
Er trug einen Rucksack und eine grüne Kappe auf seinen schwarzen, lockigen Haaren. Merkwürdigerweise hatte ich keine Angst. Dabei hatte ich das Verbot von Mutti mißachtet: „Die Haustüre bleibt fest verschlossen.“
Und so begann es: Es hatte geschellt. Hinter der Glastüre zeichnete sich die Silhouette eines großen Mannes ab, der nach Mutti fragte, der auch nach mir fragte. Das war komisch. Die Stimme kannte ich nicht. Nach langem Flehen und Betteln des Mannes zog ich den Haustürschlüssel mit der Kordel über den Kopf. Kalt lag der Schlüssel einige Sekunden in meiner Hand, unbeweglich stand ich da, fast wie gelähmt. Soll ich, oder doch lieber nicht?
Aber ich hatte keine Angst. Seltsam. Bisher hatte ich eigentlich immer Angst gehabt, hatte mich fest in die Wohnung eingeschlossen, bis Mutti von der Arbeit zurückgekommen war. Das war dann immer wie ein Fest. Doch diesmal hatte ich ihr Verbot mißachtet und stand weinend vor dem Mann, der immer noch draußen vor der Türe stand und mich anstarrte. Liebevoll, wie ich als realistisch denkendes Kriegs- und Nachkriegskind registrierte. Irgendwie kam er mir dann sogar bekannt vor.
Schließlich überwand ich meine Scheu und ich bat ihn höflich in die Wohnung: „Wollen Sie einen Kaffee? Ich habe noch welchen da. Geklaut natürlich.“ Ich tat großartig und selbstbewußt und erntete ein sanftes Lächeln.
Schwerfällig setzte sich der Mann auf den Küchenstuhl, streckte ein Bein vor und seufzte. Er hatte Schmerzen.
"Mein Bein, vom Krieg“, sagte er wie entschuldigend.
„Ich weiß“, sagte ich selbstbewußt, „aber seien Sie froh, daß Sie es noch haben, der Onkel Ludwig hat sein rechtes Bein verloren, von oben bis unten.“
„Was, der Ludwig hat auch überlebt?“, fragte der Mann und begann wieder zu weinen.
„Der Kaffee wird Sie schon wieder aufmuntern“, tröstete ich ihn.
„Du redest genau wie deine Mutter“, sagte der Mann und strich mir scheu über den Scheitel. „Und Deine Zöpfe sind schön dick und lang.“ Er wußte, wie man „jungen Damen“ von damals schmeichelte.
Tatsächlich waren meine Zöpfe mein ganzer Stolz, obwohl mein Haar zu kraus war, als daß sie lange ordentlich hielten. Mehrmals am Tag flocht ich meine Zöpfe, band bunte Schleifen hinein und fand mich natürlich schön!
Mit langsamen Schlucken trank der Mann seinen Kaffee. Schließlich konnte ich mit meinen sieben Jahren schon fast kochen. Das von Mutti vorbereitete Abendessen lag unter einem Tuch, von Fliegen geschützt, neben dem Gasherd. Punkt sechs Uhr mußte ich die Kartoffeln aufstellen. Und wenn sie gar waren, dann kam Mutti und brachte Roswitha mit, die tagsüber bei Tante Rosi war.
„Mutti kommt gleich mit Roswitha“, sagte ich dem Mann und stellte den Topf mit den geschälten Kartoffeln auf den Gasherd. Als ich mich umdrehte, hatte der Mann seinen Kopf in beide Hände auf den Küchentisch gestützt und weinte lautlos mit zuckenden Schultern.
„Also Roswitha heißt das zweite und ist ein Mädchen“, sagte er mit ganz leiser Stimme und starrte mit tränennassen Augen aus dem Fenster.
Der Ausblick war nicht der Schönste. Hier bäumte sich ein riesiger Trümmerhaufen, denn das Nachbarhaus war von den Bomben getroffen worden. Die erste Frühlingssonne schien in die Küche, die ich morgens noch geputzt hatte, damit sich Mutti heute abend freuen sollte.
Dann hörte ich ihre Schritte. Der Mann sprang wie elektrisiert von seinem Stuhl, stöhnte leise, als er sein verletzten Bein nachzog und blieb wie erstarrt stehen, als er das muntere Kinderplappern von Roswitha hörte, die gleich darauf in die Küche hineinhüpfte.
„Mutti, die Dorothea hat einen fremden Mann reingelassen! Auweia, das gibt Ärger“, freute sie sich schon.
Dann war es plötzlich ganz still. Mutti stand in der Küchentüre und war ganz weiß im Gesicht. Dann liefen der Mann und Mutti aufeinander zu und umarmten sich, küßten sich sogar.
Wir Kinder waren sprachlos.
„Daß ihr noch alle lebt und wohlauf seid“, sagte der Mann dann ganz zärtlich zu Mutti, die sich fest in seine Arme kuschelte. So hatte ich meine selbstbewußte und starke Mutter noch nie gesehen! Sie sah richtig schön aus und viel, viel jünger. Auch war sie heute überhaupt nicht müde, wie sonst, wenn sie um diese Zeit nach Haus kam.
So lernte ich im Februar 1950 meinen Vater kennen, der aus Krieg und russischer Kriegsgefangenschaft nach Hause kam. Fast sieben Jahre lang hatten wir nichts von ihm gehört. Er galt seit Juli 1943 als vermißt. Im Mai 1944 war meine Schwester Roswitha geboren worden. Irgendwie muß ich es gespürt haben, daß ich diesem „fremden Mann“ vertrauen konnte und ihm die Türe geöffnet hatte. Unsere Herzen hatte er ohnehin sofort erobert. Wer so nett zu Mutti war, der mußte gut sein!
Als Vati Christoph dann aus dem Bad kam, da verliebten sich seine Töchter in den schmucken, jungen Mann. Endlich waren wir eine richtige Familie.
Und abends wurde mit Oma, Opa, Onkel Hans und Tante Kathi mit Tränen und Lachen gefeiert. Die anderen Verwandten versuchten wir telefonisch zu erreichen: „Christoph lebt und ist heil wieder da“, so tönte es den ganzen Abend.

Ende
Sommer 1950: Unsere Familie bei einem Ausflug zu Verwandten nach Aachen vor
unserem ersten Auto, einem „Opel Kapitän“. Links, vor Vati, stehe ich, in der
Mitte Mutti im geblümten Kleid.
Aufklärung
Geschichte aus "Schlüssel-Kinder"
 „So gefällst Du mir. Gespräch mit einem jungen Mädchen über
Schönheit und Gesundheit. - So sah eine der Schriften aus, die
mir mein Vater später zu lesen gab", erzählt Gudrun Findeisen
„So gefällst Du mir. Gespräch mit einem jungen Mädchen über
Schönheit und Gesundheit. - So sah eine der Schriften aus, die
mir mein Vater später zu lesen gab", erzählt Gudrun FindeisenGeschichte als PDF-Datei »
Gudrun Findeisen
Nordholz/Deichsende, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen; 1950
Eine Zeitlang mieteten meine Eltern Lesemappen, und ich Leseratte las und las. Das war wohl zu viel des Guten oder auch weniger Guten, was ich da in mich hineinlas, und so wurden die Lesemappen wieder abbestellt. Vorher leisteten sie mir aber noch einen guten Dienst.
Eines Tages – ich muß zehn oder elf Jahre alt gewesen sein – drückte mir mein Vater eine Zeitschrift (ich meine, es war die „Constanze“) in die Hand mit den Worten: „Hier, lies das bitte! Und wenn du Fragen hast, dann frag!“
Es war, soweit ich mich erinnere, der erste Aufklärungsbericht für Kinder, der in einer Illustrierten abgedruckt worden war. Natürlich war mir zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt, daß die Kinder nicht vom Klapperstorch gebracht werden. Unmittelbar nach unserer Flucht hatte eine junge Frau in dem Haus, in dem wir auf engstem Raum einquartiert waren, ein Baby bekommen, und außerdem ist Dorfkindern, die mit Tieren aufwachsen, vieles zu diesem Thema vertraut. Nun aber war auf dem Schulhof einiges für mich Ungereimtes an mein Ohr gedrungen.
Wie fortschrittlich und einfühlsam war mein Vater! Gewiß nicht nur, weil er Lehrer war. Durch seine Umsicht wurde meine Neugier nun in kindgemäßer Weise gestillt, und ich sah – zusätzlich mit den nötigen Erklärungen von meiner Mutter ausgerüstet – meinem nächsten Lebensabschnitt als Mädchen vertrauensvoll entgegen. Meinem jeweiligem Alter entsprechend, gab mir mein Vater in den folgenden Jahren weiterhin Beratungsbücher.
Dann war da noch die Geschichte mit den Luftballons. Eines Morgens brachte eine Mitschülerin einen ganzen Schwung Luftballons mit in die Schule und verteilte sie großzügig. Luftballons!
Wir Kinder auf dem Dorf bekamen solche Schätze in der Nachkriegszeit selten zu Gesicht. Wir staunten! „Wo gab es denn die, wo hast du die her?“
„Na, aus dem Nachtschrank der Eltern!“
Keines der Kinder – wir müssen zehn, elf und zwölf Jahre alt gewesen sein – wußte über solche Luftballons Bescheid, jedenfalls gab es keine Kommentare, und wir ließen unsere Luftballons fröhlich auf dem Schulhof schweben.
Waren ja etwas blaß diese Dinger! Bunt wären sie hübscher gewesen!
Aber wir waren ja bescheiden.
Stolz trug ich meinen Schatz nach Hause und wunderte mich über die Reaktion meiner Mutter und der großen Schwester, die ich in der Küche vorfand.
Wiese kicherten die? Und wieso meinte meine Mutter, damit solle ich man lieber nicht spielen?
Ich war enttäuscht, muß dann aber doch eine plausible Erklärung bekommen haben, denn ich entsorgte das Kondom bereitwillig.
Am nächsten Morgen in der Schule sorgten unsere Luftballons noch für genügend Gesprächsstoff unter uns Kindern. Ob sich neun Monate nach diesem „Luftballontag“ bei den Eltern des Mädchens, das so großzügig den Vorrat an „Luftballons“ verteilte, Nachwuchs eingestellt hat, ist mir nicht bekannt. Und ob sich diese Geschichte vor oder nach der väterlichen Aufklärungsaktion abgespielt hat, weiß ich heute auch nicht mehr. Es spielt aber auch keine Rolle; denn es ist nicht anzunehmen, daß man damals meinte, zehnjährige Kinder über Kondome aufklären zu müssen – es sei denn, es gab einen Anlaß wie diesen dazu. Aber selbst dann hielten die meisten Eltern es damals nicht für nötig oder genierten sich, ihre Kinder darüber aufzuklären. – Was hatte ich für ein Glück!
Nordholz/Deichsende, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen; 1950
Eine Zeitlang mieteten meine Eltern Lesemappen, und ich Leseratte las und las. Das war wohl zu viel des Guten oder auch weniger Guten, was ich da in mich hineinlas, und so wurden die Lesemappen wieder abbestellt. Vorher leisteten sie mir aber noch einen guten Dienst.
Eines Tages – ich muß zehn oder elf Jahre alt gewesen sein – drückte mir mein Vater eine Zeitschrift (ich meine, es war die „Constanze“) in die Hand mit den Worten: „Hier, lies das bitte! Und wenn du Fragen hast, dann frag!“
Es war, soweit ich mich erinnere, der erste Aufklärungsbericht für Kinder, der in einer Illustrierten abgedruckt worden war. Natürlich war mir zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt, daß die Kinder nicht vom Klapperstorch gebracht werden. Unmittelbar nach unserer Flucht hatte eine junge Frau in dem Haus, in dem wir auf engstem Raum einquartiert waren, ein Baby bekommen, und außerdem ist Dorfkindern, die mit Tieren aufwachsen, vieles zu diesem Thema vertraut. Nun aber war auf dem Schulhof einiges für mich Ungereimtes an mein Ohr gedrungen.
Wie fortschrittlich und einfühlsam war mein Vater! Gewiß nicht nur, weil er Lehrer war. Durch seine Umsicht wurde meine Neugier nun in kindgemäßer Weise gestillt, und ich sah – zusätzlich mit den nötigen Erklärungen von meiner Mutter ausgerüstet – meinem nächsten Lebensabschnitt als Mädchen vertrauensvoll entgegen. Meinem jeweiligem Alter entsprechend, gab mir mein Vater in den folgenden Jahren weiterhin Beratungsbücher.
Dann war da noch die Geschichte mit den Luftballons. Eines Morgens brachte eine Mitschülerin einen ganzen Schwung Luftballons mit in die Schule und verteilte sie großzügig. Luftballons!
Wir Kinder auf dem Dorf bekamen solche Schätze in der Nachkriegszeit selten zu Gesicht. Wir staunten! „Wo gab es denn die, wo hast du die her?“
„Na, aus dem Nachtschrank der Eltern!“
Keines der Kinder – wir müssen zehn, elf und zwölf Jahre alt gewesen sein – wußte über solche Luftballons Bescheid, jedenfalls gab es keine Kommentare, und wir ließen unsere Luftballons fröhlich auf dem Schulhof schweben.
Waren ja etwas blaß diese Dinger! Bunt wären sie hübscher gewesen!
Aber wir waren ja bescheiden.
Stolz trug ich meinen Schatz nach Hause und wunderte mich über die Reaktion meiner Mutter und der großen Schwester, die ich in der Küche vorfand.
Wiese kicherten die? Und wieso meinte meine Mutter, damit solle ich man lieber nicht spielen?
Ich war enttäuscht, muß dann aber doch eine plausible Erklärung bekommen haben, denn ich entsorgte das Kondom bereitwillig.
Am nächsten Morgen in der Schule sorgten unsere Luftballons noch für genügend Gesprächsstoff unter uns Kindern. Ob sich neun Monate nach diesem „Luftballontag“ bei den Eltern des Mädchens, das so großzügig den Vorrat an „Luftballons“ verteilte, Nachwuchs eingestellt hat, ist mir nicht bekannt. Und ob sich diese Geschichte vor oder nach der väterlichen Aufklärungsaktion abgespielt hat, weiß ich heute auch nicht mehr. Es spielt aber auch keine Rolle; denn es ist nicht anzunehmen, daß man damals meinte, zehnjährige Kinder über Kondome aufklären zu müssen – es sei denn, es gab einen Anlaß wie diesen dazu. Aber selbst dann hielten die meisten Eltern es damals nicht für nötig oder genierten sich, ihre Kinder darüber aufzuklären. – Was hatte ich für ein Glück!
Der elektrische Weidezaun
Geschichte aus Schlüssel-Kinder von Georg Hörmann
Neuburg/Kammel, Bayern, 1953 l Geschichte als PDF-Datei »
„Büable, morga nachmittag brauscht nit Küah hüata, denn bis dau na han i mein elektrischa Zau fertig“, rief mir mein Onkel, freudig erregt entgegen, als ich mittags, von der Schule kommend, an seinem Bauernhof vorbeilief.
Das war mit gerade recht, so konnte ich mit meinen Freunden am Kammelwehr zum Baden gehen. Mein Onkel hatte eine kleine Landwirtschaft, und in den Sommermonaten hütete ich seine Kühe gegen ein willkommenes Trinkgeld öfters auf der Weide. Es war in den 50er Jahren, als in meiner Heimat die ersten elektrischen Weidezäune aufkamen. Zu einer solchen Anlage gehörten spezielle Batterien, das entsprechende Gerät für die Umwandlung des Batteriestroms in deutliche spürbare Stromschläge, Draht für die Stromleitung um die Wiese und Pfähle oder eiserne Pflöcke mit isolierten Drahthaltern. Natürlich war das alles nicht ganz billig, so daß die Anschaffung für einen sparsamen schwäbischen Bauern mit einigen inneren Widerständen verbunden war.
Mein Onkel, der bekannt für seine Basteleien war, hatte sich bei der BayWa*) die neue Erfindung angeschaut und nach kurzem Überlegen entschlossen, den Elektrozaun selbst nachzubauen. „Dös wär ja no schöner, wenn i dös net nabringa dät“, sagte er zu seiner Frau, „onsra Wiesn isch ja glei henterm Stall, do brauch i doch koi duira Batterie kaufa, wenn i da Strom glei aus der Steckdos von der Melkkammer nemma ka.“
Gesagt, getan! In die Pfähle des alten Stacheldrahtzaunes drehte er vorschriftsmäßig Stifte mit isolierten Haken und zog einen dünnen Draht, diesen um die Stifte wickelnd, von Pfahl zu Pfahl um die Wiese. Für die letzten 20 Meter von der Wiese über den Hof bis zur Melkkammer verwendete er eine isolierte Leitung, weil ja diese, auf dem Boden liegend, sonst den Strom ins Erdreich abgeleitet hätte. Er klemmte die Drahtenden in einen Stecker und drückte ihn in die Steckdose. Der Weidedraht stand unter Strom!
Da er sich schon dachte, daß der Haushaltsstrom etwas stärker sein könnte als der offizielle Batteriestrom, versäumte er nicht, an der Seite zum Nachbargrundstück noch ein Schild mit der Aufschrift „Vorsicht – Elektrozaun – Lebensgefahr!“ an einen Pfahl zu hängen.
„Rosa, laß die Küah raus, dr Zau isch fertig!“, rief er seiner Frau im Stall zu.
Diese öffnete die Tür und schnell eilten die hungrigen Kühe nach der abendlichen Melkzeit der Wiese zu. Der Bauer schloß die Stangen zum Wieseneingang und blickte stolz und erwartungsvoll auf sein Werk.
Inzwischen erreichte die erste Kuh den Zaun. Sie streckte den Kopf unter dem Elektrodraht zu den saftigen Grasbüscheln der Nachbarwiese und berührte mit dem Nacken den geladenen Draht. Wie vom Blitz getroffen fiel sie um, wobei sich der Draht im Gehörn verfing. Eine zweite Kuh, erstaunt über die im Gras liegende Genossin, schnupperte neugierig an dieser, berührte sie kurz mit ihrem Maul und wurde schlagartig, wild mit den ausgestreckten Beinen zuckend, umgeworfen.
Der Bauer starrte zunächst wie gelähmt auf die Geschehnisse, sprang dann auf die Wiese, um die regungslos am Boden liegenden Kühe vom Zaun wegzuziehen. Er packte den Kopf der zweiten Kuh, der auf dem Bauch der ersten lag, und – stürzte augenblicklich ebenfalls zu Boden, wo er bewußtlos liegenblieb.
Inzwischen war auch seine Frau, die ihrem Mann vergeblich vor dieser Elektrobastelei gewarnt hatte, aus dem Stall gekommen und sah das Unglück. Schnell entschlossen zog sie, die Ursache erkennend, den Stecker der elektrischen Leitung aus der Dose und näherte sich den auf der Wiese liegenden Geschöpfen. Da schlug der Bauer langsam wieder seine Augen auf. Allmählich erholte er sich von seiner Bewußtlosigkeit, blickte um sich und sah das Ergebnis seiner Sparsamkeit: zwei tote Kühe!
Zu seiner Frau aber sagte er: „Rosa, i glaub, meine Gommistiefel, dia du mir zum Namenstag gschenkt hast, hand mir’s Leba grettat.“
Wenn man den Wert einer Kuh in der damaligen Zeit bedenkt – das Fleisch konnte nur noch für einen Spottpreis auf der Freibank verkauft werden – hatte sich das Sprichwort wieder einmal bewahrheitet: „Jeder Sparer hat seinen Zehrer.“ Die Bauernbuben vom Dorf aber dichteten:
Salomon der Weise spricht:
Kühe hüten mag ich nicht!
Darum muß der Starkstrom her,
und gescheh’n ist das Malheur:
Ja, die Kuh lag schon am Boden,
er muß den Metzger Gottfried holen.
Damit war bei meinem Onkel die moderne Technik vorerst gestoppt und ich konnte als Hütebub wieder ein paar Mark verdienen.
*) Bayerische Warenhandelsgesellschaft, seit 1923, ursprünglich nur für Waren und Zubehör für die Landwirtschaft.
„Büable, morga nachmittag brauscht nit Küah hüata, denn bis dau na han i mein elektrischa Zau fertig“, rief mir mein Onkel, freudig erregt entgegen, als ich mittags, von der Schule kommend, an seinem Bauernhof vorbeilief.
Das war mit gerade recht, so konnte ich mit meinen Freunden am Kammelwehr zum Baden gehen. Mein Onkel hatte eine kleine Landwirtschaft, und in den Sommermonaten hütete ich seine Kühe gegen ein willkommenes Trinkgeld öfters auf der Weide. Es war in den 50er Jahren, als in meiner Heimat die ersten elektrischen Weidezäune aufkamen. Zu einer solchen Anlage gehörten spezielle Batterien, das entsprechende Gerät für die Umwandlung des Batteriestroms in deutliche spürbare Stromschläge, Draht für die Stromleitung um die Wiese und Pfähle oder eiserne Pflöcke mit isolierten Drahthaltern. Natürlich war das alles nicht ganz billig, so daß die Anschaffung für einen sparsamen schwäbischen Bauern mit einigen inneren Widerständen verbunden war.
Mein Onkel, der bekannt für seine Basteleien war, hatte sich bei der BayWa*) die neue Erfindung angeschaut und nach kurzem Überlegen entschlossen, den Elektrozaun selbst nachzubauen. „Dös wär ja no schöner, wenn i dös net nabringa dät“, sagte er zu seiner Frau, „onsra Wiesn isch ja glei henterm Stall, do brauch i doch koi duira Batterie kaufa, wenn i da Strom glei aus der Steckdos von der Melkkammer nemma ka.“
Gesagt, getan! In die Pfähle des alten Stacheldrahtzaunes drehte er vorschriftsmäßig Stifte mit isolierten Haken und zog einen dünnen Draht, diesen um die Stifte wickelnd, von Pfahl zu Pfahl um die Wiese. Für die letzten 20 Meter von der Wiese über den Hof bis zur Melkkammer verwendete er eine isolierte Leitung, weil ja diese, auf dem Boden liegend, sonst den Strom ins Erdreich abgeleitet hätte. Er klemmte die Drahtenden in einen Stecker und drückte ihn in die Steckdose. Der Weidedraht stand unter Strom!
Da er sich schon dachte, daß der Haushaltsstrom etwas stärker sein könnte als der offizielle Batteriestrom, versäumte er nicht, an der Seite zum Nachbargrundstück noch ein Schild mit der Aufschrift „Vorsicht – Elektrozaun – Lebensgefahr!“ an einen Pfahl zu hängen.
„Rosa, laß die Küah raus, dr Zau isch fertig!“, rief er seiner Frau im Stall zu.
Diese öffnete die Tür und schnell eilten die hungrigen Kühe nach der abendlichen Melkzeit der Wiese zu. Der Bauer schloß die Stangen zum Wieseneingang und blickte stolz und erwartungsvoll auf sein Werk.
Inzwischen erreichte die erste Kuh den Zaun. Sie streckte den Kopf unter dem Elektrodraht zu den saftigen Grasbüscheln der Nachbarwiese und berührte mit dem Nacken den geladenen Draht. Wie vom Blitz getroffen fiel sie um, wobei sich der Draht im Gehörn verfing. Eine zweite Kuh, erstaunt über die im Gras liegende Genossin, schnupperte neugierig an dieser, berührte sie kurz mit ihrem Maul und wurde schlagartig, wild mit den ausgestreckten Beinen zuckend, umgeworfen.
Der Bauer starrte zunächst wie gelähmt auf die Geschehnisse, sprang dann auf die Wiese, um die regungslos am Boden liegenden Kühe vom Zaun wegzuziehen. Er packte den Kopf der zweiten Kuh, der auf dem Bauch der ersten lag, und – stürzte augenblicklich ebenfalls zu Boden, wo er bewußtlos liegenblieb.
Inzwischen war auch seine Frau, die ihrem Mann vergeblich vor dieser Elektrobastelei gewarnt hatte, aus dem Stall gekommen und sah das Unglück. Schnell entschlossen zog sie, die Ursache erkennend, den Stecker der elektrischen Leitung aus der Dose und näherte sich den auf der Wiese liegenden Geschöpfen. Da schlug der Bauer langsam wieder seine Augen auf. Allmählich erholte er sich von seiner Bewußtlosigkeit, blickte um sich und sah das Ergebnis seiner Sparsamkeit: zwei tote Kühe!
Zu seiner Frau aber sagte er: „Rosa, i glaub, meine Gommistiefel, dia du mir zum Namenstag gschenkt hast, hand mir’s Leba grettat.“
Wenn man den Wert einer Kuh in der damaligen Zeit bedenkt – das Fleisch konnte nur noch für einen Spottpreis auf der Freibank verkauft werden – hatte sich das Sprichwort wieder einmal bewahrheitet: „Jeder Sparer hat seinen Zehrer.“ Die Bauernbuben vom Dorf aber dichteten:
Salomon der Weise spricht:
Kühe hüten mag ich nicht!
Darum muß der Starkstrom her,
und gescheh’n ist das Malheur:
Ja, die Kuh lag schon am Boden,
er muß den Metzger Gottfried holen.
Damit war bei meinem Onkel die moderne Technik vorerst gestoppt und ich konnte als Hütebub wieder ein paar Mark verdienen.
*) Bayerische Warenhandelsgesellschaft, seit 1923, ursprünglich nur für Waren und Zubehör für die Landwirtschaft.

1951 - ein aufregendes Jahr
Geschichte aus "Halbstark und tüchtig"
Geschichte von Liselotte Kubitza
Berlin –Kühlungsborn/Ostsee, Mecklenburg-Vorpommern
Juli–September 1951 l Geschichte als PDF-Datei »
Kurz vor unserer Lehrabschlußprüfung als Sozialversicherungskaufmann stehend, galt es für meine Zwillingsschwester Ursel und mich, viel zu lernen, um mit sehr gutem Ergebnis abzuschließen. Außerdem waren wir als Jugendliche unseres Verwaltungsbetriebes, der Versicherungsanstalt Berlin (VAB) im Chor und in der Volkstanzgruppe sehr aktiv. Singen und tanzen bereitete uns trotz des enormen Zeiteinsatzes großen Spaß.
Für die III. Weltfestspiele der Jugend und Studenten im August 1951 in Berlin mußten viele Lieder und Volkstänze aus unterschiedlichen Landesteilen einstudiert werden. Ursel und ich hatten den Vorteil, nach Feierabend zu Hause weiter gemeinsam üben zu können. Wir entwarfen Kostüme und kauften Stoffe ein. Nach mehreren Anproben saßen die Kleidungsstücke perfekt. Aus heutiger Sicht waren die Kostüme einfach, doch für die Nachkriegszeit waren sie etwas Besonderes. Ein Teil der Mädchen trug rote, weite Röcke, der andere blaue, komplettiert mit einer weißen kurzärmligen Bluse mit Puffärmeln und Rüschen am Halsausschnitt.
In der restlichen knappen Freizeit – wir arbeiteten damals bis Samstagmittag – halfen wir unentgeltlich und mit Hunger im Bauch bei der Trümmerbeseitigung, denn unsere Stadt sollte zum Empfang der internationalen Gäste ein ordentliches Bild bieten. Auch beim Einrichten der Schlafgelegenheiten für die Jugendlichen aus nah und fern in Schulen und Turnhallen sowie auf Dachböden packten wir kräftig mit an. Unser Fleiß wurde belohnt. Ursel und ich gehörten zu jenen, die als Festbekleidung neben dem üblichen dunkelblauen Rock sowie einer Bluse und Jacke ein Paar der begehrten schwarzen Lederschuhe guter Qualität gratis erhielten. Das war für längere Zeit unsere Rettung; denn nach drei Jahren Lehrzeit mit einem monatlichen Entgelt von netto 54 bis 108 Mark war unsere finanzielle Lage als Halbwaisen äußerst miserabel. Unsere wenigen Kleidungsstücke hatten wir zudem bei den zahlreichen ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen auf Trümmern und in Schulen abgenutzt.
Während der Weltfestspiele waren wir ständig im Einsatz. Als solide, fleißige und saubere Mädchen waren wir dafür ausgesucht worden und von unserer Arbeit für 14 Tage freigestellt. Unter anderem servierten wir im großen festlichen Friedenssaal unserer Hauptverwaltung in der Rungestraße im Stadtbezirk Berlin-Mitte ausländischen Delegationen das Essen. Das bedeutete für uns eine besondere Ehre. Zwei Wochen kamen wir nicht nach Hause, so viel gab es zu tun. Nachts schliefen wir auf aufgeschüttetem Stroh in der großen Halle unserer Verwaltung.
Nachdem das aufregende Ereignis vorüber war, sollte für uns der Ernst des Lebens, die Verwaltungsarbeit als Sozialversicherungskaufmann in der von uns selbst ausgewählten interessanten Rentenabteilung, beginnen. Gerade 18 Jahre alt und somit volljährig, hatten wir das große Glück, von der Betriebsgewerkschaftsleitung einen der begehrten FDGB-Reiseschecks zu bekommen: vierzehn Tage Urlaub in Kühlungsborn an der Ostsee! Niemals zuvor waren wir dort hingekommen, ein verlockendes Angebot!
Nach der ersten Freude lehnten wir die Annahme dankend ab. Obwohl der Scheck nur 30 Mark kostete und die für Gewerkschafter ermäßigte Fahrkarte eigentlich erschwinglich war, konnten wir das Geld nicht aufbringen. Außerdem besaßen wir keine Reisegarderobe. Die Finanzlage unserer Mutter war genauso schlecht, sie konnte uns keinen Zuschuß geben. Die Kollegen der Betriebsgewerkschaftsleitung waren sehr nett und rieten uns, nach den Anstrengungen und Leistungen in diesem Jahr die Reise auf jeden Fall anzutreten. Wir waren körperlich mitgenommen, hatten erhebliches Untergewicht und eine Erholung dringend nötig. Nach langem Überlegen kamen wir zu dem Ergebnis, mit unserem ersten vollen Gehalt von netto 290 Mark abzüglich der Investition in einen Badeanzug leidlich auskommen zu können.
Berlin –Kühlungsborn/Ostsee, Mecklenburg-Vorpommern
Juli–September 1951 l Geschichte als PDF-Datei »
Kurz vor unserer Lehrabschlußprüfung als Sozialversicherungskaufmann stehend, galt es für meine Zwillingsschwester Ursel und mich, viel zu lernen, um mit sehr gutem Ergebnis abzuschließen. Außerdem waren wir als Jugendliche unseres Verwaltungsbetriebes, der Versicherungsanstalt Berlin (VAB) im Chor und in der Volkstanzgruppe sehr aktiv. Singen und tanzen bereitete uns trotz des enormen Zeiteinsatzes großen Spaß.
Für die III. Weltfestspiele der Jugend und Studenten im August 1951 in Berlin mußten viele Lieder und Volkstänze aus unterschiedlichen Landesteilen einstudiert werden. Ursel und ich hatten den Vorteil, nach Feierabend zu Hause weiter gemeinsam üben zu können. Wir entwarfen Kostüme und kauften Stoffe ein. Nach mehreren Anproben saßen die Kleidungsstücke perfekt. Aus heutiger Sicht waren die Kostüme einfach, doch für die Nachkriegszeit waren sie etwas Besonderes. Ein Teil der Mädchen trug rote, weite Röcke, der andere blaue, komplettiert mit einer weißen kurzärmligen Bluse mit Puffärmeln und Rüschen am Halsausschnitt.
In der restlichen knappen Freizeit – wir arbeiteten damals bis Samstagmittag – halfen wir unentgeltlich und mit Hunger im Bauch bei der Trümmerbeseitigung, denn unsere Stadt sollte zum Empfang der internationalen Gäste ein ordentliches Bild bieten. Auch beim Einrichten der Schlafgelegenheiten für die Jugendlichen aus nah und fern in Schulen und Turnhallen sowie auf Dachböden packten wir kräftig mit an. Unser Fleiß wurde belohnt. Ursel und ich gehörten zu jenen, die als Festbekleidung neben dem üblichen dunkelblauen Rock sowie einer Bluse und Jacke ein Paar der begehrten schwarzen Lederschuhe guter Qualität gratis erhielten. Das war für längere Zeit unsere Rettung; denn nach drei Jahren Lehrzeit mit einem monatlichen Entgelt von netto 54 bis 108 Mark war unsere finanzielle Lage als Halbwaisen äußerst miserabel. Unsere wenigen Kleidungsstücke hatten wir zudem bei den zahlreichen ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen auf Trümmern und in Schulen abgenutzt.
Während der Weltfestspiele waren wir ständig im Einsatz. Als solide, fleißige und saubere Mädchen waren wir dafür ausgesucht worden und von unserer Arbeit für 14 Tage freigestellt. Unter anderem servierten wir im großen festlichen Friedenssaal unserer Hauptverwaltung in der Rungestraße im Stadtbezirk Berlin-Mitte ausländischen Delegationen das Essen. Das bedeutete für uns eine besondere Ehre. Zwei Wochen kamen wir nicht nach Hause, so viel gab es zu tun. Nachts schliefen wir auf aufgeschüttetem Stroh in der großen Halle unserer Verwaltung.
Nachdem das aufregende Ereignis vorüber war, sollte für uns der Ernst des Lebens, die Verwaltungsarbeit als Sozialversicherungskaufmann in der von uns selbst ausgewählten interessanten Rentenabteilung, beginnen. Gerade 18 Jahre alt und somit volljährig, hatten wir das große Glück, von der Betriebsgewerkschaftsleitung einen der begehrten FDGB-Reiseschecks zu bekommen: vierzehn Tage Urlaub in Kühlungsborn an der Ostsee! Niemals zuvor waren wir dort hingekommen, ein verlockendes Angebot!
Nach der ersten Freude lehnten wir die Annahme dankend ab. Obwohl der Scheck nur 30 Mark kostete und die für Gewerkschafter ermäßigte Fahrkarte eigentlich erschwinglich war, konnten wir das Geld nicht aufbringen. Außerdem besaßen wir keine Reisegarderobe. Die Finanzlage unserer Mutter war genauso schlecht, sie konnte uns keinen Zuschuß geben. Die Kollegen der Betriebsgewerkschaftsleitung waren sehr nett und rieten uns, nach den Anstrengungen und Leistungen in diesem Jahr die Reise auf jeden Fall anzutreten. Wir waren körperlich mitgenommen, hatten erhebliches Untergewicht und eine Erholung dringend nötig. Nach langem Überlegen kamen wir zu dem Ergebnis, mit unserem ersten vollen Gehalt von netto 290 Mark abzüglich der Investition in einen Badeanzug leidlich auskommen zu können.

Meine Zwillingsschwester Ursel und ich in unseren neuen
blauen Badeanzügen. Schlanksein war seinerzeit kein Problem.
So reisten wir am 30. August 1951 mit den schwarzen
Lederschuhen und ansonsten bescheidener, alter Kleidung aufgeregt in Richtung
Ostsee, im Gepäck unsere neuen blauen Badeanzüge. Wie in unseren Kindertagen
hatten wir den großen schwarzen Koffer dabei, nur, daß wir jetzt erwachsen
waren. Das Wetter war uns hold. Wie schön! Die Eindrücke überwältigten uns.
Niemals werde ich den ersten Anblick der Ostsee bei Sonnenschein vergessen. Wir
spazierten durch den hübschen, sauberen Ferienort, gingen einen abwärts
führenden Weg entlang, und plötzlich lag vor uns die See, wie im Bilderbuch,
tiefblau mit weißen Schaumkronen auf den Wellen. Dazu das Meeresrauschen –
aufwühlend und beruhigend zugleich. Einzigartig wirkten auf uns, die wir aus
der grauen Berliner Trümmerlandschaft kamen, die Farben des Himmels, des
Wassers und des Strandes, der grünen Kiefern und der bunten Strandkörbe.
Einfach phantastisch!
Mit großem Interesse beobachteten wir den hotelähnlichen Tagesbetrieb im FDGB-Heim. Für abendliche Restaurantbesuche hatten wir weder das Geld noch die Garderobe. Die mäßigen Mahlzeiten im Heim mußten ausreichen. Ansonsten ließen wir die Seele baumeln und genossen überglücklich die sonnigen, unbeschwerten Tage.
Einmal fand im Dorf ein eintrittsfreier Tanzabend statt, bei dem wir uns die ganze Zeit mit einer Brause begnügten und uns dennoch toll amüsierten. Wir tanzten gerne und gut. Meine Schwester machte die Bekanntschaft eines jungen Mannes, der sie bis zum Urlaubsende nicht mehr aus den Augen ließ. Ich war stets dabei, lief nebenher. Anscheinend störte das den jungen Mann nicht, für ihn erhöhte sich wohl eher der Reiz durch unsere Ähnlichkeit. An den noch warmen Abenden saßen wir zu dritt im Strandkorb und bliesen Melodien auf dem Kamm.
Als wir gut erholt und braungebrannt wieder daheim waren, schwärmten wir vor unserer Mutter und den Kollegen noch lange von den unvergeßlichen Urlaubseindrücken und gingen mit frischem Elan an die Arbeit. Es sollten noch viele Ostseereisen folgen, so daß wir die Ostsee später als unsere zweite Heimat bezeichneten.
Mit großem Interesse beobachteten wir den hotelähnlichen Tagesbetrieb im FDGB-Heim. Für abendliche Restaurantbesuche hatten wir weder das Geld noch die Garderobe. Die mäßigen Mahlzeiten im Heim mußten ausreichen. Ansonsten ließen wir die Seele baumeln und genossen überglücklich die sonnigen, unbeschwerten Tage.
Einmal fand im Dorf ein eintrittsfreier Tanzabend statt, bei dem wir uns die ganze Zeit mit einer Brause begnügten und uns dennoch toll amüsierten. Wir tanzten gerne und gut. Meine Schwester machte die Bekanntschaft eines jungen Mannes, der sie bis zum Urlaubsende nicht mehr aus den Augen ließ. Ich war stets dabei, lief nebenher. Anscheinend störte das den jungen Mann nicht, für ihn erhöhte sich wohl eher der Reiz durch unsere Ähnlichkeit. An den noch warmen Abenden saßen wir zu dritt im Strandkorb und bliesen Melodien auf dem Kamm.
Als wir gut erholt und braungebrannt wieder daheim waren, schwärmten wir vor unserer Mutter und den Kollegen noch lange von den unvergeßlichen Urlaubseindrücken und gingen mit frischem Elan an die Arbeit. Es sollten noch viele Ostseereisen folgen, so daß wir die Ostsee später als unsere zweite Heimat bezeichneten.

Im Ostseebad Kühlungsborn verbrachten Ursel und ich 1951
einen unvergeßlichen Urlaub. Wir wohnten im FDGB-Heim „Jochen Weigert“.
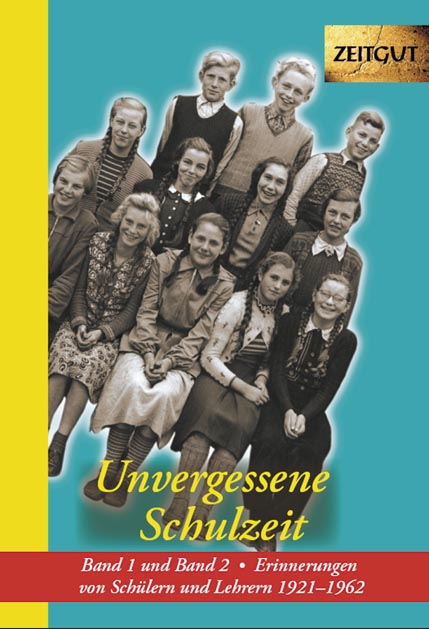 Unvergessene Schulzeit. Doppelband
Unvergessene Schulzeit. Doppelband Zusammengestellt aus Band 1 und Band 2
Drei Geschichten:
Himbeerbrause im Speisewagen
Schulwanderung
Ein schlechtes Zeugnis
Zum Shop »
 Unvergessene Schulzeit. Band 3
Unvergessene Schulzeit. Band 3