Lieferbar als gebundene Ausgabe und als Taschenbuch-Ausgabe.


Unvergessene Weihnachten. Band 13
31 besinnliche und heitere Zeitzeugen-Erinnerungen, 1924-2017
192 Seiten mit vielen Abbildungen, Ortsregister, Zeitgut Verlag, Berlin.
Gebundene Ausgabe mit Lesebändchen
ISBN: 978-3-86614-276-3, EURO 11,90
Taschenbuch-Ausgabe
ISBN: 978-3-86614-275-6, EURO 8,90
Cover downloaden:
Gebundene Ausgabe »
Taschenbuch Ausgabe »
31 besinnliche und heitere Zeitzeugen-Erinnerungen, 1924-2017
192 Seiten mit vielen Abbildungen, Ortsregister, Zeitgut Verlag, Berlin.
Gebundene Ausgabe mit Lesebändchen
ISBN: 978-3-86614-276-3, EURO 11,90
Taschenbuch-Ausgabe
ISBN: 978-3-86614-275-6, EURO 8,90
Cover downloaden:
Gebundene Ausgabe »
Taschenbuch Ausgabe »
Weitere Weihnachtsgeschichten aus den Bänden 1-12 der Reihe "Unvergessene Weihnachten" finden Sie hier: Weitere Abdrucktexte »
Unvergessene Weihnachten. Band 13
Lese- und Downloadbereich
Pressetext 2.862 Zeichen (PDF) »
Pressetext 2.862 Zeichen (Word) »
Texte aus dem Buch zum kostenfreien Abdruck »
Coverabbildung-TB (jpg, 300 dpi, CMYK-Modus »
Coverabbildung gebunden (jpg, 300 dpi, CMYK) »
Bei der Veröffentlichung einer Buchrezension oder einer Verlosung bitten wir Sie, mindestens einen kurzen Text zum Buch und eine minimal 30 mm breite Coverabbildung mit diesen bibliographischen Daten abzudrucken:
Unvergessene Weihnachten. Band 13
31 besinnliche und heitere Zeitzeugen-Erinnerungen
192 Seiten mit vielen Abbildungen,
Zeitgut Verlag, Berlin. www.zeitgut.com
Taschenbuch ISBN: 978-3-86614-275-6, EURO 8,90
Gebunden ISBN: 978-3-86614-276-3, EURO 11,90
Für technische Probleme oder Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Lydia Beier, Öffentlichkeitsarbeit
Zeitgut Verlag GmbH, Berlin
E-Mail: lydia.beier@zeitgut.com
Tel. 030 - 70 20 93 14
Pressetext 2.862 Zeichen (Word) »
Texte aus dem Buch zum kostenfreien Abdruck »
Coverabbildung-TB (jpg, 300 dpi, CMYK-Modus »
Coverabbildung gebunden (jpg, 300 dpi, CMYK) »
Bei der Veröffentlichung einer Buchrezension oder einer Verlosung bitten wir Sie, mindestens einen kurzen Text zum Buch und eine minimal 30 mm breite Coverabbildung mit diesen bibliographischen Daten abzudrucken:
Unvergessene Weihnachten. Band 13
31 besinnliche und heitere Zeitzeugen-Erinnerungen
192 Seiten mit vielen Abbildungen,
Zeitgut Verlag, Berlin. www.zeitgut.com
Taschenbuch ISBN: 978-3-86614-275-6, EURO 8,90
Gebunden ISBN: 978-3-86614-276-3, EURO 11,90
Für technische Probleme oder Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Lydia Beier, Öffentlichkeitsarbeit
Zeitgut Verlag GmbH, Berlin
E-Mail: lydia.beier@zeitgut.com
Tel. 030 - 70 20 93 14
Sechs kostenfreie Abdrucktexte
Alle Texte und Abbildungen können Sie downloaden und kostenfrei bis zum 14. Dezember veröffentlichen. Wir erwarten von Ihnen lediglich den Abdruck des Quellen-Hinweises mit den bibliografischen Daten am Ende des Textes sowie den Abdruck eines minimal 30 Millimeter breiten Buchcovers.
Wir freuen uns auch, wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine unserer Weihnachtsgeschichten veröffentlichen möchten. Dann bitten wir Sie allerdings zusätzlich um die Vorstellung eines Bandes der Reihe Unvergessene Weihnachten in Form eines Buchtipps, vor dem 14. Dezember. Beim Buchtipp bitten wir wenigstens die oben genannten bibliographische Daten sowie die Abbildung des Buchcovers zu veröffentlichen.
Bitte schicken Sie uns in jedem Fall ein Beleg.
Wir freuen uns auch, wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine unserer Weihnachtsgeschichten veröffentlichen möchten. Dann bitten wir Sie allerdings zusätzlich um die Vorstellung eines Bandes der Reihe Unvergessene Weihnachten in Form eines Buchtipps, vor dem 14. Dezember. Beim Buchtipp bitten wir wenigstens die oben genannten bibliographische Daten sowie die Abbildung des Buchcovers zu veröffentlichen.
Bitte schicken Sie uns in jedem Fall ein Beleg.
„Komm, Puter! Komm, Puter!“
(3.543 Zeichen)
Hans Birwe
Essen, Ruhrgebiet; 1940
Es war kurz vor Weihnachten 1940, als mein Vater von seinem Bruder Alois angerufen wurde. Alois war Abteilungsleiter in einem großen Kaufhaus in Essen. Er fragte Vater, ob er schon einen Weihnachtsbraten hätte. Die Frage konnte Vater ihm nicht beantworten, weil die Beschaffung unserer Nahrungsmittel Mutters Spezialaufgabe war. Neugierig geworden fragte er seinen Bruder, was er ihm denn Besonderes anbieten könnte. „Wir haben in unserer Lebensmittelabteilung gerade Puter hereinbekommen. Wenn du dich schnell entscheidest, kann ich für euch einen reservieren lassen.“
„Was ist Puter?“, fragte Vater – damals war Puterfleisch bei uns kaum verbreitet –, worauf Alois ihm erklärte, daß es sich um einen Truthahn handeln würde. Der hätte siebenerlei Fleisch, das hätte Oma Katharina, beider Mutter, ihm einmal gesagt.
In der Mittagspause fragte Vater unsere Mutter, ob sie als Weihnachtsbraten zur Abwechslung mal einen Puter zubereiten könnte. Spontan folgte ihre Frage, was ein Puter sei.
Vater, durch Onkel Alois aufgeklärt, zeigte sich überrascht, daß sie das nicht wisse und erklärte: „Das ist ein Truthahn, der hat siebenerlei Fleisch!“
„Woher weißt du das?“, kam die nächste Frage, worauf Vater prompt erwähnte, das habe ihm seine Mutter einmal gesagt.
„Na gut, dann kaufe ihn, ich habe noch kein anderes Fleisch für Weihnachten eingeplant. Aber ich habe eine Bedingung: Von der Pute bekomme ich die Koteletts.“
„Meinetwegen“, sagte Vater, „ich nehme die Steaks und die Jungen“ – damit waren mein Bruder Manfred und ich gemeint – „können sich ja an den Schinken erfreuen.“
Weil besonders wir Kinder keine rechte Vorstellung von Truthähnen oder Puten hatten, erzählte Vater, die hätten ganz lange Schwänze, woraufhin Mutter die Nase rümpfte und meinte, er solle uns Kindern keine Schweinereien erzählen. Daraufhin korrigierte Vater sich und sagte, das seien keine richtigen Schwänze, sondern Federn, die die Puter weit hinter sich herziehen würden. Die männlichen Truthähne würden auch Pfauen genannt, sie könnten mit ihren Schwanzfedern ein großes Rad schlagen, woraufhin Mutter sich einschaltete und scherzhaft meinte: „Jetzt erzähle den Jungen nur noch, die könnten auch radfahren.“
Um uns Kindern eine Freude zu machen, schlug Vater vor, am Sonntag die Krupp’sche Vogelwarte zu besuchen, dort könnten wir lebende Puter sehen.
Tatsächlich konnten wir dort mehrere prächtige Puten und Truthähne bestaunen. Besonders die Hähne hatten wunderschöne lange Schwanzfedern. Wenn sie gut gelaunt waren, richteten sie diese Federn nach oben und zeigten sich in aller Schönheit mit einem riesigen Rad. Vater meinte, damit wollen sie ihren Putendamen imponieren. Irgendwie taten uns Jungen die Putendamen leid, weil sie nicht so schön aussahen. Deshalb versuchten wir, sie mit Haferflocken, die wir mitgebracht hatten, zu füttern. Wir riefen immer wieder: „Komm Puter, komm Puter!“, bis sie sich schließlich ihr Futter bei uns abholten.
Der Weihnachtsputer hat uns sehr gut geschmeckt, auch wenn er keine Koteletts, Steaks oder Schinken, sondern dafür zartes Geflügelfleisch hatte.
Hans Birwe
Essen, Ruhrgebiet; 1940
Es war kurz vor Weihnachten 1940, als mein Vater von seinem Bruder Alois angerufen wurde. Alois war Abteilungsleiter in einem großen Kaufhaus in Essen. Er fragte Vater, ob er schon einen Weihnachtsbraten hätte. Die Frage konnte Vater ihm nicht beantworten, weil die Beschaffung unserer Nahrungsmittel Mutters Spezialaufgabe war. Neugierig geworden fragte er seinen Bruder, was er ihm denn Besonderes anbieten könnte. „Wir haben in unserer Lebensmittelabteilung gerade Puter hereinbekommen. Wenn du dich schnell entscheidest, kann ich für euch einen reservieren lassen.“
„Was ist Puter?“, fragte Vater – damals war Puterfleisch bei uns kaum verbreitet –, worauf Alois ihm erklärte, daß es sich um einen Truthahn handeln würde. Der hätte siebenerlei Fleisch, das hätte Oma Katharina, beider Mutter, ihm einmal gesagt.
In der Mittagspause fragte Vater unsere Mutter, ob sie als Weihnachtsbraten zur Abwechslung mal einen Puter zubereiten könnte. Spontan folgte ihre Frage, was ein Puter sei.
Vater, durch Onkel Alois aufgeklärt, zeigte sich überrascht, daß sie das nicht wisse und erklärte: „Das ist ein Truthahn, der hat siebenerlei Fleisch!“
„Woher weißt du das?“, kam die nächste Frage, worauf Vater prompt erwähnte, das habe ihm seine Mutter einmal gesagt.
„Na gut, dann kaufe ihn, ich habe noch kein anderes Fleisch für Weihnachten eingeplant. Aber ich habe eine Bedingung: Von der Pute bekomme ich die Koteletts.“
„Meinetwegen“, sagte Vater, „ich nehme die Steaks und die Jungen“ – damit waren mein Bruder Manfred und ich gemeint – „können sich ja an den Schinken erfreuen.“
Weil besonders wir Kinder keine rechte Vorstellung von Truthähnen oder Puten hatten, erzählte Vater, die hätten ganz lange Schwänze, woraufhin Mutter die Nase rümpfte und meinte, er solle uns Kindern keine Schweinereien erzählen. Daraufhin korrigierte Vater sich und sagte, das seien keine richtigen Schwänze, sondern Federn, die die Puter weit hinter sich herziehen würden. Die männlichen Truthähne würden auch Pfauen genannt, sie könnten mit ihren Schwanzfedern ein großes Rad schlagen, woraufhin Mutter sich einschaltete und scherzhaft meinte: „Jetzt erzähle den Jungen nur noch, die könnten auch radfahren.“
Um uns Kindern eine Freude zu machen, schlug Vater vor, am Sonntag die Krupp’sche Vogelwarte zu besuchen, dort könnten wir lebende Puter sehen.
Tatsächlich konnten wir dort mehrere prächtige Puten und Truthähne bestaunen. Besonders die Hähne hatten wunderschöne lange Schwanzfedern. Wenn sie gut gelaunt waren, richteten sie diese Federn nach oben und zeigten sich in aller Schönheit mit einem riesigen Rad. Vater meinte, damit wollen sie ihren Putendamen imponieren. Irgendwie taten uns Jungen die Putendamen leid, weil sie nicht so schön aussahen. Deshalb versuchten wir, sie mit Haferflocken, die wir mitgebracht hatten, zu füttern. Wir riefen immer wieder: „Komm Puter, komm Puter!“, bis sie sich schließlich ihr Futter bei uns abholten.
Der Weihnachtsputer hat uns sehr gut geschmeckt, auch wenn er keine Koteletts, Steaks oder Schinken, sondern dafür zartes Geflügelfleisch hatte.

Kindheitsidylle
1937 in Essen: Mein Bruder Manfred, links, und ich, rechts, mit Freund Heinz in
der Mitte.
Später
habe ich mir oft Gedanken darüber gemacht, woher wohl der Name Computer kommen
mag. Bis mir einfiel, bestimmt hat damals, als wir die Truthähne in der
Vogelwarte riefen: „Komm, Puter!“, um sie mit Haferflocken zu füttern, jemand
zugehört. Das hat ihm so gut gefallen, daß er den modernen Geräten, die jetzt
in aller Welt verbreitet sind, den Namen Computer gegeben hat. Ja, so könnte es
gewesen sein.
Foto downloaden »
PDF downloaden »
Foto downloaden »
PDF downloaden »

Heiligabend 1944 im besetzten Belgien: Wehrmachtssoldaten basteln mit einem kleinen belgischen Mädchen Strohsterne. Skizze/Zeichnung: Friede Metzner.
Der
Weihnachtsstern von Bastogne (7.463 Zeichen)
Christian Metzner
Spaichingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg; 1996; Bastogne, Ardennen, Belgien; Heiligabend 1944
Meine Zeit als Referendar war nur vorübergehend, die Erinnerung an eine Unterrichtsstunde blieb. Im Dezember 1996 unterrichtete ich am Gymnasium in Spaichingen eine 10. Klasse in Geschichte. Die Epoche hätte unweihnachtlicher nicht sein können – der Zweite Weltkrieg. Die hellflackernden Kerzen am Adventskranz bildeten einen völligen Gegensatz zu den grausamen Bildern und Filmen über diese Zeit. Zum Abschluß hatte ich einen Zeitzeugen in der Hoffnung eingeladen, er könnte den Schülern Antworten geben, die ich nicht geben konnte. Er war seinerzeit Mitte siebzig, zeigte sich erfreut über die Einladung, und als er zu uns kam, hatte er seinen besten Anzug angezogen.
Wir schoben die Tische an die Wand und setzten uns in einen Kreis, das Gespräch sollte ungezwungen sein. Da saß er nun, der Mann, der das alles miterlebt hatte und Fragen beantworten sollte. Alt war er, aber nicht müde. Er erzählte, wie er seinen Einberufungsbescheid zur Wehrmacht bekommen hatte, wie er nach einer kurzen Ausbildung an die Ostfront kam und kurz darauf an die Westfront versetzt wurde, das war im Herbst 1944. Er mußte an der Ardennenoffensive teilnehmen, sie begann am 16. Dezember. Schon war er dabei, das Leben an der Front zu beschreiben, da unterbrach ihn eine Schülerin unvermittelt und fragte: „Wo waren Sie an Heiligabend?“
Kurz stockte der Mann und es schien, als hätte ihn die Frage überrascht. Für einen Moment schloß er die Augen. Die Klasse wartete und er begann eine Geschichte zu erzählen, die ich nie vergessen habe:
„Den Heiligabend des Jahres 1944 verbrachten wir in der Nähe der belgischen Stadt Bastogne und keinem von uns war zum Feiern zumute. Tagelang hatten wir in heftigen Kämpfen dichten und tiefverschneiten Wald durchquert, manchmal bei minus zwanzig Grad. Wir waren erschöpft und ausgemergelt. Aber wir hatten das Glück, zumindest den Heiligabend nicht draußen in der nahegelegenen Feuerstellung verbringen zu müssen. Für wenige Stunden konnten wir uns ausruhen und wärmen. Wir stießen auf einen größeren Kellerraum eines teilweise zerstörten Bauernhofs.
Seit Mitte Dezember befanden wir uns auf dem Vormarsch der Ardennenoffensive, waren aber kurz vor Bastogne zum Stehen gekommen. Die dort eingeschlossenen US-amerikanischen Kräfte wehrten sich beharrlich. Pausenlos wurde geschossen. Die Hoffnung, noch einmal heil aus diesem Inferno zu kommen, hatte kaum einer von uns an dem Fest, das doch wie kein anderes für die Hoffnung stand. Für viele war es das letzte Weihnachten, und sie ahnten es.
In unserem Abschnitt war am 24. Dezember nicht viel los, aber das Geknatter von Maschinengewehren und das Detonieren von Granaten riß die ganze Nacht nicht ab. Der Raum wirkte leer und war halbdunkel, es war uns gleichgültig. Einer nach dem anderen stolperte herein, Mannschaften, Unteroffiziere und Offiziere, es gab keinen Unterschied mehr. Die Kämpfe der letzten zwei Wochen hatten ihre Spuren in unseren Gesichtern und an den Uniformen hinterlassen. Seit vielen Tagen waren wir nicht mehr aus unserer Kleidung herausgekommen. Schweiß hatte die kratzigen Holzfasern unserer Unterwäsche geschmeidig gemacht, und wir spürten sie schon lange nicht mehr. Wir hatten uns nichts mehr zu erzählen, das ununterbrochene Zusammensein in den zurückliegenden Wochen hatte nichts mehr übriggelassen.
Gewehre wurden akkurat an die Wand gelehnt, Patronengurte und Helme wurden abgenommen und davor gelegt, korrekt nebeneinander, ordentlich, militärisch, wie wir es gewohnt waren. Wir siezten uns und wir duzten uns durcheinander, wir machten ein Feuer in einem alten Ofen. Alle waren wir erleichtert, zum ersten Mal seit zwei Wochen wieder ein wärmendes Dach über dem Kopf zu haben. Alles nutzten wir als Sitzgelegenheit: einen umgedrehten Blecheimer, einen Stapel Holz, ein ramponiertes Feldbett. Niemand sprach.
Ein zerknülltes Päckchen Zigaretten machte die Runde, nach und nach entflammten Streichhölzer und beleuchteten beim Anzünden die unrasierten hohlwangigen Gesichter, selbst die jüngeren unter uns sahen zerfurcht aus. Mancher dachte an Heiligabend in der Heimat, schloß die Augen und sah seine Frau und seine Kinder, wie sie die Kerzen am Weihnachtsbaum anzündeten. Wir alle wollten für heute nichts mehr sehen und nichts mehr hören.
Die quietschende Kellertür unterbrach unseren Dämmerschlaf. Es war die Langsamkeit und Vorsichtigkeit, mit der sie aufgemacht wurde, die uns aufschrecken ließ. Alarmiert sprangen wir auf, einer stülpte sich seinen Helm über, andere luden ihre Pistole, einen Karabiner und eine Maschinenpistole durch. Längst war das für jeden von uns Routine. Wir trauten unseren Augen kaum: In der Tür stand ein kleines Mädchen, eingepackt in ein zugeknöpftes Mäntelchen. Es trug winzige Fausthandschuhe und hatte eine Mütze auf, die über die Ohren reichte, aber darunter kamen ihre langen hellbraunen Haare zum Vorschein.
Vor uns, den Soldaten mit Waffen in den Händen, hatte die Kleine keine Angst. Überhaupt hatte sie keine Ahnung, daß sie sich gerade in große Gefahr gebracht hatte. Ihr Alter konnten wir nur grob schätzen, vielleicht fünf, vielleicht auch sechs Jahre.
Die Kleine musterte uns, sie schien solche Anblicke gewohnt zu sein, seit Jahren herrschte Krieg. Sie sah sich um, als würde sie etwas suchen. Dann zog sie sich die Fausthandschuhe aus und warf sie achtlos auf den Boden. Einer hob sie auf und schob sie ihr in die beiden Taschen des Mäntelchens. Das Mädchen bemerkte es nicht einmal, so eifrig sah sie im Raum umher.
Dann fiel ihr Blick auf den Boden, und sie fand, was sie gesucht hatte. Der Boden war überdeckt mit Stroh, der Raum mußte wohl einmal als Stall gedient haben. Die kleinen dunkelbraunen Augen des Mädchens begannen zu leuchten. In der Mitte des Raumes kniete sie nieder, und ihre winzigen Kinderhändchen langten neben einen Soldatenstiefel, der riesig wirkte. Sie nahm einen Strohhalm und einen zweiten und sammelte weitere, bis ihre Hände voll waren. Schweigend schauten wir ihr zu. Die Kleine trug das Stroh zu einem Schemel in der Nähe des Ofens. Dort legte sie einzelne Halme aufeinander. Da rief sie schließlich voller Freude aus: „Une étoile!“– ein Stern!
Das Mädchen ging zurück und sammelte noch mehr Halme für einen zweiten Stern. Da lehnte einer von uns sein Gewehr an die Wand. Er nahm Zwirn und eine kleine Schere aus seinem Nähzeug – das hatte jeder Soldat bei sich – und er begann, die Strohhalme auf gleiche Länge zurechtzuschneiden. Die Kleine sah ihm überrascht in die Augen und nahm ihm die Strohhalme aus der Hand, legte sie wiederum sternförmig zusammen. Spontan legte sie die Strohhalme in seine Hände, er band den Zwirn darum, und ein weiterer kleiner Strohstern war entstanden.
Ein anderer Soldat legte seine Waffe ab, bückte sich, sammelte Halme vom Boden auf, nahm eine alte Holzkiste, stellte sie an den Schemel und setzte sich. Einer nach dem anderen, auch ich, legte seine Waffe ab.
Da waren wir, diese abgekämpften, erschöpften Männer mit zerschundenen Uniformen und formten Strohsterne, mit unseren von Kälte und Eis aufgerissenen schmutzigen Händen, zusammen mit einem kleinen Mädchen, das wir gar nicht kannten. Das Mädchen stimmte mit ihrer hellen klaren Stimme ein Weihnachtslied an. Sie sang es in die Nacht hinaus. Leise knisterten die Holzscheite im Ofen.“
In der Klasse war es still, als unser Zeitzeuge geendet hatte.
Skizze downloaden »
PDF downloaden »
Christian Metzner
Spaichingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg; 1996; Bastogne, Ardennen, Belgien; Heiligabend 1944
Meine Zeit als Referendar war nur vorübergehend, die Erinnerung an eine Unterrichtsstunde blieb. Im Dezember 1996 unterrichtete ich am Gymnasium in Spaichingen eine 10. Klasse in Geschichte. Die Epoche hätte unweihnachtlicher nicht sein können – der Zweite Weltkrieg. Die hellflackernden Kerzen am Adventskranz bildeten einen völligen Gegensatz zu den grausamen Bildern und Filmen über diese Zeit. Zum Abschluß hatte ich einen Zeitzeugen in der Hoffnung eingeladen, er könnte den Schülern Antworten geben, die ich nicht geben konnte. Er war seinerzeit Mitte siebzig, zeigte sich erfreut über die Einladung, und als er zu uns kam, hatte er seinen besten Anzug angezogen.
Wir schoben die Tische an die Wand und setzten uns in einen Kreis, das Gespräch sollte ungezwungen sein. Da saß er nun, der Mann, der das alles miterlebt hatte und Fragen beantworten sollte. Alt war er, aber nicht müde. Er erzählte, wie er seinen Einberufungsbescheid zur Wehrmacht bekommen hatte, wie er nach einer kurzen Ausbildung an die Ostfront kam und kurz darauf an die Westfront versetzt wurde, das war im Herbst 1944. Er mußte an der Ardennenoffensive teilnehmen, sie begann am 16. Dezember. Schon war er dabei, das Leben an der Front zu beschreiben, da unterbrach ihn eine Schülerin unvermittelt und fragte: „Wo waren Sie an Heiligabend?“
Kurz stockte der Mann und es schien, als hätte ihn die Frage überrascht. Für einen Moment schloß er die Augen. Die Klasse wartete und er begann eine Geschichte zu erzählen, die ich nie vergessen habe:
„Den Heiligabend des Jahres 1944 verbrachten wir in der Nähe der belgischen Stadt Bastogne und keinem von uns war zum Feiern zumute. Tagelang hatten wir in heftigen Kämpfen dichten und tiefverschneiten Wald durchquert, manchmal bei minus zwanzig Grad. Wir waren erschöpft und ausgemergelt. Aber wir hatten das Glück, zumindest den Heiligabend nicht draußen in der nahegelegenen Feuerstellung verbringen zu müssen. Für wenige Stunden konnten wir uns ausruhen und wärmen. Wir stießen auf einen größeren Kellerraum eines teilweise zerstörten Bauernhofs.
Seit Mitte Dezember befanden wir uns auf dem Vormarsch der Ardennenoffensive, waren aber kurz vor Bastogne zum Stehen gekommen. Die dort eingeschlossenen US-amerikanischen Kräfte wehrten sich beharrlich. Pausenlos wurde geschossen. Die Hoffnung, noch einmal heil aus diesem Inferno zu kommen, hatte kaum einer von uns an dem Fest, das doch wie kein anderes für die Hoffnung stand. Für viele war es das letzte Weihnachten, und sie ahnten es.
In unserem Abschnitt war am 24. Dezember nicht viel los, aber das Geknatter von Maschinengewehren und das Detonieren von Granaten riß die ganze Nacht nicht ab. Der Raum wirkte leer und war halbdunkel, es war uns gleichgültig. Einer nach dem anderen stolperte herein, Mannschaften, Unteroffiziere und Offiziere, es gab keinen Unterschied mehr. Die Kämpfe der letzten zwei Wochen hatten ihre Spuren in unseren Gesichtern und an den Uniformen hinterlassen. Seit vielen Tagen waren wir nicht mehr aus unserer Kleidung herausgekommen. Schweiß hatte die kratzigen Holzfasern unserer Unterwäsche geschmeidig gemacht, und wir spürten sie schon lange nicht mehr. Wir hatten uns nichts mehr zu erzählen, das ununterbrochene Zusammensein in den zurückliegenden Wochen hatte nichts mehr übriggelassen.
Gewehre wurden akkurat an die Wand gelehnt, Patronengurte und Helme wurden abgenommen und davor gelegt, korrekt nebeneinander, ordentlich, militärisch, wie wir es gewohnt waren. Wir siezten uns und wir duzten uns durcheinander, wir machten ein Feuer in einem alten Ofen. Alle waren wir erleichtert, zum ersten Mal seit zwei Wochen wieder ein wärmendes Dach über dem Kopf zu haben. Alles nutzten wir als Sitzgelegenheit: einen umgedrehten Blecheimer, einen Stapel Holz, ein ramponiertes Feldbett. Niemand sprach.
Ein zerknülltes Päckchen Zigaretten machte die Runde, nach und nach entflammten Streichhölzer und beleuchteten beim Anzünden die unrasierten hohlwangigen Gesichter, selbst die jüngeren unter uns sahen zerfurcht aus. Mancher dachte an Heiligabend in der Heimat, schloß die Augen und sah seine Frau und seine Kinder, wie sie die Kerzen am Weihnachtsbaum anzündeten. Wir alle wollten für heute nichts mehr sehen und nichts mehr hören.
Die quietschende Kellertür unterbrach unseren Dämmerschlaf. Es war die Langsamkeit und Vorsichtigkeit, mit der sie aufgemacht wurde, die uns aufschrecken ließ. Alarmiert sprangen wir auf, einer stülpte sich seinen Helm über, andere luden ihre Pistole, einen Karabiner und eine Maschinenpistole durch. Längst war das für jeden von uns Routine. Wir trauten unseren Augen kaum: In der Tür stand ein kleines Mädchen, eingepackt in ein zugeknöpftes Mäntelchen. Es trug winzige Fausthandschuhe und hatte eine Mütze auf, die über die Ohren reichte, aber darunter kamen ihre langen hellbraunen Haare zum Vorschein.
Vor uns, den Soldaten mit Waffen in den Händen, hatte die Kleine keine Angst. Überhaupt hatte sie keine Ahnung, daß sie sich gerade in große Gefahr gebracht hatte. Ihr Alter konnten wir nur grob schätzen, vielleicht fünf, vielleicht auch sechs Jahre.
Die Kleine musterte uns, sie schien solche Anblicke gewohnt zu sein, seit Jahren herrschte Krieg. Sie sah sich um, als würde sie etwas suchen. Dann zog sie sich die Fausthandschuhe aus und warf sie achtlos auf den Boden. Einer hob sie auf und schob sie ihr in die beiden Taschen des Mäntelchens. Das Mädchen bemerkte es nicht einmal, so eifrig sah sie im Raum umher.
Dann fiel ihr Blick auf den Boden, und sie fand, was sie gesucht hatte. Der Boden war überdeckt mit Stroh, der Raum mußte wohl einmal als Stall gedient haben. Die kleinen dunkelbraunen Augen des Mädchens begannen zu leuchten. In der Mitte des Raumes kniete sie nieder, und ihre winzigen Kinderhändchen langten neben einen Soldatenstiefel, der riesig wirkte. Sie nahm einen Strohhalm und einen zweiten und sammelte weitere, bis ihre Hände voll waren. Schweigend schauten wir ihr zu. Die Kleine trug das Stroh zu einem Schemel in der Nähe des Ofens. Dort legte sie einzelne Halme aufeinander. Da rief sie schließlich voller Freude aus: „Une étoile!“– ein Stern!
Das Mädchen ging zurück und sammelte noch mehr Halme für einen zweiten Stern. Da lehnte einer von uns sein Gewehr an die Wand. Er nahm Zwirn und eine kleine Schere aus seinem Nähzeug – das hatte jeder Soldat bei sich – und er begann, die Strohhalme auf gleiche Länge zurechtzuschneiden. Die Kleine sah ihm überrascht in die Augen und nahm ihm die Strohhalme aus der Hand, legte sie wiederum sternförmig zusammen. Spontan legte sie die Strohhalme in seine Hände, er band den Zwirn darum, und ein weiterer kleiner Strohstern war entstanden.
Ein anderer Soldat legte seine Waffe ab, bückte sich, sammelte Halme vom Boden auf, nahm eine alte Holzkiste, stellte sie an den Schemel und setzte sich. Einer nach dem anderen, auch ich, legte seine Waffe ab.
Da waren wir, diese abgekämpften, erschöpften Männer mit zerschundenen Uniformen und formten Strohsterne, mit unseren von Kälte und Eis aufgerissenen schmutzigen Händen, zusammen mit einem kleinen Mädchen, das wir gar nicht kannten. Das Mädchen stimmte mit ihrer hellen klaren Stimme ein Weihnachtslied an. Sie sang es in die Nacht hinaus. Leise knisterten die Holzscheite im Ofen.“
In der Klasse war es still, als unser Zeitzeuge geendet hatte.
Skizze downloaden »
PDF downloaden »
Ein Geschenk für Papa (5.559 Zeichen)
Erika Steiner-Arnold
Altenrode, Landkreis Goslar, Harz; 1951
In den Nachkriegsjahren ging es wirtschaftlich langsam voran, auch der Versandhandel (Quelle, Witt Weiden etc.) steckte noch in den Kinderschuhen. Deshalb kamen neben den Bäckern, Fleischern und dem Fischverkäufer auch andere Händler in regelmäßigen Abständen in unser kleines Dorf Altenrode, welches am Nordrand des Harzes liegt. Damals war ich noch ein kleines Kind. Dennoch erinnere ich mich lebhaft an Herrn Jeschke und Fridolin sowie Frau Börstel, die Schuhe verkaufte.
Die Herren Jeschke und Fridolin transportierten alles, was man damals so brauchte, in ihren Koffern. Sie kamen bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad und hatten den großen Koffer hinten auf den Gepäckträger geschnallt. Wenn einer der beiden in die Küche trat, den Koffer auf den Tisch legte und öffnete, war es für uns Kinder immer wie Weihnachten, obwohl darin kein Spielzeug lag. Was waren darinnen doch für herrliche Dinge: Nähnadeln, Stecknadeln, Nähgarn, Stopfgarn und Zwirn, Wolle, Gummiband, Strumpfhalter und Knöpfe, aber auch Socken, Hosenträger, Büstenhalter, Hüftgürtel, Gürtelschnallen und vieles mehr.
Im Herbst wurde das Angebot erweitert; dann hatten die Händler Muster dabei, und man konnte die Waren und Artikel für Weihnachten in der jeweiligen Größe und Farbe bestellen, zum Beispiel extra dicke warme Stiefelsocken, Mützen und Handschuhe, Krawatten, Pullover, Strickjacken und Nachthemden oder Schlafanzüge sowie Schürzen und Tischdecken.
Es war ungefähr sechs Wochen vor Weihnachten, als Fridolin nach Altenrode kam und im Dorf seine Runde machte, um seine Waren anzubieten und zu verkaufen. Er kam auch zu uns. Meine Mutter brauchte Stopfgarn und Wolle, weil sie bis Weihnachten für uns Kinder Mützen und Fäustlinge (Fausthandschuhe) stricken wollte.
Fridolin zeigte ihr auch sein besonderes Angebot. Aber meine Mutter brauchte nichts, das heißt, sie konnte es nicht kaufen, weil in jenen Jahren das Geld dafür einfach nicht vorhanden war. Die eine Tischdecke hätte ihr schon sehr gefallen, und ein neues Nachthemd könnte sie schon lange gebrauchen, aber es gab wichtigere Dinge.
„Hier habe ich noch etwas besonders Schönes", meinte Fridolin und breitete eine Herrenstrickjacke auf dem Tisch aus.
Meine Mutter strickte alles für uns selbst und wollte schon abwinken, da fiel ihr Blick auf den Verschluß. Diese Jacke besaß keine normalen Knöpfe, sie hatte statt dessen einen Reißverschluß, dessen Funktion Fridolin sogleich vorführte. Spielend leicht ließ sich dieser öffnen und schließen, indem man ihn einfach nach oben oder unten zog. Meine Mutter war begeistert, das wäre ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für ihren Mann, meinen Vater. So etwas würde er nie erwarten. – Zu bemerken ist, daß Reißverschlüsse am Anfang der fünfziger Jahre noch höchst selten in Kleidungsstücken verwendet wurden. Damals wurden auch die Herrenhosen am Hosenschlitz mit Knöpfen verschlossen.
Meine Mutter fragte Fridolin nach dem Preis; er war erschwinglich, sie würde das Geld dafür in den kommenden Wochen zusammensparen. So bestellte sie die Jacke für meinen Vater; Fridolin sollte diese dann kurz vor Weihnachten in der passenden Größe liefern.
Ich war damals gerade zwei Jahre alt, konnte aber schon ziemlich gut sprechen. Staunend und fasziniert hatte ich die ganze Zeit zugesehen und alles mitbekommen. Das silberfarbene Metallding mit den winzigen Zähnchen, das man auf- und zuziehen konnte, hatte mich in seinen Bann gezogen. Als Fridolin gegangen war, schärfte meine Mutter mir ein, daß ich dem Papa aber ja nichts verraten dürfe von der Jacke, weil es eine Weihnachtsüberraschung werden solle.
Erika Steiner-Arnold
Altenrode, Landkreis Goslar, Harz; 1951
In den Nachkriegsjahren ging es wirtschaftlich langsam voran, auch der Versandhandel (Quelle, Witt Weiden etc.) steckte noch in den Kinderschuhen. Deshalb kamen neben den Bäckern, Fleischern und dem Fischverkäufer auch andere Händler in regelmäßigen Abständen in unser kleines Dorf Altenrode, welches am Nordrand des Harzes liegt. Damals war ich noch ein kleines Kind. Dennoch erinnere ich mich lebhaft an Herrn Jeschke und Fridolin sowie Frau Börstel, die Schuhe verkaufte.
Die Herren Jeschke und Fridolin transportierten alles, was man damals so brauchte, in ihren Koffern. Sie kamen bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad und hatten den großen Koffer hinten auf den Gepäckträger geschnallt. Wenn einer der beiden in die Küche trat, den Koffer auf den Tisch legte und öffnete, war es für uns Kinder immer wie Weihnachten, obwohl darin kein Spielzeug lag. Was waren darinnen doch für herrliche Dinge: Nähnadeln, Stecknadeln, Nähgarn, Stopfgarn und Zwirn, Wolle, Gummiband, Strumpfhalter und Knöpfe, aber auch Socken, Hosenträger, Büstenhalter, Hüftgürtel, Gürtelschnallen und vieles mehr.
Im Herbst wurde das Angebot erweitert; dann hatten die Händler Muster dabei, und man konnte die Waren und Artikel für Weihnachten in der jeweiligen Größe und Farbe bestellen, zum Beispiel extra dicke warme Stiefelsocken, Mützen und Handschuhe, Krawatten, Pullover, Strickjacken und Nachthemden oder Schlafanzüge sowie Schürzen und Tischdecken.
Es war ungefähr sechs Wochen vor Weihnachten, als Fridolin nach Altenrode kam und im Dorf seine Runde machte, um seine Waren anzubieten und zu verkaufen. Er kam auch zu uns. Meine Mutter brauchte Stopfgarn und Wolle, weil sie bis Weihnachten für uns Kinder Mützen und Fäustlinge (Fausthandschuhe) stricken wollte.
Fridolin zeigte ihr auch sein besonderes Angebot. Aber meine Mutter brauchte nichts, das heißt, sie konnte es nicht kaufen, weil in jenen Jahren das Geld dafür einfach nicht vorhanden war. Die eine Tischdecke hätte ihr schon sehr gefallen, und ein neues Nachthemd könnte sie schon lange gebrauchen, aber es gab wichtigere Dinge.
„Hier habe ich noch etwas besonders Schönes", meinte Fridolin und breitete eine Herrenstrickjacke auf dem Tisch aus.
Meine Mutter strickte alles für uns selbst und wollte schon abwinken, da fiel ihr Blick auf den Verschluß. Diese Jacke besaß keine normalen Knöpfe, sie hatte statt dessen einen Reißverschluß, dessen Funktion Fridolin sogleich vorführte. Spielend leicht ließ sich dieser öffnen und schließen, indem man ihn einfach nach oben oder unten zog. Meine Mutter war begeistert, das wäre ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für ihren Mann, meinen Vater. So etwas würde er nie erwarten. – Zu bemerken ist, daß Reißverschlüsse am Anfang der fünfziger Jahre noch höchst selten in Kleidungsstücken verwendet wurden. Damals wurden auch die Herrenhosen am Hosenschlitz mit Knöpfen verschlossen.
Meine Mutter fragte Fridolin nach dem Preis; er war erschwinglich, sie würde das Geld dafür in den kommenden Wochen zusammensparen. So bestellte sie die Jacke für meinen Vater; Fridolin sollte diese dann kurz vor Weihnachten in der passenden Größe liefern.
Ich war damals gerade zwei Jahre alt, konnte aber schon ziemlich gut sprechen. Staunend und fasziniert hatte ich die ganze Zeit zugesehen und alles mitbekommen. Das silberfarbene Metallding mit den winzigen Zähnchen, das man auf- und zuziehen konnte, hatte mich in seinen Bann gezogen. Als Fridolin gegangen war, schärfte meine Mutter mir ein, daß ich dem Papa aber ja nichts verraten dürfe von der Jacke, weil es eine Weihnachtsüberraschung werden solle.
 Das Foto zeigt mich mit meiner Großmutter Ida Steiner und ihrer Tochter Ruth, meiner Tante, im Jahr 1951.
Das Foto zeigt mich mit meiner Großmutter Ida Steiner und ihrer Tochter Ruth, meiner Tante, im Jahr 1951.
 Mein Vater Willi Steiner im Jahr 1950.
Mein Vater Willi Steiner im Jahr 1950.
Als mein Vater abends von der Arbeit kam, fragte er mich wie immer, was ich heute gemacht und erlebt hatte.
„Der Fridolin war da ...", begann ich zu erzählen und brach abrupt ab: „Mehr darf ich aber nicht sagen."
Mein Vater lachte und dachte sich seinen Teil, denn es war schon sehr auffällig, wenn ich mich wortkarg gab, anstatt ausführlich zu plappern und lebhaft zu berichten.
In den kommenden Tagen fragte mich mein Vater immer wieder, was die Mama beim Fridolin gekauft hätte. Ich solle es ihm verraten, aber ich blieb standhaft und erklärte stets mit ernsthafter Miene, daß ich nichts verraten dürfe.
Eine ganze Weile ging es gut, das Geheimnis blieb bewahrt. Aber sechs Wochen waren doch eine sehr lange Zeit, und als mein Vater eines Tages erneut fragte, rutschte es einfach so heraus: „Papa, du bekommst eine Jacke aus Wolle, und da ist so ein ,Rauf-Runter’ dran." – Das Wort bzw. die Bezeichnung Reißverschluß hatte ich mir nicht merken können.
Mein Vater lachte, verriet meiner Mutter aber nichts. Er war am Heiligabend tatsächlich sehr überrascht, als die neue Strickjacke unter dem Tannenbaum lag. Ich sehe sie noch heute vor mir: Sie war aus dunkelblauer Wolle und besaß einen farblich abgesetzten, taubenblauen (blaugrauen) Stehkragen und ebensolch farbige Bündchen an den Ärmeln und an der Taille. Sie sah wirklich sehr schick aus und paßte perfekt.
Als Papa die Jacke anzog, und den Reißverschluß hochzog, meinte er schmunzelnd zu mir gewandt: „Und das ist jetzt also so ein neumodischer ,Rauf-Runter’. Der ist aber wirklich praktisch!"
Da lachten alle, und für lange Zeit hießen Reißverschlüsse bei uns ,Rauf-Runter’.
Weil diese Geschichte in unserer Familie jahrelang immer wieder erzählt wurde, erinnere ich mich lebhaft daran. Jahre später wurde ich zur Einschulung stolze Besitzerin eines roten Anoraks; natürlich hatte dieser keinen Reißverschluß, sondern einen „Rauf-Runter".
Foto mit Oma downloaden »
Foto Vater downloaden »
PDF downloaden »
„Der Fridolin war da ...", begann ich zu erzählen und brach abrupt ab: „Mehr darf ich aber nicht sagen."
Mein Vater lachte und dachte sich seinen Teil, denn es war schon sehr auffällig, wenn ich mich wortkarg gab, anstatt ausführlich zu plappern und lebhaft zu berichten.
In den kommenden Tagen fragte mich mein Vater immer wieder, was die Mama beim Fridolin gekauft hätte. Ich solle es ihm verraten, aber ich blieb standhaft und erklärte stets mit ernsthafter Miene, daß ich nichts verraten dürfe.
Eine ganze Weile ging es gut, das Geheimnis blieb bewahrt. Aber sechs Wochen waren doch eine sehr lange Zeit, und als mein Vater eines Tages erneut fragte, rutschte es einfach so heraus: „Papa, du bekommst eine Jacke aus Wolle, und da ist so ein ,Rauf-Runter’ dran." – Das Wort bzw. die Bezeichnung Reißverschluß hatte ich mir nicht merken können.
Mein Vater lachte, verriet meiner Mutter aber nichts. Er war am Heiligabend tatsächlich sehr überrascht, als die neue Strickjacke unter dem Tannenbaum lag. Ich sehe sie noch heute vor mir: Sie war aus dunkelblauer Wolle und besaß einen farblich abgesetzten, taubenblauen (blaugrauen) Stehkragen und ebensolch farbige Bündchen an den Ärmeln und an der Taille. Sie sah wirklich sehr schick aus und paßte perfekt.
Als Papa die Jacke anzog, und den Reißverschluß hochzog, meinte er schmunzelnd zu mir gewandt: „Und das ist jetzt also so ein neumodischer ,Rauf-Runter’. Der ist aber wirklich praktisch!"
Da lachten alle, und für lange Zeit hießen Reißverschlüsse bei uns ,Rauf-Runter’.
Weil diese Geschichte in unserer Familie jahrelang immer wieder erzählt wurde, erinnere ich mich lebhaft daran. Jahre später wurde ich zur Einschulung stolze Besitzerin eines roten Anoraks; natürlich hatte dieser keinen Reißverschluß, sondern einen „Rauf-Runter".
Foto mit Oma downloaden »
Foto Vater downloaden »
PDF downloaden »
Mein sehnlichster Weihnachtswunsch (6.749 Zeichen)
Renate Buddensiek
Hattingen-Blankenstein/Ruhr, Ruhrgebiet; 1945
Meinen sehnlichsten Weihnachtswunsch im Jahr 1945 habe ich bis heute nicht vergessen. Es war das erste Weihnachtsfest, das meine Familie mit mir in unserem zuvor von Bomben zerstörten, nun reparierten Haus in Frieden feiern konnte. Noch Jahre später wurde im Familienkreis, auch beim Blättern in alten Fotoalben, öfters von diesem Fest und meinem damals größten Weihnachtswunsch erzählt.
Ich war im Oktober 1945 gerade sechs Jahre alt, infolge des Krieges unterernährt, blutarm und asthmakrank und war deshalb noch nicht eingeschult worden. Meinen Eltern war dies recht, zumal mir die passenden Schuhe für den längeren Fußmarsch zur Schule fehlten. Im Sommer war ich die meiste Zeit barfuß gelaufen, nachdem ich mir in den einzigen viel zu engen Halbschuhen, die ich besaß, blutige Blasen gelaufen hatte. Seitdem wünschte ich mir nichts sehnlicher als Schuhe, in denen ich bequem bei Wind und Wetter gehen konnte, ohne schmerzende oder nasse Füße zu bekommen.
Wie bei allen Kriegskindern stand 1945 in der Zeit des Mangels auf meinem Wunschzettel an das Christkind nicht neues Spielzeug an erster Stelle, sondern Dinge zum Überleben, wie Nahrung und Kleidung. In meinem Fall waren es die dringend benötigten Schuhe. Was hatten meine Eltern nicht alles unternommen, um Schuhe für mich aufzutreiben! Im Herbst hatten sie dicke, für mich viel zu große Holzschuhe ergattern können, die zusammen mit Großmutters gestrickten warmen Wollsocken meine Füße durch den bevorstehenden Winter tragen sollten. Diese holländischen Klompen mußten jedoch bald an ein älteres Nachbarskind weitergegeben werden, weil ich mir darin beim Stolpern oft die Knie aufgeschlagen hatte.
Bei ihrer weiteren Suche wurden meine Eltern nicht einmal auf dem Schwarzmarkt fündig. In der Not kamen sie auf die Idee, meine zu kleinen Halbschuhe vom Flickschuster passend machen zu lassen. Dieser schnitt jeweils die vordere Lederkappe ab, klebte eine längere Gummisohle über die alte und überzog die offene Schuhspitze mit einem dünnen Kunstlederstreifen. Auf diese Weise waren meine Schuhe zwar länger geworden, sie blieben aber weiterhin zu eng. Sie waren auch weder wasserdicht, noch wärmten sie, so daß ich schon an den ersten kühlen Herbsttagen eine fieberhafte Erkältung nach der anderen bekam.
Noch schlimmer erging es mir, als mir bei den ersten Minustemperaturen dicke Frostbeulen arg zusetzten, zuerst an den Zehen, dann überall an den Füßen. Diese schmerzhaften juckenden Schwellungen, die mir das Gehen zur Qual machten, behandelten meine beiden mitfühlenden Großmütter mit warmen Fußbädern, Wickeln und lindernden Salben. Dabei lasen sie mir biblische Geschichten vor, darunter auch die von der Fußwaschung, die Jesus an seinen Jüngern vornahm, die ich aber so mißverstand, daß die Jünger ihrem Meister Jesus die kranken Füße wuschen und salbten. So tröstete mich die Vorstellung, daß auch Jesus, der in meiner Kinderbibel mit Sandalen abgebildet war, unter Frostbeulen an den Füßen gelitten haben mußte.
Je näher Weihnachten kam, um so verzweifelter suchten meine Eltern weiter nach Schuhen für mich. Die Geschäfte und Lager waren leer, die Händler zuckten nur die Schultern, es gab keine neue Ware. Auf Zeitungsanzeigen nach gebrauchten Schuhen erhielten wir keine Antwort.
Unter diesen widrigen Umständen wandten sich meine Eltern zuletzt hilfesuchend an Nachbarn, Verwandte und Bekannte, an Berufskollegen meines Vaters und sogar an Fremde, die sie in der Stadt trafen. Niemand hatte Kinderschuhe in meiner Größe zu verkaufen, nicht einmal zu einem überhöhten Preis. Schließlich schien das Christkind von meinem sehnlichsten Weihnachtswunsch gehört zu haben und ihn mir erfüllen zu wollen. Die bis dahin vergeblichen Bemühungen nahmen eine unerwartete Wende.
Von seinem Arbeitgeber, einem Stahlwerk im Ruhrgebiet, erhielt mein Vater kurz vor Weihnachten aufgrund der Geldentwertung der alten Reichsmark einen Teil seines Lohns in einer Fuhre Koks ausgezahlt und in Stapeln von etwa zwanzig Dutzend Hufeisen. Der Koks war uns sehr willkommen, bewahrte er uns doch in den eiskalten Wintermonaten vor dem Frieren oder gar Erfrieren. Bei der Anlieferung und Einlagerung der Hufeisen in der Garage fragte meine Mutter meinen Vater ziemlich ratlos, was wir mit all den Hufeisen anfangen sollten. Mein Vater antwortete lachend: „Wart’s ab, Hufeisen bringen bekanntlich Glück."
Den nächsten Tag nahm mein Vater sich frei und machte sich in aller Frühe in seinem alten klapprigen DKW, liebevoll „D.K. Wuppdich" genannt, mit einigen Hufeisen im Kofferraum auf den Weg zu den umliegenden Bauernhöfen. Die Bauern, die zu der Zeit bei ihrer Feldbestellung überwiegend Pferde als Zug- und Arbeitstiere und kaum Traktoren einsetzten, zeigten sich sofort am Angebot meines Vaters interessiert und versprachen, sich zwecks Beschaffung meiner Schuhe umzuhören.
Am Tag vor Heiligabend war es soweit: Mein Vater konnte tatsächlich in einem Tauschgeschäft bei einem Bauern in der Nähe ein Paar gebrauchte Jungen-Schnürstiefel in meiner Schuhgröße bekommen. Daß sie schon etwas abgenutzt aussahen, war unwichtig, die Hauptsache war, sie paßten und waren wasserdicht. Obendrein konnte mein Vater uns mit einem Gänsebraten überraschen, den er ebenfalls gegen Hufeisen getauscht hatte.
Heiligabend legte mein Vater die Stiefelchen, die er in Weihnachtspapier vom Vorjahr hübsch verpackt hatte, hinter die anderen Geschenke halb versteckt unter den Weihnachtsbaum. Als das Glöckchen des Christkinds zur Bescherung klingelte, war ich als erste im Weihnachtszimmer. Sehr zur Freude meiner Großeltern sagte ich im Kerzenlicht ein Weihnachtsgedicht auf. Während wir Weihnachtslieder sangen, konnte ich es kaum abwarten, meine Geschenke auszupacken. Mit leuchtenden Augen holte ich aus den Päckchen, die das Christkind mir gebracht hatte, hübsche Wollstricksachen, eine Puppenstube und einen kleinen Spielzeugkoffer mit handgeschnitzten Holztierchen hervor, dazu gab es einen bunten Teller mit Äpfeln, Nüssen und Mutters leckeren Plätzchen. Doch wo waren meine heißersehnten Schuhe? Hatte das Christkind mir keine gebracht?
Renate Buddensiek
Hattingen-Blankenstein/Ruhr, Ruhrgebiet; 1945
Meinen sehnlichsten Weihnachtswunsch im Jahr 1945 habe ich bis heute nicht vergessen. Es war das erste Weihnachtsfest, das meine Familie mit mir in unserem zuvor von Bomben zerstörten, nun reparierten Haus in Frieden feiern konnte. Noch Jahre später wurde im Familienkreis, auch beim Blättern in alten Fotoalben, öfters von diesem Fest und meinem damals größten Weihnachtswunsch erzählt.
Ich war im Oktober 1945 gerade sechs Jahre alt, infolge des Krieges unterernährt, blutarm und asthmakrank und war deshalb noch nicht eingeschult worden. Meinen Eltern war dies recht, zumal mir die passenden Schuhe für den längeren Fußmarsch zur Schule fehlten. Im Sommer war ich die meiste Zeit barfuß gelaufen, nachdem ich mir in den einzigen viel zu engen Halbschuhen, die ich besaß, blutige Blasen gelaufen hatte. Seitdem wünschte ich mir nichts sehnlicher als Schuhe, in denen ich bequem bei Wind und Wetter gehen konnte, ohne schmerzende oder nasse Füße zu bekommen.
Wie bei allen Kriegskindern stand 1945 in der Zeit des Mangels auf meinem Wunschzettel an das Christkind nicht neues Spielzeug an erster Stelle, sondern Dinge zum Überleben, wie Nahrung und Kleidung. In meinem Fall waren es die dringend benötigten Schuhe. Was hatten meine Eltern nicht alles unternommen, um Schuhe für mich aufzutreiben! Im Herbst hatten sie dicke, für mich viel zu große Holzschuhe ergattern können, die zusammen mit Großmutters gestrickten warmen Wollsocken meine Füße durch den bevorstehenden Winter tragen sollten. Diese holländischen Klompen mußten jedoch bald an ein älteres Nachbarskind weitergegeben werden, weil ich mir darin beim Stolpern oft die Knie aufgeschlagen hatte.
Bei ihrer weiteren Suche wurden meine Eltern nicht einmal auf dem Schwarzmarkt fündig. In der Not kamen sie auf die Idee, meine zu kleinen Halbschuhe vom Flickschuster passend machen zu lassen. Dieser schnitt jeweils die vordere Lederkappe ab, klebte eine längere Gummisohle über die alte und überzog die offene Schuhspitze mit einem dünnen Kunstlederstreifen. Auf diese Weise waren meine Schuhe zwar länger geworden, sie blieben aber weiterhin zu eng. Sie waren auch weder wasserdicht, noch wärmten sie, so daß ich schon an den ersten kühlen Herbsttagen eine fieberhafte Erkältung nach der anderen bekam.
Noch schlimmer erging es mir, als mir bei den ersten Minustemperaturen dicke Frostbeulen arg zusetzten, zuerst an den Zehen, dann überall an den Füßen. Diese schmerzhaften juckenden Schwellungen, die mir das Gehen zur Qual machten, behandelten meine beiden mitfühlenden Großmütter mit warmen Fußbädern, Wickeln und lindernden Salben. Dabei lasen sie mir biblische Geschichten vor, darunter auch die von der Fußwaschung, die Jesus an seinen Jüngern vornahm, die ich aber so mißverstand, daß die Jünger ihrem Meister Jesus die kranken Füße wuschen und salbten. So tröstete mich die Vorstellung, daß auch Jesus, der in meiner Kinderbibel mit Sandalen abgebildet war, unter Frostbeulen an den Füßen gelitten haben mußte.
Je näher Weihnachten kam, um so verzweifelter suchten meine Eltern weiter nach Schuhen für mich. Die Geschäfte und Lager waren leer, die Händler zuckten nur die Schultern, es gab keine neue Ware. Auf Zeitungsanzeigen nach gebrauchten Schuhen erhielten wir keine Antwort.
Unter diesen widrigen Umständen wandten sich meine Eltern zuletzt hilfesuchend an Nachbarn, Verwandte und Bekannte, an Berufskollegen meines Vaters und sogar an Fremde, die sie in der Stadt trafen. Niemand hatte Kinderschuhe in meiner Größe zu verkaufen, nicht einmal zu einem überhöhten Preis. Schließlich schien das Christkind von meinem sehnlichsten Weihnachtswunsch gehört zu haben und ihn mir erfüllen zu wollen. Die bis dahin vergeblichen Bemühungen nahmen eine unerwartete Wende.
Von seinem Arbeitgeber, einem Stahlwerk im Ruhrgebiet, erhielt mein Vater kurz vor Weihnachten aufgrund der Geldentwertung der alten Reichsmark einen Teil seines Lohns in einer Fuhre Koks ausgezahlt und in Stapeln von etwa zwanzig Dutzend Hufeisen. Der Koks war uns sehr willkommen, bewahrte er uns doch in den eiskalten Wintermonaten vor dem Frieren oder gar Erfrieren. Bei der Anlieferung und Einlagerung der Hufeisen in der Garage fragte meine Mutter meinen Vater ziemlich ratlos, was wir mit all den Hufeisen anfangen sollten. Mein Vater antwortete lachend: „Wart’s ab, Hufeisen bringen bekanntlich Glück."
Den nächsten Tag nahm mein Vater sich frei und machte sich in aller Frühe in seinem alten klapprigen DKW, liebevoll „D.K. Wuppdich" genannt, mit einigen Hufeisen im Kofferraum auf den Weg zu den umliegenden Bauernhöfen. Die Bauern, die zu der Zeit bei ihrer Feldbestellung überwiegend Pferde als Zug- und Arbeitstiere und kaum Traktoren einsetzten, zeigten sich sofort am Angebot meines Vaters interessiert und versprachen, sich zwecks Beschaffung meiner Schuhe umzuhören.
Am Tag vor Heiligabend war es soweit: Mein Vater konnte tatsächlich in einem Tauschgeschäft bei einem Bauern in der Nähe ein Paar gebrauchte Jungen-Schnürstiefel in meiner Schuhgröße bekommen. Daß sie schon etwas abgenutzt aussahen, war unwichtig, die Hauptsache war, sie paßten und waren wasserdicht. Obendrein konnte mein Vater uns mit einem Gänsebraten überraschen, den er ebenfalls gegen Hufeisen getauscht hatte.
Heiligabend legte mein Vater die Stiefelchen, die er in Weihnachtspapier vom Vorjahr hübsch verpackt hatte, hinter die anderen Geschenke halb versteckt unter den Weihnachtsbaum. Als das Glöckchen des Christkinds zur Bescherung klingelte, war ich als erste im Weihnachtszimmer. Sehr zur Freude meiner Großeltern sagte ich im Kerzenlicht ein Weihnachtsgedicht auf. Während wir Weihnachtslieder sangen, konnte ich es kaum abwarten, meine Geschenke auszupacken. Mit leuchtenden Augen holte ich aus den Päckchen, die das Christkind mir gebracht hatte, hübsche Wollstricksachen, eine Puppenstube und einen kleinen Spielzeugkoffer mit handgeschnitzten Holztierchen hervor, dazu gab es einen bunten Teller mit Äpfeln, Nüssen und Mutters leckeren Plätzchen. Doch wo waren meine heißersehnten Schuhe? Hatte das Christkind mir keine gebracht?
 Mein schönstes Weihnachtsgeschenk 1945: ein Paar Jungen-Schnürstiefel aus zweiter Hand.
Mein schönstes Weihnachtsgeschenk 1945: ein Paar Jungen-Schnürstiefel aus zweiter Hand.
 Mein Vater machte sofort ein Foto von mir mit meinen neuen Schuhen vor dem Weihnachtsbaum.
Mein Vater machte sofort ein Foto von mir mit meinen neuen Schuhen vor dem Weihnachtsbaum.
Enttäuscht wäre ich fast in Tränen ausgebrochen, hätte mein Vater mir nicht aufmunternd zugezwinkert und mich auf das übriggebliebene Päckchen aufmerksam gemacht. Mit einem Freudenschrei holte ich daraus die warmen Schnürstiefel hervor und probierte sie gleich an. Sie paßten wie für mich gemacht und gefielen mir so gut, daß ich sie abends beim Zubettgehen nicht ausziehen wollte. Am nächsten Morgen beim Kirchgang durch Schnee und Matsch bestanden sie ihre Dichtheitsprobe: Meine Füße blieben warm und trocken. Mein sehnlichster Weihnachtswunsch war in Erfüllung gegangen.
Foto Stiefel downloaden »
Foto Renate am Baum downloaden »
PDF downloaden »
Foto Stiefel downloaden »
Foto Renate am Baum downloaden »
PDF downloaden »
Ein Heiligabend als Geschenk (4.205 Zeichen)
Dieter Nickel
Rüdersdorf bei Berlin, Brandenburg, 1967
Es muß etwa 1967 gewesen sein, als ich unserem ältlichen Pfarrer den Vorschlag machte, unsere Christmette nicht wie bisher um Mitternacht, sondern bereits gegen 18 Uhr zu feiern. Mein Argument war in mehrerer Hinsicht überzeugend: Alle bedeutsamen Feiern beginnen mit einem Gottesdienst in der Kirche. Danach wird die Feier zu Hause fortgesetzt. So können auch unsere Kinder die Geburtstagsfeier des Christkindes miterleben, und Alkoholfahnen werden nicht in die Kirche gebracht. Der Vorschlag gefiel Hochwürden, denn er war sicher froh, wegen der Messe am Morgen des ersten Feiertages früher ins Bett zu kommen.
Und so geschah es, daß wir erstmals unsere drei damals elf-, neun- und siebenjährigen Kinder Birgit, Judith und Thomas am Heiligen Abend bei der Christmette in unserer schönen weihnachtlich geschmückten Kirche zur „Heiligen Familie" bei uns hatten. Der Nachteil war, daß die Zeit bis zur Bescherung länger wurde.
Nachdem die Weihnachtslieder gesungen und die Orgelklänge verklungen waren, machten wir uns eilig auf den Heimweg. In der Dunkelheit erkannten wir den alten Herrn Vollmann vor uns. Er hatte anfangs den gleichen Weg wie wir, schien aber auf uns gewartet zu haben. Er war ein „echter" Berliner aus dem Stadtteil Wedding und nun alleinstehend. Von ihm kannte ich unter anderem den Ausspruch „Uff de driemsche Seite steht een kaputtijet Auto mit een appet Rad". Trotz seines harten Schicksals – seine beiden Söhne waren aus dem Zweiten Weltkrieg nicht heimgekehrt, sondern vermißt, und seine Frau war verstorben – hatte er seinen Humor behalten. Er war es, der dafür sorgte, daß ich im Oktober 1945 meine durch das Kriegsende unterbrochene Lehre als Industriekaufmann fortsetzen konnte.
Dieter Nickel
Rüdersdorf bei Berlin, Brandenburg, 1967
Es muß etwa 1967 gewesen sein, als ich unserem ältlichen Pfarrer den Vorschlag machte, unsere Christmette nicht wie bisher um Mitternacht, sondern bereits gegen 18 Uhr zu feiern. Mein Argument war in mehrerer Hinsicht überzeugend: Alle bedeutsamen Feiern beginnen mit einem Gottesdienst in der Kirche. Danach wird die Feier zu Hause fortgesetzt. So können auch unsere Kinder die Geburtstagsfeier des Christkindes miterleben, und Alkoholfahnen werden nicht in die Kirche gebracht. Der Vorschlag gefiel Hochwürden, denn er war sicher froh, wegen der Messe am Morgen des ersten Feiertages früher ins Bett zu kommen.
Und so geschah es, daß wir erstmals unsere drei damals elf-, neun- und siebenjährigen Kinder Birgit, Judith und Thomas am Heiligen Abend bei der Christmette in unserer schönen weihnachtlich geschmückten Kirche zur „Heiligen Familie" bei uns hatten. Der Nachteil war, daß die Zeit bis zur Bescherung länger wurde.
Nachdem die Weihnachtslieder gesungen und die Orgelklänge verklungen waren, machten wir uns eilig auf den Heimweg. In der Dunkelheit erkannten wir den alten Herrn Vollmann vor uns. Er hatte anfangs den gleichen Weg wie wir, schien aber auf uns gewartet zu haben. Er war ein „echter" Berliner aus dem Stadtteil Wedding und nun alleinstehend. Von ihm kannte ich unter anderem den Ausspruch „Uff de driemsche Seite steht een kaputtijet Auto mit een appet Rad". Trotz seines harten Schicksals – seine beiden Söhne waren aus dem Zweiten Weltkrieg nicht heimgekehrt, sondern vermißt, und seine Frau war verstorben – hatte er seinen Humor behalten. Er war es, der dafür sorgte, daß ich im Oktober 1945 meine durch das Kriegsende unterbrochene Lehre als Industriekaufmann fortsetzen konnte.

Unsere katholische Kirche „Heilige Familie" in Rüdersdorf im Winter 1999. Sie wurde 1905 im neuromanischen Stil erbaut. 1965 erhielt sie eine moderne Ausstattung. 2005 wurde sie saniert und bekam 2014 ein neues Geläut.
Doch zurück zum Heimweg von der Christmette. Meine Frau und ich hatten sofort den gleichen Gedanken: Wir lassen Herrn Vollmann heute nicht allein sein. Wir nehmen ihn mit zu uns nach Hause. Zum Glück konnte man die enttäuschten Gesichter unserer Kinder in der Dunkelheit nicht sehen. Für sie schien der erwartete schöne Weihnachtsabend mit der ersehnten Bescherung so gut wie verdorben. Doch es kam anders, ganz anders.
 Wie in all den Jahren zuvor wurde auch zu Weihnachten 2000, aus dem diese Aufnahme stammt, in unserer Kirche „Heilige Familie" eine wunderschöne Krippe aufgebaut.
Wie in all den Jahren zuvor wurde auch zu Weihnachten 2000, aus dem diese Aufnahme stammt, in unserer Kirche „Heilige Familie" eine wunderschöne Krippe aufgebaut.
Zu Hause erwartete uns ein kleines Abendessen, denn zur Mittagszeit gab es die von meiner Mutter aus ihrer schlesischen Heimat bekannte Pfefferkuchensoße mit Würsten und Sauerkraut. Heimlich ließ meine Frau einen zusätzlichen Weihnachtsteller entstehen, dem ein paar warme Socken und Herrentaschentücher beilagen. Somit war auch für unseren Gast gesorgt. Alles lief wie immer ab: Nachdem ich im Weihnachtzimmer nach dem Rechten gesehen hatte, ließ ich ein Glöckchen erklingen, auf dessen Geläut unsere Kinder ins Zimmer stürzten, gefolgt von unserem Weihnachtsgast und uns. Dabei wurden alle bekannten Strophen des Liedes „Ihr Kinderlein kommet" gesungen. Schon dabei wurde nach den unter dem Weihnachtsbaum vom Christkind gebrachten, noch verdeckten Geschenken geschmult. Namensschildchen auf jedem Weihnachtsteller – auch für unseren Gast – navigierten alle mit großem Hallo zu ihrem Platz. Dann ging es ans Auspackten, denn alle Gaben waren ja eigenhändig vom Christkind und eventuellen Helfern in schönes Weihnachtspapier gewickelt. So etwas kann man nicht einfach aufreißen, zudem sollte es im nächsten Jahr wieder Verwendung finden.
Herr Vollmann war offensichtlich sehr gerührt, sicherlich dachte er an früher, als seine Kinder beschert wurden. Überrascht war er, als er seinen Weihnachtsteller entdeckte und die bescheidenen Gaben überreicht bekam. Da er nicht damit gerechnet hatte, freute er sich riesig darüber. An diesem Abend erzählte er von seinen Kindern und den bescheidenen Geschenken, die früher ebensolche Freude bereiteten.
Beim Nachhauseweg, auf dem ich ihn bis zu seiner Wohnung begleitete, begriff ich, daß das eigentliche Geschenk an ihn die Freude war, das Weihnachtfest seit langem wieder einmal in einer richtigen Familie, wenn es auch nicht die eigene war, mitfeiern zu können. Das spürten auch unsere Kinder, die erlebten, wie man mit geteilter Freude leidgeprüfte Menschen froh machen kann. In ihrer Erinnerung ist dieser Abend „ein ganz besonders schöner" geworden.
Foto Kirche downloaden »
Foto Krippe downloaden »
PDF downloaden »
Herr Vollmann war offensichtlich sehr gerührt, sicherlich dachte er an früher, als seine Kinder beschert wurden. Überrascht war er, als er seinen Weihnachtsteller entdeckte und die bescheidenen Gaben überreicht bekam. Da er nicht damit gerechnet hatte, freute er sich riesig darüber. An diesem Abend erzählte er von seinen Kindern und den bescheidenen Geschenken, die früher ebensolche Freude bereiteten.
Beim Nachhauseweg, auf dem ich ihn bis zu seiner Wohnung begleitete, begriff ich, daß das eigentliche Geschenk an ihn die Freude war, das Weihnachtfest seit langem wieder einmal in einer richtigen Familie, wenn es auch nicht die eigene war, mitfeiern zu können. Das spürten auch unsere Kinder, die erlebten, wie man mit geteilter Freude leidgeprüfte Menschen froh machen kann. In ihrer Erinnerung ist dieser Abend „ein ganz besonders schöner" geworden.
Foto Kirche downloaden »
Foto Krippe downloaden »
PDF downloaden »
Das Puppenhaus (6.100 Zeichen)
Hildegard Bildt
Hohenschöpping bei Velten, Havelland, Brandenburg; 1924 – 1936
Herr Müller, einer unserer Sommergäste, kam bereits seit vielen Jahren nach Hohenschöpping in unser Gasthaus „Zum weißen Schwan". Mehrere Jahre hatte er sogar ständig bei uns gewohnt, auch im Winter. Es war zwar nur ein kleines Zimmer, aber damals war er froh gewesen, eine Bleibe zu haben. Denn er war, wie so viele nach der Weltwirtschaftskrise, mehrere Jahre arbeitslos. Darum konnte er auch die Miete nicht bezahlen, versicherte meiner Mutter jedoch: „Frau Stein, ich mach’ das alles wieder gut, wenn ich Arbeit habe."
Für unsere Wirtschaft kaufte Mutti Apfelsinen nicht pfundweise im Geschäft, sondern bestellte sie kistenweise bei einer Übersee-Firma in Hamburg. Da kosteten sie nur die Hälfte, und frischer waren sie auch. Auch die Dominosteine für Weihnachten ließ sie sich gleich von der Fabrik in größeren Mengen liefern. Die leeren Holzkisten stapelten sich auf dem Hof. Eines Tages fragte Herr Müller, ob er die alten Apfelsinenkisten haben dürfe. Mutti dachte, er wolle sie zum Heizen.
„O nein", sagte er, „die dünnen Bretter sind dazu viel zu schade. Ich möchte daraus etwas basteln."
Er verriet aber nicht, was es werden sollte. Die Kisten durfte er nehmen, und nun saß er an den langen Winterabenden und sägte, hobelte, klebte. Ein Teil seiner dürftigen Arbeitslosenunterstützung ging für Klebstoff und Farbe drauf. Er arbeitete wie besessen. Bald war alles Kistenholz aufgebraucht, und er mußte auf den nächsten Winter und Nachschub warten. Im Jahr darauf, kurz vor Weihnachten 1925, war es soweit: Mutti wurde gerufen. Auf dem Tisch in seiner Stube stand ein großes Gebilde, mit einem Tuch verdeckt. Herr Müller bot meiner Mutter den einzigen Stuhl an. Dann hob er, wie bei einer Denkmaleinweihung, vorsichtig das weiße Tuch hoch und beobachtete dabei gespannt Muttis Gesicht.
„Mein Gott, ist das schön! Das haben Sie ganz allein gemacht?"
Herr Müller nickte froh und stolz.
„Aus diesen alten Holzkisten?"
„Ja."
„Unglaublich, Sie sind ein Künstler!"
„Na, na", wehrte er ab, aber er freute sich sichtlich über das Lob. „Ihre Tochter ist jetzt noch zu klein, aber in ein paar Jahren kann sie damit spielen."
Auf dem Tisch stand ein Puppenhaus, nein – eine Villa! So war auch über der Eingangstür zu lesen: „Villa Elfriede". Meine Schwester Elfriede war erst eineinhalb Jahre alt und ich noch gar nicht geboren.
Nun mußte Mutti die Rückseite und damit das „Innenleben" der Villa betrachten. Unten im großen Wohnzimmer stand ein ausziehbarer Tisch. Auf den Stühlchen mit den hohen Lehnen saßen kleine Puppen. Das Buffet und die Anrichte hatten richtige Schubfächer. In der Mitte hing ein Kronleuchter mit kleinen Glasstäben. An der linken Seite war der Kamin. Vorn ging es durch eine Glastür in den Garten, der von einem Staketenzaun begrenzt wurde. Weißlackierte Gartenmöbel standen auf dem „Rasen". Der erste Stock teilte sich in Schlafstube und Küche. Die Betten, der Schrank und die Nachttische waren ebenfalls weißlackiert und mit Goldornamenten verziert. Auf der Kommode stand eine winzige Waschschüssel mit Krug und unterm Bett ein Nachttopf. Auch die Küche war perfekt eingerichtet. Alle Fenster hatten Gardinen. Unten im „Salon" waren sie aus dickerem Stoff, im Schlafzimmer und in der Küche aus leichtem, weißem Tüll.
„Drücken Sie mal den Hebel da links neben der Kommode nach unten!"
Die kleinen Lämpchen im Kronleuchter leuchteten auf. Mutti wiederholte es in der Küche und im Schlafzimmer. Überall ging das Licht an. Die Schalter waren klein wie ein Pfennigstück. Sogar über der Eingangstür brannte eine kleine Laterne. Sie staunte: „Wie haben Sie das denn gemacht?"
„Ganz einfach, mit einer Taschenlampenbatterie. Ich habe sie auf dem Boden in der Truhe versteckt. Die Drähte hier führen hinauf."
Auf dem Dachboden standen noch allerlei Geräte für den Garten, dazu eine Wäscherolle, kleine Regale, um alles komplett zu machen. Das Dach der Puppenvilla war bis zum ersten Stock heruntergezogen und mit Schindeln bedeckt, die etwas größer als ein Daumennagel waren.
„Die haben Sie alle einzeln ausgesägt?"
Herr Müller nickte.
„Das war ja eine schöne Fummelei!"
„Das stimmt, es hat auch ziemlich lange gedauert, sie alle anzukleben."
Weil Elfriede solch ein schönes Puppenhaus gehörte, schenkte Mutti mir zu Weihnachten einen Kaufmannsladen. Brot, Käse, Würstchen aus Zucker, Marzipan und Schokolade gab es darin; Fläschchen mit Liebesperlen, Päckchen mit Puffreis und vieles mehr. Auch eine kleine Waage gehörte dazu, winzige Tüten, eine Kasse, die klingelte, wenn das Fach mit dem Spielgeld aufsprang; und sogar ein Telefon stand auf meinem Ladentisch. Einmal schenkte mir Onkel Otto, der ältere Bruder von Papa, einen kleinen Schinken aus Marzipan, als ich ihn in seiner Gaststätte „Zur Waage" besuchte. Der kam natürlich auch in meinen Kaufladen. Obwohl es ein hübscher und gut eingerichteter Kinderkaufmannsladen war, spielte ich eigentlich nur im Winter damit. Im Sommer baute ich mir viel lieber einen Laden draußen auf der Wiese. Der bestand aus alten Kisten und Brettern und mein Angebot aus Steinen, Sand und Eierpampe. Das waren dann Brot, Zucker und Quark. Blätter wurden zu Tüten und Einwickelpapier. Bezahlt wurde mit kleinen Steinen, manchmal schlug die kleine Kundin der Verkäuferin auch nur kräftig auf die flache Hand. Dieses Spiel im Freien, bei dem die Phantasie beflügelt wurde, machte mir mehr Spaß als innen mit dem so feinen Kaufmannsladen, bei dem alles vorhanden war.
Elfriedes Puppenhaus wurde zunächst ins Kinderzimmer geschafft. Mutti schenkte meiner Schwester nach und nach zu Weihnachten und zu den Geburtstagen noch allerhand Hausrat und neue Püppchen, aber Elfriede hat kaum damit gespielt. Und ich durfte überhaupt nichts anfassen, solange ich klein war, andere Kinder noch weniger. Sie konnten die „Villa Elfriede" nur von weitem bewundern.
Später stellte Mutti das Puppenhaus in unsere gute Stube. Es wurde jedem Besucher gezeigt. Noch nach Jahren erzählte sie die Geschichte von ihrem arbeitslosen Mieter, der dieses Kunstwerk aus Apfelsinenkisten geschaffen hatte.
PDF downloaden »
Hildegard Bildt
Hohenschöpping bei Velten, Havelland, Brandenburg; 1924 – 1936
Herr Müller, einer unserer Sommergäste, kam bereits seit vielen Jahren nach Hohenschöpping in unser Gasthaus „Zum weißen Schwan". Mehrere Jahre hatte er sogar ständig bei uns gewohnt, auch im Winter. Es war zwar nur ein kleines Zimmer, aber damals war er froh gewesen, eine Bleibe zu haben. Denn er war, wie so viele nach der Weltwirtschaftskrise, mehrere Jahre arbeitslos. Darum konnte er auch die Miete nicht bezahlen, versicherte meiner Mutter jedoch: „Frau Stein, ich mach’ das alles wieder gut, wenn ich Arbeit habe."
Für unsere Wirtschaft kaufte Mutti Apfelsinen nicht pfundweise im Geschäft, sondern bestellte sie kistenweise bei einer Übersee-Firma in Hamburg. Da kosteten sie nur die Hälfte, und frischer waren sie auch. Auch die Dominosteine für Weihnachten ließ sie sich gleich von der Fabrik in größeren Mengen liefern. Die leeren Holzkisten stapelten sich auf dem Hof. Eines Tages fragte Herr Müller, ob er die alten Apfelsinenkisten haben dürfe. Mutti dachte, er wolle sie zum Heizen.
„O nein", sagte er, „die dünnen Bretter sind dazu viel zu schade. Ich möchte daraus etwas basteln."
Er verriet aber nicht, was es werden sollte. Die Kisten durfte er nehmen, und nun saß er an den langen Winterabenden und sägte, hobelte, klebte. Ein Teil seiner dürftigen Arbeitslosenunterstützung ging für Klebstoff und Farbe drauf. Er arbeitete wie besessen. Bald war alles Kistenholz aufgebraucht, und er mußte auf den nächsten Winter und Nachschub warten. Im Jahr darauf, kurz vor Weihnachten 1925, war es soweit: Mutti wurde gerufen. Auf dem Tisch in seiner Stube stand ein großes Gebilde, mit einem Tuch verdeckt. Herr Müller bot meiner Mutter den einzigen Stuhl an. Dann hob er, wie bei einer Denkmaleinweihung, vorsichtig das weiße Tuch hoch und beobachtete dabei gespannt Muttis Gesicht.
„Mein Gott, ist das schön! Das haben Sie ganz allein gemacht?"
Herr Müller nickte froh und stolz.
„Aus diesen alten Holzkisten?"
„Ja."
„Unglaublich, Sie sind ein Künstler!"
„Na, na", wehrte er ab, aber er freute sich sichtlich über das Lob. „Ihre Tochter ist jetzt noch zu klein, aber in ein paar Jahren kann sie damit spielen."
Auf dem Tisch stand ein Puppenhaus, nein – eine Villa! So war auch über der Eingangstür zu lesen: „Villa Elfriede". Meine Schwester Elfriede war erst eineinhalb Jahre alt und ich noch gar nicht geboren.
Nun mußte Mutti die Rückseite und damit das „Innenleben" der Villa betrachten. Unten im großen Wohnzimmer stand ein ausziehbarer Tisch. Auf den Stühlchen mit den hohen Lehnen saßen kleine Puppen. Das Buffet und die Anrichte hatten richtige Schubfächer. In der Mitte hing ein Kronleuchter mit kleinen Glasstäben. An der linken Seite war der Kamin. Vorn ging es durch eine Glastür in den Garten, der von einem Staketenzaun begrenzt wurde. Weißlackierte Gartenmöbel standen auf dem „Rasen". Der erste Stock teilte sich in Schlafstube und Küche. Die Betten, der Schrank und die Nachttische waren ebenfalls weißlackiert und mit Goldornamenten verziert. Auf der Kommode stand eine winzige Waschschüssel mit Krug und unterm Bett ein Nachttopf. Auch die Küche war perfekt eingerichtet. Alle Fenster hatten Gardinen. Unten im „Salon" waren sie aus dickerem Stoff, im Schlafzimmer und in der Küche aus leichtem, weißem Tüll.
„Drücken Sie mal den Hebel da links neben der Kommode nach unten!"
Die kleinen Lämpchen im Kronleuchter leuchteten auf. Mutti wiederholte es in der Küche und im Schlafzimmer. Überall ging das Licht an. Die Schalter waren klein wie ein Pfennigstück. Sogar über der Eingangstür brannte eine kleine Laterne. Sie staunte: „Wie haben Sie das denn gemacht?"
„Ganz einfach, mit einer Taschenlampenbatterie. Ich habe sie auf dem Boden in der Truhe versteckt. Die Drähte hier führen hinauf."
Auf dem Dachboden standen noch allerlei Geräte für den Garten, dazu eine Wäscherolle, kleine Regale, um alles komplett zu machen. Das Dach der Puppenvilla war bis zum ersten Stock heruntergezogen und mit Schindeln bedeckt, die etwas größer als ein Daumennagel waren.
„Die haben Sie alle einzeln ausgesägt?"
Herr Müller nickte.
„Das war ja eine schöne Fummelei!"
„Das stimmt, es hat auch ziemlich lange gedauert, sie alle anzukleben."
Weil Elfriede solch ein schönes Puppenhaus gehörte, schenkte Mutti mir zu Weihnachten einen Kaufmannsladen. Brot, Käse, Würstchen aus Zucker, Marzipan und Schokolade gab es darin; Fläschchen mit Liebesperlen, Päckchen mit Puffreis und vieles mehr. Auch eine kleine Waage gehörte dazu, winzige Tüten, eine Kasse, die klingelte, wenn das Fach mit dem Spielgeld aufsprang; und sogar ein Telefon stand auf meinem Ladentisch. Einmal schenkte mir Onkel Otto, der ältere Bruder von Papa, einen kleinen Schinken aus Marzipan, als ich ihn in seiner Gaststätte „Zur Waage" besuchte. Der kam natürlich auch in meinen Kaufladen. Obwohl es ein hübscher und gut eingerichteter Kinderkaufmannsladen war, spielte ich eigentlich nur im Winter damit. Im Sommer baute ich mir viel lieber einen Laden draußen auf der Wiese. Der bestand aus alten Kisten und Brettern und mein Angebot aus Steinen, Sand und Eierpampe. Das waren dann Brot, Zucker und Quark. Blätter wurden zu Tüten und Einwickelpapier. Bezahlt wurde mit kleinen Steinen, manchmal schlug die kleine Kundin der Verkäuferin auch nur kräftig auf die flache Hand. Dieses Spiel im Freien, bei dem die Phantasie beflügelt wurde, machte mir mehr Spaß als innen mit dem so feinen Kaufmannsladen, bei dem alles vorhanden war.
Elfriedes Puppenhaus wurde zunächst ins Kinderzimmer geschafft. Mutti schenkte meiner Schwester nach und nach zu Weihnachten und zu den Geburtstagen noch allerhand Hausrat und neue Püppchen, aber Elfriede hat kaum damit gespielt. Und ich durfte überhaupt nichts anfassen, solange ich klein war, andere Kinder noch weniger. Sie konnten die „Villa Elfriede" nur von weitem bewundern.
Später stellte Mutti das Puppenhaus in unsere gute Stube. Es wurde jedem Besucher gezeigt. Noch nach Jahren erzählte sie die Geschichte von ihrem arbeitslosen Mieter, der dieses Kunstwerk aus Apfelsinenkisten geschaffen hatte.
PDF downloaden »
 Unvergessene Weihnachten Band 1
Unvergessene Weihnachten Band 1 Unvergessene Weihnachten Band 2
Unvergessene Weihnachten Band 2 Unvergessene Weihnachten Band 3
Unvergessene Weihnachten Band 3 Unvergessene Weihnachten Band 4
Unvergessene Weihnachten Band 4 Unvergessene Weihnachten Band 5
Unvergessene Weihnachten Band 5 Unvergessene Weihnachten Band 6
Unvergessene Weihnachten Band 6 Unvergessene Weihnachten. Band 7
Unvergessene Weihnachten. Band 7 Unvergessene Weihnachten. Band 8
Unvergessene Weihnachten. Band 8 Unvergessene Weihnachten. Band 9
Unvergessene Weihnachten. Band 9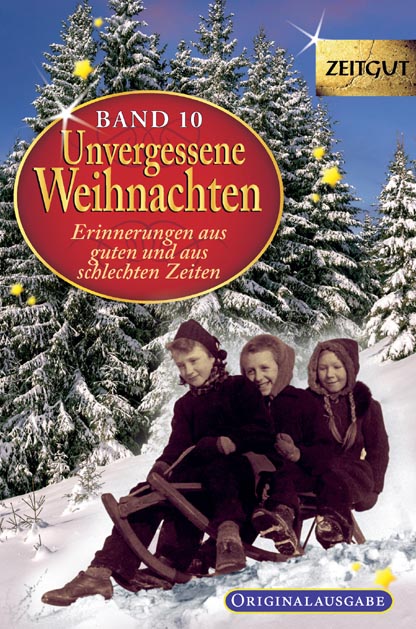 Unvergessene Weihnachten. Band 10
Unvergessene Weihnachten. Band 10 Unvergessene Weihnachten. Band 11
Unvergessene Weihnachten. Band 11 Unvergessene Weihnachten. Band 12
Unvergessene Weihnachten. Band 12