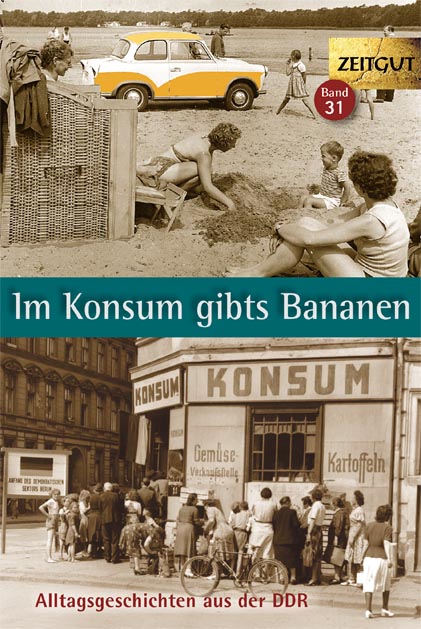Frauen an der Heimatfront
Frauen an der HeimatfrontErinnerungen 1939-1945
320 Seiten mit vielen Abbildungen, Ortsregister, Chronologie
Reihe Zeitgut. Band 26
Zeitgut Verlag, Berlin.
ISBN: 3-86614-206-0,
gebunden, Euro 13,90
ISBN: 3-86614-208-4,
Taschenbuch, Euro 11,90
Zum Shop »
"Lassen Sie meine Frau nicht im Stich!"
Leseprobe von Erika Peters
aus "Frauen an der Heimatfront"
Niederzehren, Kreis Marienwerder*), Westpreußen; August – Oktober 1939 / 1939 – 1986
„Mama, mach der Erika Schaumomelett“, das höre ich noch heute die Kinder der Familie Gosda rufen, wenn ich mir Eierkuchen backe. Schaumomelett war das Beste, was sie in ihrer Freude meinten, mir anbieten zu können, wenn ich sie in den Jahren 1940 bis 1944 in ihrem Dorf Niederzehren in Westpreußen besuchte. Bei ihnen hatte ich ein paar Monate des Jahres 1939 als „studentische Erntehilfe“ gelebt. Drei Wochen sollte damals der freiwillige Arbeitseinsatz bei Bauern in Westpreußen dauern. Wer von uns Studentinnen von der Hochschule für Lehrerbildung in Elbing konnte sich dieser Aufforderung zur Hilfe in der Landwirtschaft entziehen?
„Frau, ich habe dir ein Mädchen bestellt“
Ein schlanker, junger Mann Mitte dreißig empfing mich am Bahnhof in Marienwerder, und wir fuhren auf seinem Pferdewagen nach Niederzehren. Die Unterhaltung unterwegs war freundlich und angeregt, und als ich dann auf das Gehöft und in das saubere Haus kam, mußte ich lachen, daß ich mich hatte bange machen lassen. Hier war es schön, es würde mir gefallen. Vier Kinder kamen mir entgegengelaufen, sie mögen vier bis zehn Jahre alt gewesen sein. Dazu gab es noch die zweijährige Christa. Es gefiel mir immer mehr. Dann trat eine junge Frau auf mich zu und begrüßte mich – freundlich, hübsch von Gestalt und Aussehen, sauber und adrett gekleidet – gar nicht, wie ich mir eine Bauersfrau vorgestellt hatte. Ich habe Glück, so meinte ich, bei so netten Leuten kann ich gern bleiben.
Auch das Ehepaar Gosda hatte ihrer neuen Hausgenossin mit gemischten Gefühlen entgegengesehen. Das Grundstück umfaßte etwa 120 Morgen. „Zu groß, um es allein bewirtschaften zu können, zu klein, um sich mehrere Angestellte zu leisten – eine ungünstige Zwischengröße“, so hörte ich später. Es wurde nur ein älterer, etwas dümmlicher Mann als Hilfskraft beschäftigt. Die Hausfrau war darum auch im Stall tätig und mußte zu Spitzenarbeitszeiten mit aufs Feld. Das war für sie eine große Belastung, da sie für fünf Kinder, den Haushalt, den Garten und das Kleinvieh auf dem Hof zu sorgen hatte. Eines Tages war Karl Gosda aus der Stadt nach Hause gekommen und hatte gesagt: „Frau, nun wirst du es leichter haben. Ich war auf dem Arbeitsamt und habe dir ein Mädchen bestellt.“
„Na, da werden wir ja etwas Rechtes bekommen!“ war die skeptische, ja vorwurfsvolle Antwort. Das erzählte Alma Gosda mir später einmal lachend.
Wie in alten Zeiten
Auf dem Hof in Niederzehren war alles aber ganz anders. Es war ein Gehöft im Abbau, lag ein oder zwei Kilometer vom Dorf entfernt. Darum gab es hier weder Elektrizität noch Gas, und das schockierte mich anfangs sehr. Ich wußte nicht, daß es das Ende der dreißiger Jahre noch gab: keine Elektrizität! Immer mußte man im Herd Feuer anzünden, auch wenn man nur Kaffeewasser brauchte, oder wenn ich für Klein-Christa den Brei kochen wollte. Daran mußte ich mich erst gewöhnen, zumal in diesen warmen Monaten August und September. Es gab auch keinen Schalter, um Licht anzuknipsen, sondern wie in alten Zeiten Petroleumlampen und Kerzen. Ich war von der ungewohnten Arbeit müde und ging wie die anderen zeitig ins Bett. Aber einmal wachte ich nachts auf, weil eine Maus in meinem Strohsack knispelte. Ich erschrak, sprang auf und tastete mich in die Küche. Doch mir war hier noch alles unbekannt und ich fand im Dunkeln kein Streichholz oder Licht. So kroch ich zur Maus zurück in mein Bett.
Ohnehin hatten wir trotz der vielen Arbeit auch manche schöne Zeit miteinander. Mir schmeckte hier das Essen ganz besonders gut. Für den Sonntagsbraten schöpfte die Hausfrau von der Milch ein paar Löffel Sahne ab und schmorte sie mit. Nirgends habe ich so gute Soßen gegessen wie bei Gosdas.
„Lassen Sie meine Frau nicht im Stich!“
Ja, viele deutsche Soldaten campierten in dieser Gegend. Die Grenze zu Polen lag nur zwei Kilometer entfernt, und es war August 1939. Einmal zeigte Herr Gosda sie mir aus nächster Nähe. Er gab mir ein Fahrrad – o weh, ein Herrenrad! Zum Aufsteigen mußte ich es an einen hohen Chausseestein lehnen und fiel dann noch öfter herunter. Aber Herr Gosda radelte tüchtig drauflos, und ich mußte sehen, daß ich hinterher kam. Dann waren wir an der Staatsgrenze angelangt. Zu meinem Erstaunen war das ein Feldweg, der sich zwischen Äckern und Wiesen dahinzog. Diese Seite war Deutschland, die andere Polen. Kein Grenzer, kein Zöllner, überhaupt kein Mensch zu sehen! Ich konnte nicht widerstehen, stieg vom Rad ab und berührte das polnische Land.
So friedlich blieb es nicht lange. Bei abendlichen Besuchen im Dorfgasthaus, wohin mich das Ehepaar Gosda mehrmals mitnahm, hörte ich einen Satz, der mir nicht aus dem Gedächtnis gegangen ist. Wenn die Männer sich untereinander verabschiedeten, riefen sie einander zu: „Auf Wiedersehen im Massengrab!“ Ein Gruß mit zuviel Galgenhumor.
Angst kroch hoch. Niemand konnte etwas dagegen tun. Die Menschen hockten mehr als sonst in der Schänke zusammen, und doch war jeder hilflos. Man erzählte schon von brennenden Gehöften in der Nähe längs der Grenze. Das wollten einige von geflüchteten Frauen mit ihren Kindern gehört haben. Aber keiner wußte etwas Genaues. Wie Jahrzehnte später durch die Medien zu erfahren war, handelte es sich hier und auch an anderen Grenzen um Brandstiftungen aus der eigenen Nazi-Partei, um die Kriegsstimmung anzuheizen. Doch wer wußte das damals schon?!
An einem Tag Mitte August kam ein Mann mit einem Brief auf den Hof geradelt: Es war der schriftliche Gestellungsbefehl. Der Bauer war auf dem Feld. Horst, der zehnjährige Sohn, lief hin: „Vater, du sollst sofort nach Hause kommen!“
Abschied zwischen den Eheleuten, Abschied von den Kindern. Ich habe die Einzelheiten dieser aufregenden Stunden vergessen, nur die Worte des Mannes an mich sind mir in Erinnerung geblieben: „Lassen Sie meine Frau nicht im Stich! Helfen Sie ihr! Stehen Sie ihr bei!“
Nun waren wir zwei Frauen allein auf dem Hof – Alma Gosda, Ende zwanzig; ich 22 Jahre alt. Noch so jung!
Am anderen Morgen machten Horst und der dumme Paul den Leiterwagen lang und trugen eine Truhe, Holzkisten und ein kleines Schränkchen auf den Hof, aus denen ich mit Seifenlauge Spinnweben und Staub herausscheuerte. In der Sonne sollten die Behälter gut trocknen. Die Bäuerin hatte im Haus zu schaffen. Wahrscheinlich suchte sie Betten, Kleider und Wäsche zusammen – alles für eine Flucht. Gerdchen und Ille spielten in der Nähe mit ihren Puppen. Klein-Christa schlief drinnen in ihrem Bettchen. Wo war Willein?
„Ich bleibe hier!“
Da kam die Postfrau auf den Hof und übergab mir einen Brief. Nanu? Ein Schreiben vom Arbeitsamt Marienwerder:
Nachsatz: Bei Verspätung Ihrerseits könnte Ihre Eisenbahnstrecke nicht passierbar sein. Wir würden dann dafür sorgen, daß Sie von Königsberg aus mit dem ‚Seedienst Ostpreußen’ in Ihre Heimat gebracht werden.“
Da saß ich nun mit dem Blatt Papier in der einen und dem Putzlappen in der anderen Hand auf einer Kiste und begriff erst allmählich, was der Inhalt bedeutete: Sofort alles hinwerfen und nach Hause fahren. – Das ging doch nicht!
Ich konnte die Frau und ihre Kinder jetzt nicht alleinlassen. Gleich würde Krieg sein!
Ich hatte es nicht gemerkt, daß die kleinen Mädchen hergelaufen waren und mich anschauten. Augenblicklich stand auch die Bäuerin neben mir und nahm mir den Briefbogen aus der Hand. Sie las und stöhnte: „Was soll nun werden? Jetzt bin ich ganz allein!“
Die Kinder hatten gemerkt, daß hier etwas Schlimmes vor sich ging. Nun sprangen sie herum und jauchzten: „Die Erika bleibt hier!“
Einige Tage später kamen plötzlich Militärautos, Panzerwagen, Kriegsgerät auf den Hof gefahren. Soldaten waren geschäftig, liefen umher. Pferde wieherten, Lärm, Bewegung und Rufe. Unsere Kinder überall dazwischen, Jungen wie Mädchen. Sie hatten ihre große Zeit, wußten nichts vom Ernst der Lage. Auch wir beiden Frauen wurden von diesem Trubel aus der Bahn geworfen, mußten nur sehen, daß wir abends zur rechten Zeit das Vieh fütterten und die Kühe molken.
An den folgenden Tagen war Bewegung auf der Chaussee, die in geringer Entfernung am Gehöft entlangführte. Ununterbrochen zogen die Kolonnen der Soldaten vorbei in Richtung polnische Grenze bei Garnsee. Es war heiß in diesen Septembertagen, die Sonne brannte. Die Männer waren verstaubt und durstig. Die Kinder liefen an die Straße, schrien und winkten. „Kinder, bringt ihnen etwas zu trinken, sie haben Durst!“
Ende Oktober 1939 kam der Hofbesitzer Karl Gosda nach Hause. Ich fuhr nach einigen Tagen zu meinen Eltern nach Stolp zurück. Die „Erntehilfe“ war erfüllt, die Semesterferien neigten sich dem Ende zu.
Abschied vom Bauern, Abschied vom Hof
Polen war besiegt und besetzt. Die Bauern wurden heimgeschickt, damit sie ihr Land bestellten und ihr Vieh besorgten. Karl Gosda hat das nicht lange tun können. Er hatte sich in der Hitze der Tage und der Kälte der Herbstnächte bei dem Kriegsvormarsch erkältet und bald darauf eine Lungenentzündung zugezogen, die sich zur Schwindsucht ausweitete. Er starb im folgenden Jahr 1940, als sein ältester Sohn Horst noch ein Kind von elf Jahren und der Hoferbe Willi Gosda zehn Jahre alt war. Ein furchtbares Unglück, das die Familie traf. Wie sollte es auf dem Hof weitergehen?
Freundschaft über den Tod hinaus
Doch irgendwann entstand wieder eine Verbindung von Sachsen nach Thüringen und später ins Birkenfelder Land, wohin ich mich mit meiner Familie ein zweites Mal auf die Flucht begeben mußte. Die briefliche Verbindung blieb, und die Freundschaft dauerte bis zum Lebensende von Alma Gosda im Jahre 1986.
Doch die Geschichte dieser Freundschaft reichte über den Tod der Mutter hinaus. Die Gosda-Kinder vergaßen ihre Erika nicht. Ich glaube, das lag daran, daß die Mutter die Briefe ihres einstigen Studenten-Mädchens immer zum Lesen bereit legte, wenn die Kinder zu ihr zu Besuch kamen.
Ich wußte nichts davon. Ich erfuhr aus Almas Briefen wohl vom Ergehen und Schicksal ihrer Kinder. Aber ich hatte keine Vorstellung und kannte nicht das Land, in dem sie im äußersten Zipfel der DDR bei Görlitz lebten. Zudem war mein eigenes Leben mit Arbeit und Sorgen um meine Familie erfüllt. Es blieb wenig Zeit für Gedanken um das Leben der anderen. Doch die Wurzeln der Freundschaft lebten wohl im Verborgenen weiter und trieben plötzlich neue Blüten, als die Mauer zwischen Ost und West 1989 fiel – ein Geschenk der deutschen Einheit für uns!
Ilse – die „süße Illemaus“ von damals – hatte nach Mutters Tod die Verbindung nicht ganz abreißen lassen. Aber nun setzte sich Gerdchen – damals die „wilde Hummel“ – einfach in den Zug, fuhr die ganze Nacht hindurch und stand am Morgen in Idar-Oberstein auf dem Bahnhof. Würden wir uns wiedererkennen?
*) heute Czarne Dolne und Kwidzyn in Polen
„Frau, ich habe dir ein Mädchen bestellt“
Ein schlanker, junger Mann Mitte dreißig empfing mich am Bahnhof in Marienwerder, und wir fuhren auf seinem Pferdewagen nach Niederzehren. Die Unterhaltung unterwegs war freundlich und angeregt, und als ich dann auf das Gehöft und in das saubere Haus kam, mußte ich lachen, daß ich mich hatte bange machen lassen. Hier war es schön, es würde mir gefallen. Vier Kinder kamen mir entgegengelaufen, sie mögen vier bis zehn Jahre alt gewesen sein. Dazu gab es noch die zweijährige Christa. Es gefiel mir immer mehr. Dann trat eine junge Frau auf mich zu und begrüßte mich – freundlich, hübsch von Gestalt und Aussehen, sauber und adrett gekleidet – gar nicht, wie ich mir eine Bauersfrau vorgestellt hatte. Ich habe Glück, so meinte ich, bei so netten Leuten kann ich gern bleiben.
Auch das Ehepaar Gosda hatte ihrer neuen Hausgenossin mit gemischten Gefühlen entgegengesehen. Das Grundstück umfaßte etwa 120 Morgen. „Zu groß, um es allein bewirtschaften zu können, zu klein, um sich mehrere Angestellte zu leisten – eine ungünstige Zwischengröße“, so hörte ich später. Es wurde nur ein älterer, etwas dümmlicher Mann als Hilfskraft beschäftigt. Die Hausfrau war darum auch im Stall tätig und mußte zu Spitzenarbeitszeiten mit aufs Feld. Das war für sie eine große Belastung, da sie für fünf Kinder, den Haushalt, den Garten und das Kleinvieh auf dem Hof zu sorgen hatte. Eines Tages war Karl Gosda aus der Stadt nach Hause gekommen und hatte gesagt: „Frau, nun wirst du es leichter haben. Ich war auf dem Arbeitsamt und habe dir ein Mädchen bestellt.“
„Na, da werden wir ja etwas Rechtes bekommen!“ war die skeptische, ja vorwurfsvolle Antwort. Das erzählte Alma Gosda mir später einmal lachend.
Wie in alten Zeiten
Auf dem Hof in Niederzehren war alles aber ganz anders. Es war ein Gehöft im Abbau, lag ein oder zwei Kilometer vom Dorf entfernt. Darum gab es hier weder Elektrizität noch Gas, und das schockierte mich anfangs sehr. Ich wußte nicht, daß es das Ende der dreißiger Jahre noch gab: keine Elektrizität! Immer mußte man im Herd Feuer anzünden, auch wenn man nur Kaffeewasser brauchte, oder wenn ich für Klein-Christa den Brei kochen wollte. Daran mußte ich mich erst gewöhnen, zumal in diesen warmen Monaten August und September. Es gab auch keinen Schalter, um Licht anzuknipsen, sondern wie in alten Zeiten Petroleumlampen und Kerzen. Ich war von der ungewohnten Arbeit müde und ging wie die anderen zeitig ins Bett. Aber einmal wachte ich nachts auf, weil eine Maus in meinem Strohsack knispelte. Ich erschrak, sprang auf und tastete mich in die Küche. Doch mir war hier noch alles unbekannt und ich fand im Dunkeln kein Streichholz oder Licht. So kroch ich zur Maus zurück in mein Bett.
Ohnehin hatten wir trotz der vielen Arbeit auch manche schöne Zeit miteinander. Mir schmeckte hier das Essen ganz besonders gut. Für den Sonntagsbraten schöpfte die Hausfrau von der Milch ein paar Löffel Sahne ab und schmorte sie mit. Nirgends habe ich so gute Soßen gegessen wie bei Gosdas.
„Lassen Sie meine Frau nicht im Stich!“
Ja, viele deutsche Soldaten campierten in dieser Gegend. Die Grenze zu Polen lag nur zwei Kilometer entfernt, und es war August 1939. Einmal zeigte Herr Gosda sie mir aus nächster Nähe. Er gab mir ein Fahrrad – o weh, ein Herrenrad! Zum Aufsteigen mußte ich es an einen hohen Chausseestein lehnen und fiel dann noch öfter herunter. Aber Herr Gosda radelte tüchtig drauflos, und ich mußte sehen, daß ich hinterher kam. Dann waren wir an der Staatsgrenze angelangt. Zu meinem Erstaunen war das ein Feldweg, der sich zwischen Äckern und Wiesen dahinzog. Diese Seite war Deutschland, die andere Polen. Kein Grenzer, kein Zöllner, überhaupt kein Mensch zu sehen! Ich konnte nicht widerstehen, stieg vom Rad ab und berührte das polnische Land.
So friedlich blieb es nicht lange. Bei abendlichen Besuchen im Dorfgasthaus, wohin mich das Ehepaar Gosda mehrmals mitnahm, hörte ich einen Satz, der mir nicht aus dem Gedächtnis gegangen ist. Wenn die Männer sich untereinander verabschiedeten, riefen sie einander zu: „Auf Wiedersehen im Massengrab!“ Ein Gruß mit zuviel Galgenhumor.
Angst kroch hoch. Niemand konnte etwas dagegen tun. Die Menschen hockten mehr als sonst in der Schänke zusammen, und doch war jeder hilflos. Man erzählte schon von brennenden Gehöften in der Nähe längs der Grenze. Das wollten einige von geflüchteten Frauen mit ihren Kindern gehört haben. Aber keiner wußte etwas Genaues. Wie Jahrzehnte später durch die Medien zu erfahren war, handelte es sich hier und auch an anderen Grenzen um Brandstiftungen aus der eigenen Nazi-Partei, um die Kriegsstimmung anzuheizen. Doch wer wußte das damals schon?!
An einem Tag Mitte August kam ein Mann mit einem Brief auf den Hof geradelt: Es war der schriftliche Gestellungsbefehl. Der Bauer war auf dem Feld. Horst, der zehnjährige Sohn, lief hin: „Vater, du sollst sofort nach Hause kommen!“
Abschied zwischen den Eheleuten, Abschied von den Kindern. Ich habe die Einzelheiten dieser aufregenden Stunden vergessen, nur die Worte des Mannes an mich sind mir in Erinnerung geblieben: „Lassen Sie meine Frau nicht im Stich! Helfen Sie ihr! Stehen Sie ihr bei!“
Nun waren wir zwei Frauen allein auf dem Hof – Alma Gosda, Ende zwanzig; ich 22 Jahre alt. Noch so jung!
Am anderen Morgen machten Horst und der dumme Paul den Leiterwagen lang und trugen eine Truhe, Holzkisten und ein kleines Schränkchen auf den Hof, aus denen ich mit Seifenlauge Spinnweben und Staub herausscheuerte. In der Sonne sollten die Behälter gut trocknen. Die Bäuerin hatte im Haus zu schaffen. Wahrscheinlich suchte sie Betten, Kleider und Wäsche zusammen – alles für eine Flucht. Gerdchen und Ille spielten in der Nähe mit ihren Puppen. Klein-Christa schlief drinnen in ihrem Bettchen. Wo war Willein?
„Ich bleibe hier!“
Da kam die Postfrau auf den Hof und übergab mir einen Brief. Nanu? Ein Schreiben vom Arbeitsamt Marienwerder:
Nachsatz: Bei Verspätung Ihrerseits könnte Ihre Eisenbahnstrecke nicht passierbar sein. Wir würden dann dafür sorgen, daß Sie von Königsberg aus mit dem ‚Seedienst Ostpreußen’ in Ihre Heimat gebracht werden.“
Da saß ich nun mit dem Blatt Papier in der einen und dem Putzlappen in der anderen Hand auf einer Kiste und begriff erst allmählich, was der Inhalt bedeutete: Sofort alles hinwerfen und nach Hause fahren. – Das ging doch nicht!
Ich konnte die Frau und ihre Kinder jetzt nicht alleinlassen. Gleich würde Krieg sein!
Ich hatte es nicht gemerkt, daß die kleinen Mädchen hergelaufen waren und mich anschauten. Augenblicklich stand auch die Bäuerin neben mir und nahm mir den Briefbogen aus der Hand. Sie las und stöhnte: „Was soll nun werden? Jetzt bin ich ganz allein!“
Die Kinder hatten gemerkt, daß hier etwas Schlimmes vor sich ging. Nun sprangen sie herum und jauchzten: „Die Erika bleibt hier!“
Einige Tage später kamen plötzlich Militärautos, Panzerwagen, Kriegsgerät auf den Hof gefahren. Soldaten waren geschäftig, liefen umher. Pferde wieherten, Lärm, Bewegung und Rufe. Unsere Kinder überall dazwischen, Jungen wie Mädchen. Sie hatten ihre große Zeit, wußten nichts vom Ernst der Lage. Auch wir beiden Frauen wurden von diesem Trubel aus der Bahn geworfen, mußten nur sehen, daß wir abends zur rechten Zeit das Vieh fütterten und die Kühe molken.
An den folgenden Tagen war Bewegung auf der Chaussee, die in geringer Entfernung am Gehöft entlangführte. Ununterbrochen zogen die Kolonnen der Soldaten vorbei in Richtung polnische Grenze bei Garnsee. Es war heiß in diesen Septembertagen, die Sonne brannte. Die Männer waren verstaubt und durstig. Die Kinder liefen an die Straße, schrien und winkten. „Kinder, bringt ihnen etwas zu trinken, sie haben Durst!“
Ende Oktober 1939 kam der Hofbesitzer Karl Gosda nach Hause. Ich fuhr nach einigen Tagen zu meinen Eltern nach Stolp zurück. Die „Erntehilfe“ war erfüllt, die Semesterferien neigten sich dem Ende zu.
Abschied vom Bauern, Abschied vom Hof
Polen war besiegt und besetzt. Die Bauern wurden heimgeschickt, damit sie ihr Land bestellten und ihr Vieh besorgten. Karl Gosda hat das nicht lange tun können. Er hatte sich in der Hitze der Tage und der Kälte der Herbstnächte bei dem Kriegsvormarsch erkältet und bald darauf eine Lungenentzündung zugezogen, die sich zur Schwindsucht ausweitete. Er starb im folgenden Jahr 1940, als sein ältester Sohn Horst noch ein Kind von elf Jahren und der Hoferbe Willi Gosda zehn Jahre alt war. Ein furchtbares Unglück, das die Familie traf. Wie sollte es auf dem Hof weitergehen?
Freundschaft über den Tod hinaus
Doch irgendwann entstand wieder eine Verbindung von Sachsen nach Thüringen und später ins Birkenfelder Land, wohin ich mich mit meiner Familie ein zweites Mal auf die Flucht begeben mußte. Die briefliche Verbindung blieb, und die Freundschaft dauerte bis zum Lebensende von Alma Gosda im Jahre 1986.
Doch die Geschichte dieser Freundschaft reichte über den Tod der Mutter hinaus. Die Gosda-Kinder vergaßen ihre Erika nicht. Ich glaube, das lag daran, daß die Mutter die Briefe ihres einstigen Studenten-Mädchens immer zum Lesen bereit legte, wenn die Kinder zu ihr zu Besuch kamen.
Ich wußte nichts davon. Ich erfuhr aus Almas Briefen wohl vom Ergehen und Schicksal ihrer Kinder. Aber ich hatte keine Vorstellung und kannte nicht das Land, in dem sie im äußersten Zipfel der DDR bei Görlitz lebten. Zudem war mein eigenes Leben mit Arbeit und Sorgen um meine Familie erfüllt. Es blieb wenig Zeit für Gedanken um das Leben der anderen. Doch die Wurzeln der Freundschaft lebten wohl im Verborgenen weiter und trieben plötzlich neue Blüten, als die Mauer zwischen Ost und West 1989 fiel – ein Geschenk der deutschen Einheit für uns!
Ilse – die „süße Illemaus“ von damals – hatte nach Mutters Tod die Verbindung nicht ganz abreißen lassen. Aber nun setzte sich Gerdchen – damals die „wilde Hummel“ – einfach in den Zug, fuhr die ganze Nacht hindurch und stand am Morgen in Idar-Oberstein auf dem Bahnhof. Würden wir uns wiedererkennen?
*) heute Czarne Dolne und Kwidzyn in Polen
Buchtipps

 Band 30. Unsere Heimat - unsere Geschichten. Wenn Erinnerungen lebendig werden. Rückblenden 1921 bis 1980
Band 30. Unsere Heimat - unsere Geschichten. Wenn Erinnerungen lebendig werden. Rückblenden 1921 bis 1980Zum Shop »
 Band 29. Als wir Räuber und Gendarm spielten. Erinnerungen von Kindern an ihre Spiele. 1930-1968
Band 29. Als wir Räuber und Gendarm spielten. Erinnerungen von Kindern an ihre Spiele. 1930-1968Zum Shop »