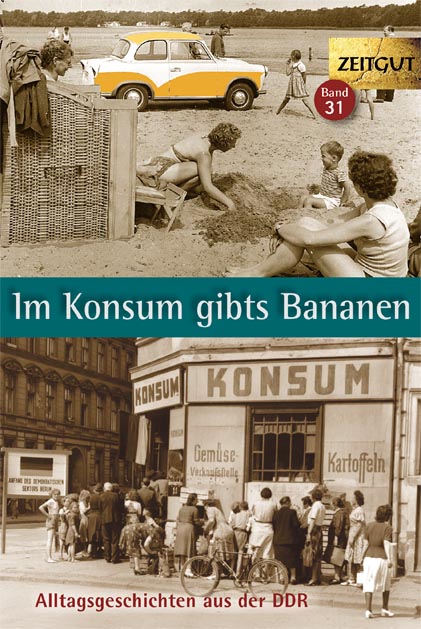Mein zweites Zuhause bei Oma und Opa
Zeitzeugen erinnern sich an ihre Großeltern
192 Seiten mit vielen Abbildungen, Ortsregister,
Taschenbuch, Euro 11,90
ISBN: 978-3-86614-274-9
Zeitgut Verlag, Berlin.
www.zeitgut.com
Cover downloaden »
(CMYK-Modus, 6cm breit)
Zeitzeugen erinnern sich an ihre Großeltern
192 Seiten mit vielen Abbildungen, Ortsregister,
Taschenbuch, Euro 11,90
ISBN: 978-3-86614-274-9
Zeitgut Verlag, Berlin.
www.zeitgut.com
Cover downloaden »
(CMYK-Modus, 6cm breit)
Pressetexte, Abbildungen, Abdrucktexte aus dem Buch
Mein zweites Zuhause bei Oma und Opa
Pressetext zum Buch (ca. 3.000 Zeichen) (PDF) »
Texte aus dem Buch zum kostenfreien Abdruck (PDF) »
Coverabbildung (jpg, 300 dpi, CMYK-Modus) »
Bitte informieren Sie uns, wenn Sie eine Veröffentlichung unserer Texte planen. / Für technische Probleme oder Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an i.hantke@zeitgut.com
Texte aus dem Buch zum kostenfreien Abdruck (PDF) »
Coverabbildung (jpg, 300 dpi, CMYK-Modus) »
Bitte informieren Sie uns, wenn Sie eine Veröffentlichung unserer Texte planen. / Für technische Probleme oder Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an i.hantke@zeitgut.com
Vier kostenfreie Abdrucktexte
Die folgenden Texte aus dem Buch stellen wir Ihnen gern zum kostenfreien Abdruck zur Verfügung. Als Gegenleistung erwarten wir von Ihnen lediglich die Veröffentlichung eines Quellen-Hinweises mit bibliografischen Daten (siehe links unter dem Titelbild) und einem kleinen Buchcover von mindestens 30 mm Breite.
Zudem bitten wir um ein Belegexemplar. Herzlichen Dank!
Zudem bitten wir um ein Belegexemplar. Herzlichen Dank!
Lisa Kraft
Opas Glück (2.656 Zeichen)
Hamburg-Eppendorf; 1980
Unser Opa rief an und berichtete begeistert von einem Schnäppchenkauf aus „zweiter Hand“. Endlich hatte er den langgesuchten Schreibschrank aus Holz – „gute deutsche Wertarbeit“ – gefunden.
Es lag schon viele Wochen zurück, als Opa wie gewohnt mit der Pfeife im Mund schmauchend in seinem Sessel saß und plötzlich vor versammelter Familie verkündete, daß er nun doch noch auf seine alten Tage etwas mehr Ordnung in sein Leben bringen wolle, wozu ihm ein schöner praktischer und geräumiger Schreibschrank eingefallen war. Wir waren uns alle einig, daß es für Ordnung ja nie zu spät sein kann und beglückwünschten ihn zu dieser Idee. Seine zahlreichen Pfeifen, Briefmarken, Fotoalben, Landkarten, Straßenpläne, Rätselhefte, Bankbelege, Brettspiele, diverse Aktenordner und Schallplatten würden in Zukunft endlich schneller auffindbar sein. Spontan sagten wir ihm jede Unterstützung beim Kauf zu, nicht im Geringsten ahnend, daß wir alsbald alle entsprechenden Angebote der Möbelgeschäfte und Kaufhäuser in der Umgebung in- und auswendig kennenlernen würden.
„Zu groß, zu klein, zu eckig, zu schlecht verarbeitet, zu teuer und doch wohl nur aus beschichteten Spanplatten“, so machte Opa jeglichen Kauf nach endloser Sucherei zunichte.
Nun jedoch sollten wir nur noch beim Transport helfen. Bereits einen Tag später ruhte besagter Schrank festgezurrt auf unserem Autodach, und ich saß zur Feier des Tages mit einer großen Torte neben meinem Mann, denn dieses Ereignis mußte gebührend gefeiert werden.
Opa fuhr mit seinem PKW voran, und es wäre auch alles perfekt verlaufen, wenn ihn sein Schreibschrank im Rückspiegel nicht doch etwas nervös gemacht hätte. An einer Ampel stoppte er unvergleichlich forsch, um dann sofort wieder scharf Gas zu geben. Mein Mann tat ihm Gleiches nach. Diese Aktion sorgte leider dafür, daß sich das „Schnäppchen“ zu verselbständigen begann, zunächst auf unserer Motorhaube landete, wie eine Papierschwalbe abhob, vor unser Auto segelte, um dann über die gesamte Kreuzung zu poltern!
Wir waren einfach sprachlos.
Bis heute habe ich nicht vergessen, wie peinlich es war, vor grinsendem Publikum den Schrank wieder zurückzuholen, aber wir bemerkten auch sofort erstaunt, daß das gute Stück nur ein paar kleine Kratzer aufwies, was ja wirklich für eine ausgezeichnete Qualität sprach. Ganz im Gegensatz zu meiner Torte, die im Fußraum gelandet, nicht mehr als solche zu erkennen war.
Für das zufriedene Schmunzeln unseres Opas, wenn er seinen Schrank besah, waren wir sofort entschlossen, die große Anzahl frischer Schrammen auf unserer Motorhaube in Kauf zu nehmen, eben für Opas Glück.
PDF »
Opas Glück (2.656 Zeichen)
Hamburg-Eppendorf; 1980
Unser Opa rief an und berichtete begeistert von einem Schnäppchenkauf aus „zweiter Hand“. Endlich hatte er den langgesuchten Schreibschrank aus Holz – „gute deutsche Wertarbeit“ – gefunden.
Es lag schon viele Wochen zurück, als Opa wie gewohnt mit der Pfeife im Mund schmauchend in seinem Sessel saß und plötzlich vor versammelter Familie verkündete, daß er nun doch noch auf seine alten Tage etwas mehr Ordnung in sein Leben bringen wolle, wozu ihm ein schöner praktischer und geräumiger Schreibschrank eingefallen war. Wir waren uns alle einig, daß es für Ordnung ja nie zu spät sein kann und beglückwünschten ihn zu dieser Idee. Seine zahlreichen Pfeifen, Briefmarken, Fotoalben, Landkarten, Straßenpläne, Rätselhefte, Bankbelege, Brettspiele, diverse Aktenordner und Schallplatten würden in Zukunft endlich schneller auffindbar sein. Spontan sagten wir ihm jede Unterstützung beim Kauf zu, nicht im Geringsten ahnend, daß wir alsbald alle entsprechenden Angebote der Möbelgeschäfte und Kaufhäuser in der Umgebung in- und auswendig kennenlernen würden.
„Zu groß, zu klein, zu eckig, zu schlecht verarbeitet, zu teuer und doch wohl nur aus beschichteten Spanplatten“, so machte Opa jeglichen Kauf nach endloser Sucherei zunichte.
Nun jedoch sollten wir nur noch beim Transport helfen. Bereits einen Tag später ruhte besagter Schrank festgezurrt auf unserem Autodach, und ich saß zur Feier des Tages mit einer großen Torte neben meinem Mann, denn dieses Ereignis mußte gebührend gefeiert werden.
Opa fuhr mit seinem PKW voran, und es wäre auch alles perfekt verlaufen, wenn ihn sein Schreibschrank im Rückspiegel nicht doch etwas nervös gemacht hätte. An einer Ampel stoppte er unvergleichlich forsch, um dann sofort wieder scharf Gas zu geben. Mein Mann tat ihm Gleiches nach. Diese Aktion sorgte leider dafür, daß sich das „Schnäppchen“ zu verselbständigen begann, zunächst auf unserer Motorhaube landete, wie eine Papierschwalbe abhob, vor unser Auto segelte, um dann über die gesamte Kreuzung zu poltern!
Wir waren einfach sprachlos.
Bis heute habe ich nicht vergessen, wie peinlich es war, vor grinsendem Publikum den Schrank wieder zurückzuholen, aber wir bemerkten auch sofort erstaunt, daß das gute Stück nur ein paar kleine Kratzer aufwies, was ja wirklich für eine ausgezeichnete Qualität sprach. Ganz im Gegensatz zu meiner Torte, die im Fußraum gelandet, nicht mehr als solche zu erkennen war.
Für das zufriedene Schmunzeln unseres Opas, wenn er seinen Schrank besah, waren wir sofort entschlossen, die große Anzahl frischer Schrammen auf unserer Motorhaube in Kauf zu nehmen, eben für Opas Glück.
PDF »
Liesel Hünichen
Bei Oma und Opa in Münster (gekürzt, 7.350 Zeichen)
Dülmen, Kreis Coesfeld –Münster, Westfalen; frühe 20er – 30er Jahre
Da ich im Jahre 1919 geboren bin, reichen meine ersten Erinnerungen sicherlich schon neunzig Jahre zurück. In der Zeit, als ich ein Kleinkind war, packten die Eltern ihre Kinder noch nicht ins Auto und fuhren mit ihnen an die See, ins Gebirge oder in andere Länder. Das wurde erst ein halbes Jahrhundert später modern. Und doch, meine Eltern waren schon so fortschrittlich, mit uns Kindern öfter zu verreisen. Wir waren unser drei, mein Bruder, meine kleine Schwester und ich. Zusammen fuhren wir immer zu Opa und Oma nach Münster. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, daß wir „ganz früher“ mit der Eisenbahn reisten, 3. Klasse. Es gab damals bei der Eisenbahn vier Klassen.
Und dann, etwa ab 1925, fuhren wir mit dem Auto, denn wir gehörten seit dieser Zeit zu den ersten zwanzig oder dreißig Einwohnern der Stadt Dülmen, die ein Auto besaßen. Außer uns erfreuten sich solch eines aufsehenerregenden modernen Fortbewegungsmittels nur noch die Textilfabrikanten, der „Eisenhütte-Vorstand“, die Ärzte der Stadt und Dr. Püttmann, der Tierarzt. Ein Studienrat mit drei Kindern, der Auto fuhr, geriet natürlich in einer Kleinstadt wie der unseren sofort in den Verdacht, größenwahnsinnig zu sein. Unser Modell war ein „Brennabor“, gebraucht gekauft, der zwar ein Viersitzer war, aber außer uns Geschwistern noch Platz für etliche unserer Spielkameraden bot. Mit diesem Wagen fuhren wir am Wochenende dreißig Kilometer zu den Großeltern nach Münster oder auch drei oder fünf Kilometer weiter an das beliebte Ausflugsziel der Münsteraner, die Werse.
Im Gegensatz zu meiner „kleinen Schwester“, die stets lautstarken Protest erhob, wenn sie sich von ihrer Mama einmal trennen sollte, war ich bei Oma und Opa, den Eltern meiner Mutter, in Münster ganz Zuhause. Ich fand es am schönsten, wenn Bruder Hansi und ich allein bei den Großeltern sein durften, hatte ich doch den Eindruck, Omas Liebling zu sein. Denn für mich, die ich als schlechter Esser galt, war es eine Wohltat, daß sie nie von mir erwartete, einen vollgefüllten Teller bis zum letzten Rest zu leeren. Und fettes Fleisch, dicke Bohnen oder andere Gerichte, die ich nicht mochte, brauchte ich bei ihr auch nicht zu essen. Bei Oma gab es Kuchen, auch mal ein Stück Schokolade oder einen Bonbon, Leckereien, die bei meinem strengen Vater auf der Verbotsliste standen. Aus heutiger Sicht ist allerdings nicht auszuschließen, daß die ungewöhnliche Tatsache meines noch mit siebzig Jahren absolut vollständigen Gebisses mit dem strengen väterlichen Bonbonverbot zusammenhing.
Faszination „Elektrische“
Übrigens war das, was sich mir als Klein- und Schulkind in Münster besonders eingeprägt hat, nicht die schöne Natur – die hatten wir auch zu Hause – sondern die „Sensationen“ der Großstadt. Zum Beispiel die „Elektrische“, die Straßenbahn, damals zur Unterscheidung der bis vor kurzem noch von Pferden gezogenen so genannt. Sie fuhr in Münster auf der Nordstraße direkt am Haus der Großeltern vorbei und hatte fünfzig Meter weiter ihre Endstation. Am Abend, wenn Hansi und ich im Vorderzimmer, das zur Straße hin lag, im Bett lagen, fiel ab und zu ein sehr heller Lichtschein durch die Gardinen auf unsere Betten, und kurz danach machte es „Ping, ping, ping!“. Wenn dann die Elektrische zurückfuhr, machte es wieder „Ping, ping, ping!“ und der Lichtschein strich durchs Zimmer und über die Decke. Noch viele Jahre später geisterte der geheimnisvolle Lichtschein durch meine Träume. Die Straßen waren damals im allgemeinen noch dunkel. Nur in der Nordstraße sah ich als Kind die ersten Straßenlaternen, die im Winter abends von einem Mann, der mit einer langen Stange von Laterne zu Laterne ging, angezündet wurden.
Beamtennachmittags-Ausflug
Mittwochs fuhren wir immer selbst mit der Bimmelbahn. Am „freien Beamtennachmittag“ hatten alle Beamten frei. Und da Opa das Städtische Meldeamt in Münster leitete, brauchte er auch nicht arbeiten. Bei gutem Wetter fuhren wir dann mit der Elektrischen durch die ganze Stadt bis zur Endstation Warendorferstraße, Oma und Opa und ich und später auch Hansi, mein jüngerer Bruder. Wir wanderten nach Handorf. In welcher der vielen gemütlichen Kaffeewirtschaften des Dorfes und am Ufer der Werse wir eingekehrt sind, will ich nicht aufzählen, doch mußte es eine Wirtschaft sein, die auch „Äppelkähne“ (die breiten gemütlichen Ruderboote) zu vermieten hatte. Denn das Kaffeetrinken mußte durch sportliche Rudertätigkeit verdient werden, fand Opa. Opa griff dann in die Ruder und trainierte jene Muskeln, die bei der halbstündigen Wanderung zu kurz gekommen waren. Später betätigten Hansi und ich uns am zweiten Ruder. Fleißig ruderten wir ein paar Windungen unseres Flüßchens ab, vorbei an romantischen Holzhäuschen von Münsteraner Wochenendhausbesitzern, Bootshäusern, Wiesen und Gärten. Dann machten wir eine große Kehrtwende und landeten am Anleger unserer Kaffeewirtschaft, wo wir uns am Ufer an einer der buntgedeckten Tische niederließen. Die „Großen“ tranken dann „Kaffee verkehrt“ (eine große Kanne Milch, eine kleine Kanne „echten“ starken Bohnenkaffee) und wir Kleinen manchmal auch statt der „gesunden“ Milch das Luxusgetränk unserer Kinderzeit Zitronenbrause.
Wir wanderten zurück entlang von Wallhecken, Wiesen mit Kühen und Pferden durch das „Boniburgwäldchen“ zur Bimmelbahn-Endstation Nordplatz. Vergnügt sang Opa manchmal noch ein paar Schlager seiner Zeit: „Meinste denn, meinste denn, du Berliner Pflanze“, „Wer hat den Käse zum Bahnhof gerollt?“, „Ausgerechnet Bananen“ oder auch was vom „Selleriesalat“, den ich auch nicht mochte.
Opa und der Zoo
Wenn Hansi und ich bei den Großeltern waren, schickte uns Oma mit Opa unweigerlich in den Zoo, wahrscheinlich, um ungestörte Zeit zum Kochen und Aufräumen zu haben. Opa war Mitglied der „Zoologischen Abendgesellschaft“ und besaß eine Familien-Jahreskarte für den Zoologischen Garten. Aus seiner Zeit der aktiven Mitgliedschaft auch in der Laienspielgruppe – zugunsten des Zoos – gab es Bilder im Fotoalbum. Nach dem Krieg habe ich sehr bedauert, daß sie neben anderem Opfer des Krieges geworden sind. Denn Opa Franz Lechtermann war ein guter Bekannter von Professor Hermann Landois, eines Münsteraner Originals und Gründer des Zoologischen Gartens. Ich kann mich noch heute an ein Foto einer Theateraufführung erinnern, auf der Opa mit Perücke – er hatte schon frühzeitig eine Glatze – und einem üppigen ausgestopften Busen zu sehen war, weil er eine „Damenrolle“ spielte. Wenn ich mich recht erinnere, wurden alle Rollen nur von Herren gespielt. Es muß sich immer um Lustspiele gehandelt haben. Meinen Opa konnte ich aber immer an seiner kräftigen, leicht gebogenen Nase erkennen. Die Fotos würden sicher heute bei meinen Enkeln, Opas Ururenkeln, helle Begeisterung erwecken, wenn ich sie noch hätte!
Aber wenigstens Landois’ Wohnsitz, die Tuckesburg, gibt es heute noch und sein Standbild, das er noch zu seinen Lebzeiten errichten ließ, wie Opa uns erzählte, und das er nie zu grüßen vergaß, wenn wir den Zoo besuchten.
Trotz unserer Dauerbesuche im Zoo denke ich noch heute an mein Gruseln beim Anblick des großen Löwen, der gerade seine Kinder aufgefressen hatte. Darüber war Opa vom Löwenwärter eingehend informiert worden, denn natürlich kannte er alle Tierpfleger persönlich.
PDF »
Bei Oma und Opa in Münster (gekürzt, 7.350 Zeichen)
Dülmen, Kreis Coesfeld –Münster, Westfalen; frühe 20er – 30er Jahre
Da ich im Jahre 1919 geboren bin, reichen meine ersten Erinnerungen sicherlich schon neunzig Jahre zurück. In der Zeit, als ich ein Kleinkind war, packten die Eltern ihre Kinder noch nicht ins Auto und fuhren mit ihnen an die See, ins Gebirge oder in andere Länder. Das wurde erst ein halbes Jahrhundert später modern. Und doch, meine Eltern waren schon so fortschrittlich, mit uns Kindern öfter zu verreisen. Wir waren unser drei, mein Bruder, meine kleine Schwester und ich. Zusammen fuhren wir immer zu Opa und Oma nach Münster. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, daß wir „ganz früher“ mit der Eisenbahn reisten, 3. Klasse. Es gab damals bei der Eisenbahn vier Klassen.
Und dann, etwa ab 1925, fuhren wir mit dem Auto, denn wir gehörten seit dieser Zeit zu den ersten zwanzig oder dreißig Einwohnern der Stadt Dülmen, die ein Auto besaßen. Außer uns erfreuten sich solch eines aufsehenerregenden modernen Fortbewegungsmittels nur noch die Textilfabrikanten, der „Eisenhütte-Vorstand“, die Ärzte der Stadt und Dr. Püttmann, der Tierarzt. Ein Studienrat mit drei Kindern, der Auto fuhr, geriet natürlich in einer Kleinstadt wie der unseren sofort in den Verdacht, größenwahnsinnig zu sein. Unser Modell war ein „Brennabor“, gebraucht gekauft, der zwar ein Viersitzer war, aber außer uns Geschwistern noch Platz für etliche unserer Spielkameraden bot. Mit diesem Wagen fuhren wir am Wochenende dreißig Kilometer zu den Großeltern nach Münster oder auch drei oder fünf Kilometer weiter an das beliebte Ausflugsziel der Münsteraner, die Werse.
Im Gegensatz zu meiner „kleinen Schwester“, die stets lautstarken Protest erhob, wenn sie sich von ihrer Mama einmal trennen sollte, war ich bei Oma und Opa, den Eltern meiner Mutter, in Münster ganz Zuhause. Ich fand es am schönsten, wenn Bruder Hansi und ich allein bei den Großeltern sein durften, hatte ich doch den Eindruck, Omas Liebling zu sein. Denn für mich, die ich als schlechter Esser galt, war es eine Wohltat, daß sie nie von mir erwartete, einen vollgefüllten Teller bis zum letzten Rest zu leeren. Und fettes Fleisch, dicke Bohnen oder andere Gerichte, die ich nicht mochte, brauchte ich bei ihr auch nicht zu essen. Bei Oma gab es Kuchen, auch mal ein Stück Schokolade oder einen Bonbon, Leckereien, die bei meinem strengen Vater auf der Verbotsliste standen. Aus heutiger Sicht ist allerdings nicht auszuschließen, daß die ungewöhnliche Tatsache meines noch mit siebzig Jahren absolut vollständigen Gebisses mit dem strengen väterlichen Bonbonverbot zusammenhing.
Faszination „Elektrische“
Übrigens war das, was sich mir als Klein- und Schulkind in Münster besonders eingeprägt hat, nicht die schöne Natur – die hatten wir auch zu Hause – sondern die „Sensationen“ der Großstadt. Zum Beispiel die „Elektrische“, die Straßenbahn, damals zur Unterscheidung der bis vor kurzem noch von Pferden gezogenen so genannt. Sie fuhr in Münster auf der Nordstraße direkt am Haus der Großeltern vorbei und hatte fünfzig Meter weiter ihre Endstation. Am Abend, wenn Hansi und ich im Vorderzimmer, das zur Straße hin lag, im Bett lagen, fiel ab und zu ein sehr heller Lichtschein durch die Gardinen auf unsere Betten, und kurz danach machte es „Ping, ping, ping!“. Wenn dann die Elektrische zurückfuhr, machte es wieder „Ping, ping, ping!“ und der Lichtschein strich durchs Zimmer und über die Decke. Noch viele Jahre später geisterte der geheimnisvolle Lichtschein durch meine Träume. Die Straßen waren damals im allgemeinen noch dunkel. Nur in der Nordstraße sah ich als Kind die ersten Straßenlaternen, die im Winter abends von einem Mann, der mit einer langen Stange von Laterne zu Laterne ging, angezündet wurden.
Beamtennachmittags-Ausflug
Mittwochs fuhren wir immer selbst mit der Bimmelbahn. Am „freien Beamtennachmittag“ hatten alle Beamten frei. Und da Opa das Städtische Meldeamt in Münster leitete, brauchte er auch nicht arbeiten. Bei gutem Wetter fuhren wir dann mit der Elektrischen durch die ganze Stadt bis zur Endstation Warendorferstraße, Oma und Opa und ich und später auch Hansi, mein jüngerer Bruder. Wir wanderten nach Handorf. In welcher der vielen gemütlichen Kaffeewirtschaften des Dorfes und am Ufer der Werse wir eingekehrt sind, will ich nicht aufzählen, doch mußte es eine Wirtschaft sein, die auch „Äppelkähne“ (die breiten gemütlichen Ruderboote) zu vermieten hatte. Denn das Kaffeetrinken mußte durch sportliche Rudertätigkeit verdient werden, fand Opa. Opa griff dann in die Ruder und trainierte jene Muskeln, die bei der halbstündigen Wanderung zu kurz gekommen waren. Später betätigten Hansi und ich uns am zweiten Ruder. Fleißig ruderten wir ein paar Windungen unseres Flüßchens ab, vorbei an romantischen Holzhäuschen von Münsteraner Wochenendhausbesitzern, Bootshäusern, Wiesen und Gärten. Dann machten wir eine große Kehrtwende und landeten am Anleger unserer Kaffeewirtschaft, wo wir uns am Ufer an einer der buntgedeckten Tische niederließen. Die „Großen“ tranken dann „Kaffee verkehrt“ (eine große Kanne Milch, eine kleine Kanne „echten“ starken Bohnenkaffee) und wir Kleinen manchmal auch statt der „gesunden“ Milch das Luxusgetränk unserer Kinderzeit Zitronenbrause.
Wir wanderten zurück entlang von Wallhecken, Wiesen mit Kühen und Pferden durch das „Boniburgwäldchen“ zur Bimmelbahn-Endstation Nordplatz. Vergnügt sang Opa manchmal noch ein paar Schlager seiner Zeit: „Meinste denn, meinste denn, du Berliner Pflanze“, „Wer hat den Käse zum Bahnhof gerollt?“, „Ausgerechnet Bananen“ oder auch was vom „Selleriesalat“, den ich auch nicht mochte.
Opa und der Zoo
Wenn Hansi und ich bei den Großeltern waren, schickte uns Oma mit Opa unweigerlich in den Zoo, wahrscheinlich, um ungestörte Zeit zum Kochen und Aufräumen zu haben. Opa war Mitglied der „Zoologischen Abendgesellschaft“ und besaß eine Familien-Jahreskarte für den Zoologischen Garten. Aus seiner Zeit der aktiven Mitgliedschaft auch in der Laienspielgruppe – zugunsten des Zoos – gab es Bilder im Fotoalbum. Nach dem Krieg habe ich sehr bedauert, daß sie neben anderem Opfer des Krieges geworden sind. Denn Opa Franz Lechtermann war ein guter Bekannter von Professor Hermann Landois, eines Münsteraner Originals und Gründer des Zoologischen Gartens. Ich kann mich noch heute an ein Foto einer Theateraufführung erinnern, auf der Opa mit Perücke – er hatte schon frühzeitig eine Glatze – und einem üppigen ausgestopften Busen zu sehen war, weil er eine „Damenrolle“ spielte. Wenn ich mich recht erinnere, wurden alle Rollen nur von Herren gespielt. Es muß sich immer um Lustspiele gehandelt haben. Meinen Opa konnte ich aber immer an seiner kräftigen, leicht gebogenen Nase erkennen. Die Fotos würden sicher heute bei meinen Enkeln, Opas Ururenkeln, helle Begeisterung erwecken, wenn ich sie noch hätte!
Aber wenigstens Landois’ Wohnsitz, die Tuckesburg, gibt es heute noch und sein Standbild, das er noch zu seinen Lebzeiten errichten ließ, wie Opa uns erzählte, und das er nie zu grüßen vergaß, wenn wir den Zoo besuchten.
Trotz unserer Dauerbesuche im Zoo denke ich noch heute an mein Gruseln beim Anblick des großen Löwen, der gerade seine Kinder aufgefressen hatte. Darüber war Opa vom Löwenwärter eingehend informiert worden, denn natürlich kannte er alle Tierpfleger persönlich.
PDF »
 Foto 300dpi »
Foto 300dpi »Unser Auto war ein „Brennabor“ und dunkelgrün. Die Marke, produziert in Brandenburg an der Havel, gibt es schon lange nicht mehr, sie ist irgendwann in der „Autounion“ aufgegangen.
Margrit Novak
Die Tafel Schokolade (3.459 Zeichen)
Jena, Thüringen; 1945
Die letzten Kriegstage waren überstanden, man begann, sich mit mehr oder weniger Zuversicht auf das Neue einzustellen: die Besatzungszeit. In Thüringen, und somit auch in meiner Heimatstadt Jena, zogen als Erste die Amerikaner ein. Ich war damals vier Jahre alt und ein aufgewecktes, blondlockiges Mädchen. Mein Vater galt als vermißt, und diese Tatsache schweißte die Familie in besonderer Weise zusammen. Der Kontakt zu den Großeltern väterlicherseits war sehr eng, zumal diese als Ausgebombte Hilfe und Zuwendung bitter nötig hatten. Großvater hatte sich mit einer einzigen Nähmaschine wieder die Grundlage für einen Broterwerb geschaffen und saß von früh bis spät in seiner Schneiderwerkstatt, meinem liebsten Aufenthalt. Dort gab es so wundervolle Sachen zu sehen, ich konnte mit Stoffresten, Garnrollen, Kleiderpuppe und vielem anderen hervorragend spielen, den Großvater aber auch an den Rand der Verzweiflung treiben, wenn ich ihm gar zu sehr ins Handwerk pfuschte. Besonders gern saß ich auf dem großen Bügelkissen, das auf dem riesigen Zuschneidetisch lag. Es war wie ein Ausguck, so hatte ich alles Interessante vor mir und in Reichweite und Großvater immer neben mir.
Eines Tages passierte etwas, woran ich mich noch sehr deutlich erinnere. Und dazu gab es eine Vorgeschichte. Für uns Kinder war der damalige Gruß „Heil Hitler!“ weder inhaltsträchtig noch von besonderer Bedeutung, es machte im Spiel einfach Spaß, diesen in strammer Haltung zu brüllen. Somit begriff auch ein vierjähriger Dreikäsehoch wie ich beim besten Willen nicht, warum er das nun plötzlich nicht mehr durfte. Meine Mutter mußte zu einem sehr harten Mittel greifen, um mir diese Unart abzugewöhnen. Sie zeigte mir im Keller eine leblose Maus, die ich tags zuvor noch hatte herumspringen sehen. Dabei machte sie mir klar, daß es mir ähnlich wie der Maus erginge, wenn ich diesen Gruß auch weiterhin anwende. Dieser Schock wirkte, ich war für immer geheilt. Den Beweis dafür trat ich an jenem denkwürdigen Tag in der Werkstatt von Großvater an, als ein Amerikaner, der sich die Uniform reparieren lassen wollte, hereintrat. Ich saß wie immer auf dem Bügelkissen und als niedlicher Anblick im direkten Blickfeld des Eingetretenen. Kaum hatte er in gebrochenem Deutsch seinen Wunsch vorgebracht, als er mich mit einem freundlichen Lachen aufforderte: „Sag mal ,Heil Hitler!’“
Ich saß regungslos da und schaute ihn an.
Er wiederholte seine Aufforderung mit dem gleichen Lachen – keine Reaktion meinerseits. Plötzlich holte er eine Tafel Schokolade aus der Tasche, hielt mir diese vor die Nase und forderte erneut: „Wenn du ,Heil Hitler!’ sagst, bekommst du diese Tafel Schokolade!“
Ich sah ihn an, dann die Tafel mit einer Kuh als Bild und sagte nichts. Mein Großvater stand bis dahin als stiller Beobachter daneben. Jetzt griff er ein, da er merkte, dem Amerikaner machte es Spaß, er wollte einfach mal hören, wie dieser anrüchige Gruß aus dem Mund eines solch niedlichen Popanzes klang. Doch auch sein gutes Zureden half nichts, ich machte den Mund nicht auf und – der Amerikaner steckte die Tafel Schokolade wieder ein und ging.
Ich sehe noch heute die Tränen in den Augen meines Großvaters, der nicht verstehen konnte, daß man einem Kind Schokolade vor die Nase hielt und sie dann wieder einsteckte. Ihm tat das sichtlich weh, mir überhaupt nicht, denn ich hatte nicht die geringste Ahnung, was Schokolade eigentlich war.
PDF »
Die Tafel Schokolade (3.459 Zeichen)
Jena, Thüringen; 1945
Die letzten Kriegstage waren überstanden, man begann, sich mit mehr oder weniger Zuversicht auf das Neue einzustellen: die Besatzungszeit. In Thüringen, und somit auch in meiner Heimatstadt Jena, zogen als Erste die Amerikaner ein. Ich war damals vier Jahre alt und ein aufgewecktes, blondlockiges Mädchen. Mein Vater galt als vermißt, und diese Tatsache schweißte die Familie in besonderer Weise zusammen. Der Kontakt zu den Großeltern väterlicherseits war sehr eng, zumal diese als Ausgebombte Hilfe und Zuwendung bitter nötig hatten. Großvater hatte sich mit einer einzigen Nähmaschine wieder die Grundlage für einen Broterwerb geschaffen und saß von früh bis spät in seiner Schneiderwerkstatt, meinem liebsten Aufenthalt. Dort gab es so wundervolle Sachen zu sehen, ich konnte mit Stoffresten, Garnrollen, Kleiderpuppe und vielem anderen hervorragend spielen, den Großvater aber auch an den Rand der Verzweiflung treiben, wenn ich ihm gar zu sehr ins Handwerk pfuschte. Besonders gern saß ich auf dem großen Bügelkissen, das auf dem riesigen Zuschneidetisch lag. Es war wie ein Ausguck, so hatte ich alles Interessante vor mir und in Reichweite und Großvater immer neben mir.
Eines Tages passierte etwas, woran ich mich noch sehr deutlich erinnere. Und dazu gab es eine Vorgeschichte. Für uns Kinder war der damalige Gruß „Heil Hitler!“ weder inhaltsträchtig noch von besonderer Bedeutung, es machte im Spiel einfach Spaß, diesen in strammer Haltung zu brüllen. Somit begriff auch ein vierjähriger Dreikäsehoch wie ich beim besten Willen nicht, warum er das nun plötzlich nicht mehr durfte. Meine Mutter mußte zu einem sehr harten Mittel greifen, um mir diese Unart abzugewöhnen. Sie zeigte mir im Keller eine leblose Maus, die ich tags zuvor noch hatte herumspringen sehen. Dabei machte sie mir klar, daß es mir ähnlich wie der Maus erginge, wenn ich diesen Gruß auch weiterhin anwende. Dieser Schock wirkte, ich war für immer geheilt. Den Beweis dafür trat ich an jenem denkwürdigen Tag in der Werkstatt von Großvater an, als ein Amerikaner, der sich die Uniform reparieren lassen wollte, hereintrat. Ich saß wie immer auf dem Bügelkissen und als niedlicher Anblick im direkten Blickfeld des Eingetretenen. Kaum hatte er in gebrochenem Deutsch seinen Wunsch vorgebracht, als er mich mit einem freundlichen Lachen aufforderte: „Sag mal ,Heil Hitler!’“
Ich saß regungslos da und schaute ihn an.
Er wiederholte seine Aufforderung mit dem gleichen Lachen – keine Reaktion meinerseits. Plötzlich holte er eine Tafel Schokolade aus der Tasche, hielt mir diese vor die Nase und forderte erneut: „Wenn du ,Heil Hitler!’ sagst, bekommst du diese Tafel Schokolade!“
Ich sah ihn an, dann die Tafel mit einer Kuh als Bild und sagte nichts. Mein Großvater stand bis dahin als stiller Beobachter daneben. Jetzt griff er ein, da er merkte, dem Amerikaner machte es Spaß, er wollte einfach mal hören, wie dieser anrüchige Gruß aus dem Mund eines solch niedlichen Popanzes klang. Doch auch sein gutes Zureden half nichts, ich machte den Mund nicht auf und – der Amerikaner steckte die Tafel Schokolade wieder ein und ging.
Ich sehe noch heute die Tränen in den Augen meines Großvaters, der nicht verstehen konnte, daß man einem Kind Schokolade vor die Nase hielt und sie dann wieder einsteckte. Ihm tat das sichtlich weh, mir überhaupt nicht, denn ich hatte nicht die geringste Ahnung, was Schokolade eigentlich war.
PDF »
Marlise vom Hof
Geburtstagsüberraschung für Oma (5.262 Zeichen)
Worms/Rhein, Rheinland-Pfalz – Lautertal im Odenwald, Hessen; 1959
Es war der 16. September des Jahres 1959, und meine Oma väterlicherseits hatte 80. Geburtstag. Den feierte sie im Kreise ihrer acht Kinder und deren Familien. Rechnete man Schwiegerkinder, Enkel und Urenkel dazu, kam man locker auf über dreißig Personen, die alle in ihrem Wohnzimmer irgendwie Platz fanden. Oma, als Patriarchin mittendrin, genoß solche Zusammenkünfte ungemein. So auch diesmal.
Zum Mittagessen gingen wir in ein Wirtshaus, um den großen Aufwand, den solch eine Feier mit sich bringt, so gering wie möglich zu halten. Es blieb noch genug Arbeit übrig für Töchter und Schwiegertöchter, die Kaffeetafel am Nachmittag in Omas Wohnzimmer festlich zu gestalten. Wenn dann der Abschied nahte, war das für Oma wie immer ein schmerzlicher Augenblick, glaubte sie doch, die in der Ferne lebenden Familienmitglieder bis Weihnachten nicht wiederzusehen. Völlig ahnungslos, dachte sie nicht im Traum daran, welch besonderes Geschenk sich die Familie noch für sie ausgedacht hatte. Wie sollte sie auch auf die Idee kommen, daß sie alle schon am folgenden Sonntag wiedersehen würde – noch dazu bei welcher Gelegenheit!
Allen war bekannt, daß Oma sich früher oft gewünscht hatte, das im Hessischen Odenwald liegende Felsenmeer einmal zu sehen und zu erklimmen. Vor dem Krieg ergab sich für sie dazu keine Möglichkeit, und in den ersten Aufbaujahren hatte niemand Zeit und Muße, mit Oma solch einen Ausflug zu unternehmen. In den letzten Jahren hatten sich meine Eltern, wie die meisten der Familie, ein eigenes Auto angeschafft. Sonntagsausflüge waren keine Seltenheit, sogar Urlaubsreisen leisteten wir uns. Aber inzwischen sprach Oma kaum noch vom Felsenmeer. Von einer Ersteigung der Felsberge gar hatte sie wegen ihres Alters und ihrer nicht mehr taufrischen Knochen ohnehin Abstand genommen.
Nun hatte aber Wochen vor Omas 80. Geburtstag bei meiner Tante Anna, Vaters Schwester, ein konspiratives Treffen der in der Nähe lebenden Geschwister stattgefunden, bei dem genau dieser Ausflug zum Felsenmeer mit Oma als geheimes Geburtstagsgeschenk beschlossen und besprochen wurde. Da ich mit Oma täglich zusammenkam – wir lebten ja im selben Haus – und sie von klein auf meine engste und liebste Vertraute war, fiel es mir unbeschreiblich schwer, das Geheimnis für mich zu behalten. Meine Eltern hatten mir aber klargemacht, daß es hier um eine große Sache ging und ich auf keinen Fall etwas verraten dürfte. Ich fieberte also dem kommenden Wochenende entgegen, an dem das Abenteuer stattfinden sollte.
Endlich war der Sonntag gekommen. Bereits am frühen Morgen trudelten die Tanten und Onkel, Cousinen und Cousins nach und nach ein und versammelten sich im Hof. Oma war „von den Socken“, wie man so sagt, ihre Lieben so unerwartet und schnell wiederzusehen. Noch immer total ahnungslos, folgte sie verwirrt den Bitten, sich festes Schuhwerk und robuste Kleidung anzuziehen. Die Aufregung stieg für mich fast ins Unermeßliche, weil Oma auf den Beifahrersitz ausgerechnet unseres Autos gehievt wurde, ich aber immer noch den Mund halten mußte. Für Oma vorn neben Vater war die beste Aussicht garantiert, Mutter und ich saßen hinten. Dann fuhr der Konvoi los. Vater steuerte stolz unseren neuen „Fiat“, unseren ersten fahrbaren Untersatz nach dem Krieg. Wie ich die einstündige Fahrt in den Odenwald überstand, ohne schier zu platzen, weiß ich heute nicht mehr.
An der Sohle des Felsenmeeres angekommen, dämmerte es Oma allmählich, was auf sie zukommen sollte. Alle stiegen aus ihren Autos, und dann ging der Spaß los. Das zunächst noch gemächliche Ausschreiten über sanft ansteigendes und stufiges Gelände ging schnell in eine schwierige Kletterei über, bei der wir Oma von hinten schoben und von vorne zogen, hoben und drückten. Oma war mit Feuereifer dabei und fügte sich willig allen Hilfestellungen der ganzen Familie, was mit viel Gelächter wegen der zum Teil lustigen Körperhaltungen einherging – ein großartiges Spektakel für alle. Wanderer, die uns auf unserem Aufstieg begegneten, hatten bestimmt noch lange was zu erzählen.
Endlich oben angekommen, wurden die mitgebrachten „Hasenbrote“ – so nannten wir die belegten Brote, die man unter freiem Himmel aß – und die Thermoskannen ausgepackt und sich erst einmal ordentlich gestärkt. Auch ein, zwei Schnäpschen genehmigten sich die Erwachsenen als Wegzehrung, bevor wir wieder aufbrachen. Der Abstieg verlief ähnlich lustig, wobei Oma erstaunliche Kondition bewies – lag's am Schnäpschen?
Objektiv besehen gar nicht ungefährlich, die Sache. So manchem Erwachsenen mögen unterwegs Bedenken gekommen sein. Selbst für uns wesentlich jüngere Generationen war das ein anstrengendes Unterfangen, aber es hat allen unglaublichen Spaß gemacht. Für Oma war es jedenfalls ein einmaliges Erlebnis, und für uns auch. Keiner der Beteiligten hat es je vergessen.
Heute frage ich mich, selbst schon 67 Jahre alt, inwiefern Oma damals gute Miene zum allerdings sehr gutgemeinten Spiel gemacht hat. Aber mit all ihren Lieben vereint zu sein, war ihr die Sache bestimmt wert. Leider hatte in der Aufregung keiner daran gedacht, einen Fotoapparat mitzunehmen, um dieses einzigartige familiäre Ereignis festzuhalten.
PDF »
Geburtstagsüberraschung für Oma (5.262 Zeichen)
Worms/Rhein, Rheinland-Pfalz – Lautertal im Odenwald, Hessen; 1959
Es war der 16. September des Jahres 1959, und meine Oma väterlicherseits hatte 80. Geburtstag. Den feierte sie im Kreise ihrer acht Kinder und deren Familien. Rechnete man Schwiegerkinder, Enkel und Urenkel dazu, kam man locker auf über dreißig Personen, die alle in ihrem Wohnzimmer irgendwie Platz fanden. Oma, als Patriarchin mittendrin, genoß solche Zusammenkünfte ungemein. So auch diesmal.
Zum Mittagessen gingen wir in ein Wirtshaus, um den großen Aufwand, den solch eine Feier mit sich bringt, so gering wie möglich zu halten. Es blieb noch genug Arbeit übrig für Töchter und Schwiegertöchter, die Kaffeetafel am Nachmittag in Omas Wohnzimmer festlich zu gestalten. Wenn dann der Abschied nahte, war das für Oma wie immer ein schmerzlicher Augenblick, glaubte sie doch, die in der Ferne lebenden Familienmitglieder bis Weihnachten nicht wiederzusehen. Völlig ahnungslos, dachte sie nicht im Traum daran, welch besonderes Geschenk sich die Familie noch für sie ausgedacht hatte. Wie sollte sie auch auf die Idee kommen, daß sie alle schon am folgenden Sonntag wiedersehen würde – noch dazu bei welcher Gelegenheit!
Allen war bekannt, daß Oma sich früher oft gewünscht hatte, das im Hessischen Odenwald liegende Felsenmeer einmal zu sehen und zu erklimmen. Vor dem Krieg ergab sich für sie dazu keine Möglichkeit, und in den ersten Aufbaujahren hatte niemand Zeit und Muße, mit Oma solch einen Ausflug zu unternehmen. In den letzten Jahren hatten sich meine Eltern, wie die meisten der Familie, ein eigenes Auto angeschafft. Sonntagsausflüge waren keine Seltenheit, sogar Urlaubsreisen leisteten wir uns. Aber inzwischen sprach Oma kaum noch vom Felsenmeer. Von einer Ersteigung der Felsberge gar hatte sie wegen ihres Alters und ihrer nicht mehr taufrischen Knochen ohnehin Abstand genommen.
Nun hatte aber Wochen vor Omas 80. Geburtstag bei meiner Tante Anna, Vaters Schwester, ein konspiratives Treffen der in der Nähe lebenden Geschwister stattgefunden, bei dem genau dieser Ausflug zum Felsenmeer mit Oma als geheimes Geburtstagsgeschenk beschlossen und besprochen wurde. Da ich mit Oma täglich zusammenkam – wir lebten ja im selben Haus – und sie von klein auf meine engste und liebste Vertraute war, fiel es mir unbeschreiblich schwer, das Geheimnis für mich zu behalten. Meine Eltern hatten mir aber klargemacht, daß es hier um eine große Sache ging und ich auf keinen Fall etwas verraten dürfte. Ich fieberte also dem kommenden Wochenende entgegen, an dem das Abenteuer stattfinden sollte.
Endlich war der Sonntag gekommen. Bereits am frühen Morgen trudelten die Tanten und Onkel, Cousinen und Cousins nach und nach ein und versammelten sich im Hof. Oma war „von den Socken“, wie man so sagt, ihre Lieben so unerwartet und schnell wiederzusehen. Noch immer total ahnungslos, folgte sie verwirrt den Bitten, sich festes Schuhwerk und robuste Kleidung anzuziehen. Die Aufregung stieg für mich fast ins Unermeßliche, weil Oma auf den Beifahrersitz ausgerechnet unseres Autos gehievt wurde, ich aber immer noch den Mund halten mußte. Für Oma vorn neben Vater war die beste Aussicht garantiert, Mutter und ich saßen hinten. Dann fuhr der Konvoi los. Vater steuerte stolz unseren neuen „Fiat“, unseren ersten fahrbaren Untersatz nach dem Krieg. Wie ich die einstündige Fahrt in den Odenwald überstand, ohne schier zu platzen, weiß ich heute nicht mehr.
An der Sohle des Felsenmeeres angekommen, dämmerte es Oma allmählich, was auf sie zukommen sollte. Alle stiegen aus ihren Autos, und dann ging der Spaß los. Das zunächst noch gemächliche Ausschreiten über sanft ansteigendes und stufiges Gelände ging schnell in eine schwierige Kletterei über, bei der wir Oma von hinten schoben und von vorne zogen, hoben und drückten. Oma war mit Feuereifer dabei und fügte sich willig allen Hilfestellungen der ganzen Familie, was mit viel Gelächter wegen der zum Teil lustigen Körperhaltungen einherging – ein großartiges Spektakel für alle. Wanderer, die uns auf unserem Aufstieg begegneten, hatten bestimmt noch lange was zu erzählen.
Endlich oben angekommen, wurden die mitgebrachten „Hasenbrote“ – so nannten wir die belegten Brote, die man unter freiem Himmel aß – und die Thermoskannen ausgepackt und sich erst einmal ordentlich gestärkt. Auch ein, zwei Schnäpschen genehmigten sich die Erwachsenen als Wegzehrung, bevor wir wieder aufbrachen. Der Abstieg verlief ähnlich lustig, wobei Oma erstaunliche Kondition bewies – lag's am Schnäpschen?
Objektiv besehen gar nicht ungefährlich, die Sache. So manchem Erwachsenen mögen unterwegs Bedenken gekommen sein. Selbst für uns wesentlich jüngere Generationen war das ein anstrengendes Unterfangen, aber es hat allen unglaublichen Spaß gemacht. Für Oma war es jedenfalls ein einmaliges Erlebnis, und für uns auch. Keiner der Beteiligten hat es je vergessen.
Heute frage ich mich, selbst schon 67 Jahre alt, inwiefern Oma damals gute Miene zum allerdings sehr gutgemeinten Spiel gemacht hat. Aber mit all ihren Lieben vereint zu sein, war ihr die Sache bestimmt wert. Leider hatte in der Aufregung keiner daran gedacht, einen Fotoapparat mitzunehmen, um dieses einzigartige familiäre Ereignis festzuhalten.
PDF »
 Foto 300dpi »
Foto 300dpi »Felslandschaft und ehemalige römische Werkplätze zur Steingewinnung prägen den Felsberg bei Lautertal-Reichenbach im Vorderen Odenwald. Das Felsenmeer ist auch heute ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer und Kletterer.
Weitere Abdrucktexte mit Erinnerungen finden Sie hier
Damals bei Oma und Opa (Band 1) »
Geborgen bei Oma und Opa (Band 2) »
Damals bei Oma und Opa (Band 1) »
Geborgen bei Oma und Opa (Band 2) »
Buchtipps

 Band 30. Unsere Heimat - unsere Geschichten. Wenn Erinnerungen lebendig werden. Rückblenden 1921 bis 1980
Band 30. Unsere Heimat - unsere Geschichten. Wenn Erinnerungen lebendig werden. Rückblenden 1921 bis 1980Zum Shop »
 Band 29. Als wir Räuber und Gendarm spielten. Erinnerungen von Kindern an ihre Spiele. 1930-1968
Band 29. Als wir Räuber und Gendarm spielten. Erinnerungen von Kindern an ihre Spiele. 1930-1968Zum Shop »