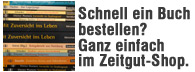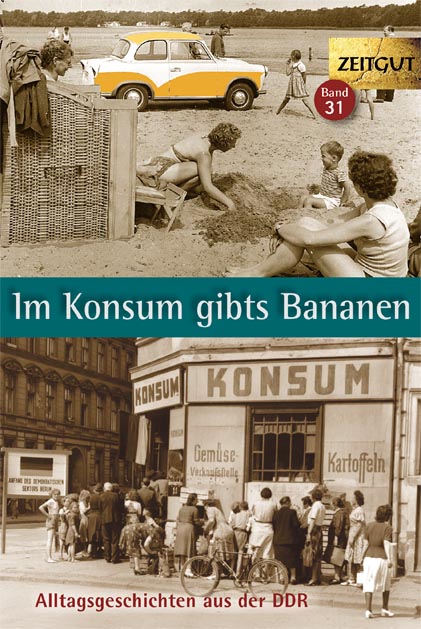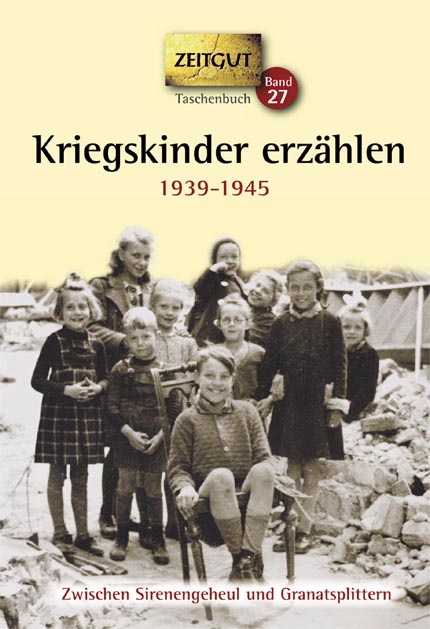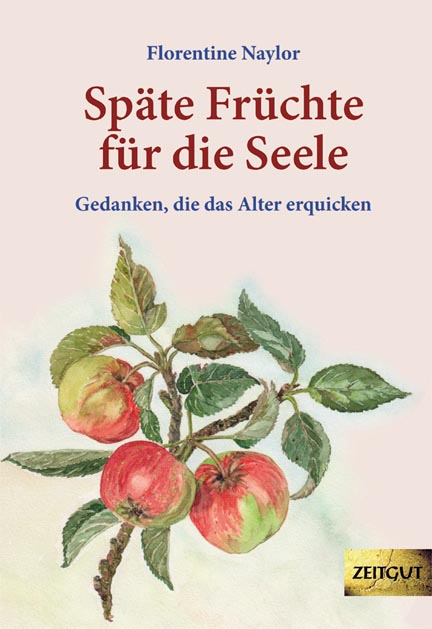Wo morgens der Hahn kräht. Band 1
Unvergessene Dorfgeschichten 1914 -1945.
180 Seiten mit vielen Abbildungen
Zeitgut Verlag, Berlin.
Auswahl-Taschenbuch
ISBN 978-3-86614-118-6
Unvergessene Dorfgeschichten 1914 -1945.
180 Seiten mit vielen Abbildungen
Zeitgut Verlag, Berlin.
Auswahl-Taschenbuch
ISBN 978-3-86614-118-6
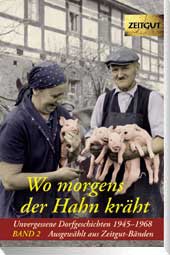
Wo morgens der Hahn kräht. Band 2
Unvergessene Dorfgeschichten 1945-1968.
180 Seiten mit vielen Abbildungen
Zeitgut Verlag, Berlin.
Auswahl-Taschenbuch
ISBN 978-3-86614-119-3
Unvergessene Dorfgeschichten 1945-1968.
180 Seiten mit vielen Abbildungen
Zeitgut Verlag, Berlin.
Auswahl-Taschenbuch
ISBN 978-3-86614-119-3
Unvergessene Dorfgeschichten
Neun kostenfreie Abdrucktexte
(Kürzungen sind mit einem Hinweis möglich)
2 Dorfgeschichten aus Bayern und Baden-Württemberg (siehe unten)
aus Wo morgens der Hahn kräht
3 Dorfgeschichten aus Niedersachsen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen »
aus Wir Kinder vom Lande
4 Dorfgeschichten aus Bayern (2), Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen »
aus Barfuß übers Stoppelfeld
aus Wo morgens der Hahn kräht
3 Dorfgeschichten aus Niedersachsen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen »
aus Wir Kinder vom Lande
4 Dorfgeschichten aus Bayern (2), Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen »
aus Barfuß übers Stoppelfeld
Die folgenden Texte stellen wir Ihnen gern zum kostenfreien Abdruck zur Verfügung. Als Gegenleistung erwarten wir von Ihnen lediglich die Veröffentlichung eines Quellen-Hinweises mit bibliografischen Daten (siehe links) und einem kleinen Buchcover von mindestens 30 mm Breite. Zudem bitten wir um ein Belegexemplar. Herzlichen Dank!
________________
Einen Pressetext zu den Dorfgeschichten finden Sie hier »
Bitte informieren Sie uns, wenn Sie eine Veröffentlichung unserer Texte planen. Die Fotos in Druckqualität senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu. E-Mail: info@zeitgut.com
________________
Einen Pressetext zu den Dorfgeschichten finden Sie hier »
Bitte informieren Sie uns, wenn Sie eine Veröffentlichung unserer Texte planen. Die Fotos in Druckqualität senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu. E-Mail: info@zeitgut.com
Band 1. Wo morgens der Hahn kräht
 Lammzeit (5.100 Zeichen)
Lammzeit (5.100 Zeichen)Geschichte von Erika Summ (gekürzte Fassung) aus den 1920er Jahren.
Stachenhausen bei Künzelau im Hohenloher Land in Baden-Württemberg
PDF »
(Diese PDF-Fassung ist nicht gekürzt - 6.729 Zeichen)
 Foto zum Text.
Foto zum Text.In der Dorfmitte von Stachenhausen wurden die Pferde getränkt.
Stachenhausen (jpeg, 300 dpi) »
 Foto zum Text.
Foto zum Text.Die Schafschwemme im Frühjahr war eine Tortur für Mensch und Tier.
Schafschwemme (jpeg, 300 dpi) »
Stachenhausen
liegt in einer sanften Mulde auf der Hohenloher Ebene. Von mehreren Seiten
drückt Quellwasser herein, durch das Dorf murmeln zwei Bäche. Darin fanden wir
Kinder vieles zum Spielen, zum Beispiel bunte Scherben von zerschlagenen
Schüsseln oder Krügen aus Keramik oder Porzellan. Manches wurde damals im Bach
entsorgt; einer floß direkt hinter unserer Scheune vorbei. Rechts und links
der Wasserläufe lagen die Bauernhäuser mit ihren großen Ställen und dem vielen
Ackergerät auf den Höfen. Mitten im Dorf stand auch ein großer Brunnen, an dem
die Pferde getränkt wurden.
Wenn die Schafe im Winter Wasser brauchten, zog Vater mit seiner Herde hinunter zum Bach. Er schlug, wenn alles zugefroren war, einige Löcher ins Eis und tränkte seine Tiere. Die Hunde waren immer dabei. Hatten die Schafe genug Wasser getrunken, ging es wieder heimwärts. Dabei hieß es für den Schäfer gut aufzupassen, damit kein Dauerlauf einsetzte, denn jedes Tier wollte zuerst an der Krippe sein. Die Futterraufen befanden sich außen an den Stallwänden. Auch in der Mitte stand eine, die den hungrigen Mäulern von zwei Seiten Platz bot. Dann folgte ein Drängen und Puffen und Stoßen und Boxen, bis jedes Schaf seine Portion Heu ergattert hatte und satt war. Nach einer Stunde hörte man nur noch leises Wiederkäuen. Viele Tiere lagen dann zu frieden in der zuvor erneuerten Streu. Die Schafe brauchten auch Salz, und so hatte Vater im Hof lange Tröge aufgestellt, in die einmal wöchentlich Viehsalz eingestreut wurde.
Die kritischste Jahreszeit war der Frühling. Dann begann die Lammzeit und damit waren auch zu Hause mehr Tiere zu versorgen. In den ersten Tagen nach der Geburt ließ man die kleinen Lämmchen im warmen Stall im Stroh, bis sie fest auf den Beinen stehen konnten. Aber dann mußten die Mutterschafe wieder hinaus, da der Stallmist ihren Klauen nicht gut bekam. Wenn ein Schaf trotzdem an der Mauke, einer Hautentzündung, erkrankte, fiel noch mehr Arbeit an, zum Beispiel Wasser holen zum Tränken.
Häufig kam es vor, daß ein Schaf ein Junges verlor. Dann versuchte man, von einem Zwillingspaar ein Lämmchen der Mutter wegzunehmen und dem anderen Schaf zuzuführen. Bis dieses jedoch das fremde Jungtier annahm, konnten Tage vergehen. Mein Bruder Karl war dabei ein guter Beobachter. Er fand schnell und mit dem richtigen Gespür Muttertier und Junges zusammen. Jedes Lämmchen hatte seinen eigenen Geruch. Deshalb band man den „Adoptiv-Lämmern“ die Felle der Totgeborenen auf, wodurch der Geruch weitergegeben und die neue Verbindung beschleunigt wurde.
Wenn die Wiesen wieder grün wurden, ging es auf Wanderschaft zur Sommerweide. Dann zog der Schäfer mit seinen Schafen in eine entferntere Gegend. Von Ende April bis November war Vater mit der Herde in Cröffelbach. Die Leute dort erzählten uns, der Schäfer singe so schön bei seinen Schafen, es klinge immer so friedlich durch das Tal. Am Abend wurde Vater dann bei den Familien umliegender Höfe verköstigt, deren Äcker und Wiesen er durch das Pferchen gedüngt hatte. Zudem erhielt er von den Bauern Pferchgeld, mußten diese den frei Haus gelieferten Dünger doch nur noch unterpflügen. Zu zahlen hatte der Schäfer allerdings Weidegeld an die Gemeinde, damit er deren Wege und Raine abweiden durfte. Der Schafstall stand am Ortsrand. Im Sommer schlief Vater aber im Schäferkarren, und die Hunde lagen davor und bewachten den Hirten und seine Herde.
Eine Woche vor der Schafschur Ende Mai stand die große Schafschwemme an. Bevor die Schafe von ihrem Winterkleid befreit wurden, mußten sie gründlich gewaschen werden. Da hatte das Wetter gut zu sein, damit die Wolle am Tier bis zur Schur wieder trocknen konnte. Das war eine Plackerei: Schafe, Hunde und die Schäfer mit Helfern waren heilfroh, wenn diese Tortur vorüber war. Die Herde verhielt sich danach ziemlich unruhig und es dauerte einige Zeit, bis wieder Ordnung in Stall oder Pferch einkehrte.
Nach der Schwemme wurden die Schafe geschoren. Dafür richtete man extra eine Scheune her. Mittels großer Spezialscheren schnitten acht bis zehn Frauen die dicke Wolle herunter, meist halfen ein paar junge Männer beim Auftragen der Tiere. Die Arbeiter waren mindestens zwei Tage auf dem Hof. Und wieder waren alle froh, wenn es vorbei war. Sicher auch die Schafe selbst. Sie sahen danach ganz nackt aus und waren verstört.
Die Wolle wurde gebunden und von der Wollverwertung bei der Wollauktion in Ulm verkauft. Dort konnte man sich Strumpfwolle und gute Wollstoffe bestellen und liefern lassen. Zur Inflationszeit klappte das nicht mehr. Wenn Vater Wolle verkauft hatte und erst am nächsten Tag den steilen Berg mit dem Rad nach Künzelsau hinunterfuhr, reichte das Geld oft kaum noch für ein Paar Kinderschuhe oder einen großen Zuckerhut. Von dem schlugen wir sehr sparsam kleine Stücke ab, viel später erst konnte man Würfelzucker kaufen. Der Preis für Schafwolle war so niedrig, daß der Erlös kaum für den Lebensunterhalt einer Familie reichte. Zum Glück war wenigstens die Versorgung mit eigenem Fleisch gesichert.
Aus: "Wo morgens der Hahn kräht". Band1. Quelle: Erika Summ, „Schäfers Tochter. Die Geschichte der Frontschwester Erika Summ.“ Sammlung der Zeitzeugen Band 55, Zeitgut Verlag 2006.
Wenn die Schafe im Winter Wasser brauchten, zog Vater mit seiner Herde hinunter zum Bach. Er schlug, wenn alles zugefroren war, einige Löcher ins Eis und tränkte seine Tiere. Die Hunde waren immer dabei. Hatten die Schafe genug Wasser getrunken, ging es wieder heimwärts. Dabei hieß es für den Schäfer gut aufzupassen, damit kein Dauerlauf einsetzte, denn jedes Tier wollte zuerst an der Krippe sein. Die Futterraufen befanden sich außen an den Stallwänden. Auch in der Mitte stand eine, die den hungrigen Mäulern von zwei Seiten Platz bot. Dann folgte ein Drängen und Puffen und Stoßen und Boxen, bis jedes Schaf seine Portion Heu ergattert hatte und satt war. Nach einer Stunde hörte man nur noch leises Wiederkäuen. Viele Tiere lagen dann zu frieden in der zuvor erneuerten Streu. Die Schafe brauchten auch Salz, und so hatte Vater im Hof lange Tröge aufgestellt, in die einmal wöchentlich Viehsalz eingestreut wurde.
Die kritischste Jahreszeit war der Frühling. Dann begann die Lammzeit und damit waren auch zu Hause mehr Tiere zu versorgen. In den ersten Tagen nach der Geburt ließ man die kleinen Lämmchen im warmen Stall im Stroh, bis sie fest auf den Beinen stehen konnten. Aber dann mußten die Mutterschafe wieder hinaus, da der Stallmist ihren Klauen nicht gut bekam. Wenn ein Schaf trotzdem an der Mauke, einer Hautentzündung, erkrankte, fiel noch mehr Arbeit an, zum Beispiel Wasser holen zum Tränken.
Häufig kam es vor, daß ein Schaf ein Junges verlor. Dann versuchte man, von einem Zwillingspaar ein Lämmchen der Mutter wegzunehmen und dem anderen Schaf zuzuführen. Bis dieses jedoch das fremde Jungtier annahm, konnten Tage vergehen. Mein Bruder Karl war dabei ein guter Beobachter. Er fand schnell und mit dem richtigen Gespür Muttertier und Junges zusammen. Jedes Lämmchen hatte seinen eigenen Geruch. Deshalb band man den „Adoptiv-Lämmern“ die Felle der Totgeborenen auf, wodurch der Geruch weitergegeben und die neue Verbindung beschleunigt wurde.
Wenn die Wiesen wieder grün wurden, ging es auf Wanderschaft zur Sommerweide. Dann zog der Schäfer mit seinen Schafen in eine entferntere Gegend. Von Ende April bis November war Vater mit der Herde in Cröffelbach. Die Leute dort erzählten uns, der Schäfer singe so schön bei seinen Schafen, es klinge immer so friedlich durch das Tal. Am Abend wurde Vater dann bei den Familien umliegender Höfe verköstigt, deren Äcker und Wiesen er durch das Pferchen gedüngt hatte. Zudem erhielt er von den Bauern Pferchgeld, mußten diese den frei Haus gelieferten Dünger doch nur noch unterpflügen. Zu zahlen hatte der Schäfer allerdings Weidegeld an die Gemeinde, damit er deren Wege und Raine abweiden durfte. Der Schafstall stand am Ortsrand. Im Sommer schlief Vater aber im Schäferkarren, und die Hunde lagen davor und bewachten den Hirten und seine Herde.
Eine Woche vor der Schafschur Ende Mai stand die große Schafschwemme an. Bevor die Schafe von ihrem Winterkleid befreit wurden, mußten sie gründlich gewaschen werden. Da hatte das Wetter gut zu sein, damit die Wolle am Tier bis zur Schur wieder trocknen konnte. Das war eine Plackerei: Schafe, Hunde und die Schäfer mit Helfern waren heilfroh, wenn diese Tortur vorüber war. Die Herde verhielt sich danach ziemlich unruhig und es dauerte einige Zeit, bis wieder Ordnung in Stall oder Pferch einkehrte.
Nach der Schwemme wurden die Schafe geschoren. Dafür richtete man extra eine Scheune her. Mittels großer Spezialscheren schnitten acht bis zehn Frauen die dicke Wolle herunter, meist halfen ein paar junge Männer beim Auftragen der Tiere. Die Arbeiter waren mindestens zwei Tage auf dem Hof. Und wieder waren alle froh, wenn es vorbei war. Sicher auch die Schafe selbst. Sie sahen danach ganz nackt aus und waren verstört.
Die Wolle wurde gebunden und von der Wollverwertung bei der Wollauktion in Ulm verkauft. Dort konnte man sich Strumpfwolle und gute Wollstoffe bestellen und liefern lassen. Zur Inflationszeit klappte das nicht mehr. Wenn Vater Wolle verkauft hatte und erst am nächsten Tag den steilen Berg mit dem Rad nach Künzelsau hinunterfuhr, reichte das Geld oft kaum noch für ein Paar Kinderschuhe oder einen großen Zuckerhut. Von dem schlugen wir sehr sparsam kleine Stücke ab, viel später erst konnte man Würfelzucker kaufen. Der Preis für Schafwolle war so niedrig, daß der Erlös kaum für den Lebensunterhalt einer Familie reichte. Zum Glück war wenigstens die Versorgung mit eigenem Fleisch gesichert.
Aus: "Wo morgens der Hahn kräht". Band1. Quelle: Erika Summ, „Schäfers Tochter. Die Geschichte der Frontschwester Erika Summ.“ Sammlung der Zeitzeugen Band 55, Zeitgut Verlag 2006.
Band 2. Wo morgens der Hahn kräht
 Der elektrische Weidezaun (3.999 Zeichen)
Der elektrische Weidezaun (3.999 Zeichen)Geschichte von Georg Hörmann aus dem Jahr 1953
Neuburg/Kammel in Bayern
PDF »
„Büable,
morga nachmittag brauscht nit Küah hüata, denn bis dau na han i mein
elektrischa Zau fertig“, rief mir mein Onkel, freudig erregt entgegen, als ich
mittags, von der Schule kommend, an seinem Bauernhof vorbeilief.
Das war mit gerade recht, so konnte ich mit meinen Freunden am Kammelwehr zum Baden gehen. Mein Onkel hatte eine kleine Landwirtschaft, und in den Sommermonaten hütete ich seine Kühe gegen ein willkommenes Trinkgeld öfters auf der Weide.
Es war in den 50er Jahren, als in meiner Heimat die ersten elektrischen Weidezäune aufkamen. Zu einer solchen Anlage gehörten spezielle Batterien, das entsprechende Gerät für die Umwandlung des Batteriestroms in deutliche spürbare Stromschläge, Draht für die Stromleitung um die Wiese und Pfähle oder eiserne Pflöcke mit isolierten Drahthaltern. Natürlich war das alles nicht ganz billig, so daß die Anschaffung für einen sparsamen schwäbischen Bauern mit einigen inneren Widerständen verbunden war.
Mein Onkel, der bekannt für seine Basteleien war, hatte sich bei der BayWa*) die neue Erfindung angeschaut und nach kurzem Überlegen entschlossen, den Elektrozaun selbst nachzubauen. „Dös wär ja no schöner, wenn i dös net nabringa dät“, sagte er zu seiner Frau, „onsra Wiesn isch ja glei henterm Stall, do brauch i doch koi duira Batterie kaufa, wenn i da Strom glei aus der Steckdos von der Melkkammer nemma ka.“
Gesagt, getan! In die Pfähle des alten Stacheldrahtzaunes drehte er vorschriftsmäßig Stifte mit isolierten Haken und zog einen dünnen Draht, diesen um die Stifte wickelnd, von Pfahl zu Pfahl um die Wiese. Für die letzten 20 Meter von der Wiese über den Hof bis zur Melkkammer verwendete er eine isolierte Leitung, weil ja diese, auf dem Boden liegend, sonst den Strom ins Erdreich abgeleitet hätte. Er klemmte die Drahtenden in einen Stecker und drückte ihn in die Steckdose. Der Weidedraht stand unter Strom!
Da er sich schon dachte, daß der Haushaltsstrom etwas stärker sein könnte als der offizielle Batteriestrom, versäumte er nicht, an der Seite zum Nachbargrundstück noch ein Schild mit der Aufschrift
„Vorsicht – Elektrozaun – Lebensgefahr!“
an einen Pfahl zu hängen.
„Rosa, laß die Küah raus, dr Zau isch fertig!“, rief er seiner Frau im Stall zu.
Diese öffnete die Tür und schnell eilten die hungrigen Kühe nach der abendlichen Melkzeit der Wiese zu. Der Bauer schloß die Stangen zum Wieseneingang und blickte stolz und erwartungsvoll auf sein Werk.
Inzwischen erreichte die erste Kuh den Zaun. Sie streckte den Kopf unter dem Elektrodraht zu den saftigen Grasbüscheln der Nachbarwiese und berührte mit dem Nacken den geladenen Draht. Wie vom Blitz getroffen fiel sie um, wobei sich der Draht im Gehörn verfing. Eine zweite Kuh, erstaunt über die im Gras liegende Genossin, schnupperte neugierig an dieser, berührte sie kurz mit ihrem Maul und wurde schlagartig, wild mit den ausgestreckten Beinen zuckend, umgeworfen.
Der Bauer starrte zunächst wie gelähmt auf die Geschehnisse, sprang dann auf die Wiese, um die regungslos am Boden liegenden Kühe vom Zaun wegzuziehen. Er packte den Kopf der zweiten Kuh, der auf dem Bauch der ersten lag, und – stürzte augenblicklich ebenfalls zu Boden, wo er bewußtlos liegenblieb.
Inzwischen war auch seine Frau, die ihrem Mann vergeblich vor dieser Elektrobastelei gewarnt hatte, aus dem Stall gekommen und sah das Unglück. Schnell entschlossen zog sie, die Ursache erkennend, den Stecker der elektrischen Leitung aus der Dose und näherte sich den auf der Wiese liegenden Geschöpfen. Da schlug der Bauer langsam wieder seine Augen auf. Allmählich erholte er sich von seiner Bewußtlosigkeit, blickte um sich und sah das Ergebnis seiner Sparsamkeit: zwei tote Kühe!
Zu seiner Frau aber sagte er: „Rosa, i glaub, meine Gommistiefel, dia du mir zum Namenstag gschenkt hast, hand mir’s Leba grettat.“
Wenn man den Wert einer Kuh in der damaligen Zeit bedenkt – das Fleisch konnte nur noch für einen Spottpreis auf der Freibank verkauft werden – hatte sich das Sprichwort wieder einmal bewahrheitet: „Jeder Sparer hat seinen Zehrer.“ Die Bauernbuben vom Dorf aber dichteten:
Salomon der Weise spricht:
Kühe hüten mag ich nicht!
Darum muß der Starkstrom her,
und gescheh’n ist das Malheur:
Ja, die Kuh lag schon am Boden,
er muß den Metzger Gottfried holen.
Damit war bei meinem Onkel die moderne Technik vorerst gestoppt und ich konnte als Hütebub wieder ein paar Mark verdienen.
*) Bayerische Warenhandelsgesellschaft, seit 1923, ursprünglich nur für Waren und Zubehör für die Landwirtschaft.
Aus Wo morgens der Hahn kräht. Band 2.
Quelle: „Lebertran und Chewing Gum“, Reihe ZEITGUT, Band 14
Das war mit gerade recht, so konnte ich mit meinen Freunden am Kammelwehr zum Baden gehen. Mein Onkel hatte eine kleine Landwirtschaft, und in den Sommermonaten hütete ich seine Kühe gegen ein willkommenes Trinkgeld öfters auf der Weide.
Es war in den 50er Jahren, als in meiner Heimat die ersten elektrischen Weidezäune aufkamen. Zu einer solchen Anlage gehörten spezielle Batterien, das entsprechende Gerät für die Umwandlung des Batteriestroms in deutliche spürbare Stromschläge, Draht für die Stromleitung um die Wiese und Pfähle oder eiserne Pflöcke mit isolierten Drahthaltern. Natürlich war das alles nicht ganz billig, so daß die Anschaffung für einen sparsamen schwäbischen Bauern mit einigen inneren Widerständen verbunden war.
Mein Onkel, der bekannt für seine Basteleien war, hatte sich bei der BayWa*) die neue Erfindung angeschaut und nach kurzem Überlegen entschlossen, den Elektrozaun selbst nachzubauen. „Dös wär ja no schöner, wenn i dös net nabringa dät“, sagte er zu seiner Frau, „onsra Wiesn isch ja glei henterm Stall, do brauch i doch koi duira Batterie kaufa, wenn i da Strom glei aus der Steckdos von der Melkkammer nemma ka.“
Gesagt, getan! In die Pfähle des alten Stacheldrahtzaunes drehte er vorschriftsmäßig Stifte mit isolierten Haken und zog einen dünnen Draht, diesen um die Stifte wickelnd, von Pfahl zu Pfahl um die Wiese. Für die letzten 20 Meter von der Wiese über den Hof bis zur Melkkammer verwendete er eine isolierte Leitung, weil ja diese, auf dem Boden liegend, sonst den Strom ins Erdreich abgeleitet hätte. Er klemmte die Drahtenden in einen Stecker und drückte ihn in die Steckdose. Der Weidedraht stand unter Strom!
Da er sich schon dachte, daß der Haushaltsstrom etwas stärker sein könnte als der offizielle Batteriestrom, versäumte er nicht, an der Seite zum Nachbargrundstück noch ein Schild mit der Aufschrift
„Vorsicht – Elektrozaun – Lebensgefahr!“
an einen Pfahl zu hängen.
„Rosa, laß die Küah raus, dr Zau isch fertig!“, rief er seiner Frau im Stall zu.
Diese öffnete die Tür und schnell eilten die hungrigen Kühe nach der abendlichen Melkzeit der Wiese zu. Der Bauer schloß die Stangen zum Wieseneingang und blickte stolz und erwartungsvoll auf sein Werk.
Inzwischen erreichte die erste Kuh den Zaun. Sie streckte den Kopf unter dem Elektrodraht zu den saftigen Grasbüscheln der Nachbarwiese und berührte mit dem Nacken den geladenen Draht. Wie vom Blitz getroffen fiel sie um, wobei sich der Draht im Gehörn verfing. Eine zweite Kuh, erstaunt über die im Gras liegende Genossin, schnupperte neugierig an dieser, berührte sie kurz mit ihrem Maul und wurde schlagartig, wild mit den ausgestreckten Beinen zuckend, umgeworfen.
Der Bauer starrte zunächst wie gelähmt auf die Geschehnisse, sprang dann auf die Wiese, um die regungslos am Boden liegenden Kühe vom Zaun wegzuziehen. Er packte den Kopf der zweiten Kuh, der auf dem Bauch der ersten lag, und – stürzte augenblicklich ebenfalls zu Boden, wo er bewußtlos liegenblieb.
Inzwischen war auch seine Frau, die ihrem Mann vergeblich vor dieser Elektrobastelei gewarnt hatte, aus dem Stall gekommen und sah das Unglück. Schnell entschlossen zog sie, die Ursache erkennend, den Stecker der elektrischen Leitung aus der Dose und näherte sich den auf der Wiese liegenden Geschöpfen. Da schlug der Bauer langsam wieder seine Augen auf. Allmählich erholte er sich von seiner Bewußtlosigkeit, blickte um sich und sah das Ergebnis seiner Sparsamkeit: zwei tote Kühe!
Zu seiner Frau aber sagte er: „Rosa, i glaub, meine Gommistiefel, dia du mir zum Namenstag gschenkt hast, hand mir’s Leba grettat.“
Wenn man den Wert einer Kuh in der damaligen Zeit bedenkt – das Fleisch konnte nur noch für einen Spottpreis auf der Freibank verkauft werden – hatte sich das Sprichwort wieder einmal bewahrheitet: „Jeder Sparer hat seinen Zehrer.“ Die Bauernbuben vom Dorf aber dichteten:
Salomon der Weise spricht:
Kühe hüten mag ich nicht!
Darum muß der Starkstrom her,
und gescheh’n ist das Malheur:
Ja, die Kuh lag schon am Boden,
er muß den Metzger Gottfried holen.
Damit war bei meinem Onkel die moderne Technik vorerst gestoppt und ich konnte als Hütebub wieder ein paar Mark verdienen.
*) Bayerische Warenhandelsgesellschaft, seit 1923, ursprünglich nur für Waren und Zubehör für die Landwirtschaft.
Aus Wo morgens der Hahn kräht. Band 2.
Quelle: „Lebertran und Chewing Gum“, Reihe ZEITGUT, Band 14
Buchtipps

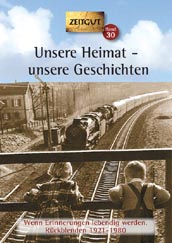 Band 30. Unsere Heimat - unsere Geschichten. Wenn Erinnerungen lebendig werden. Rückblenden 1921 bis 1980
Band 30. Unsere Heimat - unsere Geschichten. Wenn Erinnerungen lebendig werden. Rückblenden 1921 bis 1980Zum Shop »
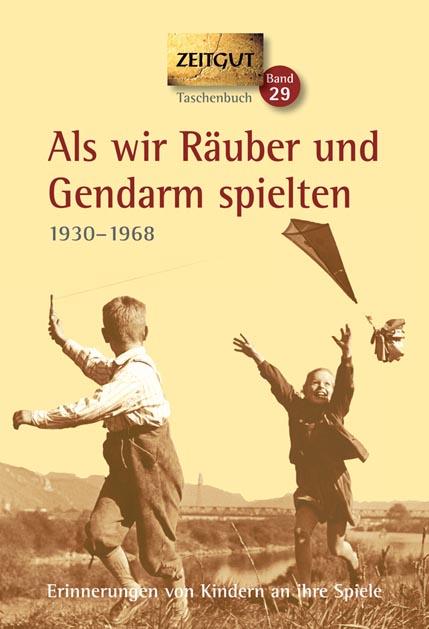 Band 29. Als wir Räuber und Gendarm spielten. Erinnerungen von Kindern an ihre Spiele. 1930-1968
Band 29. Als wir Räuber und Gendarm spielten. Erinnerungen von Kindern an ihre Spiele. 1930-1968Zum Shop »